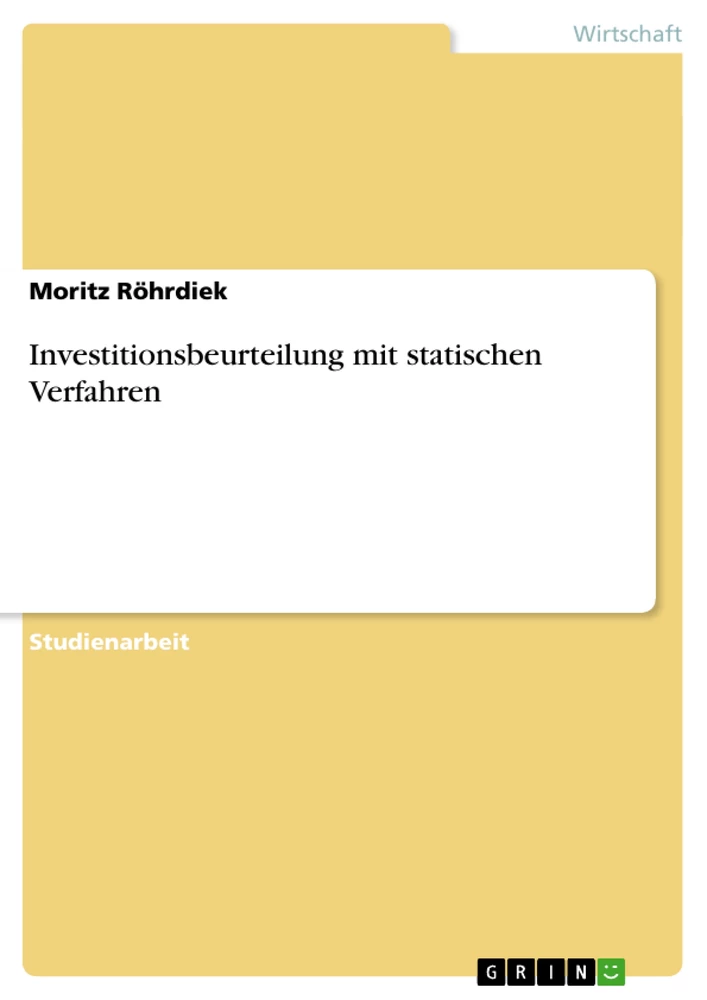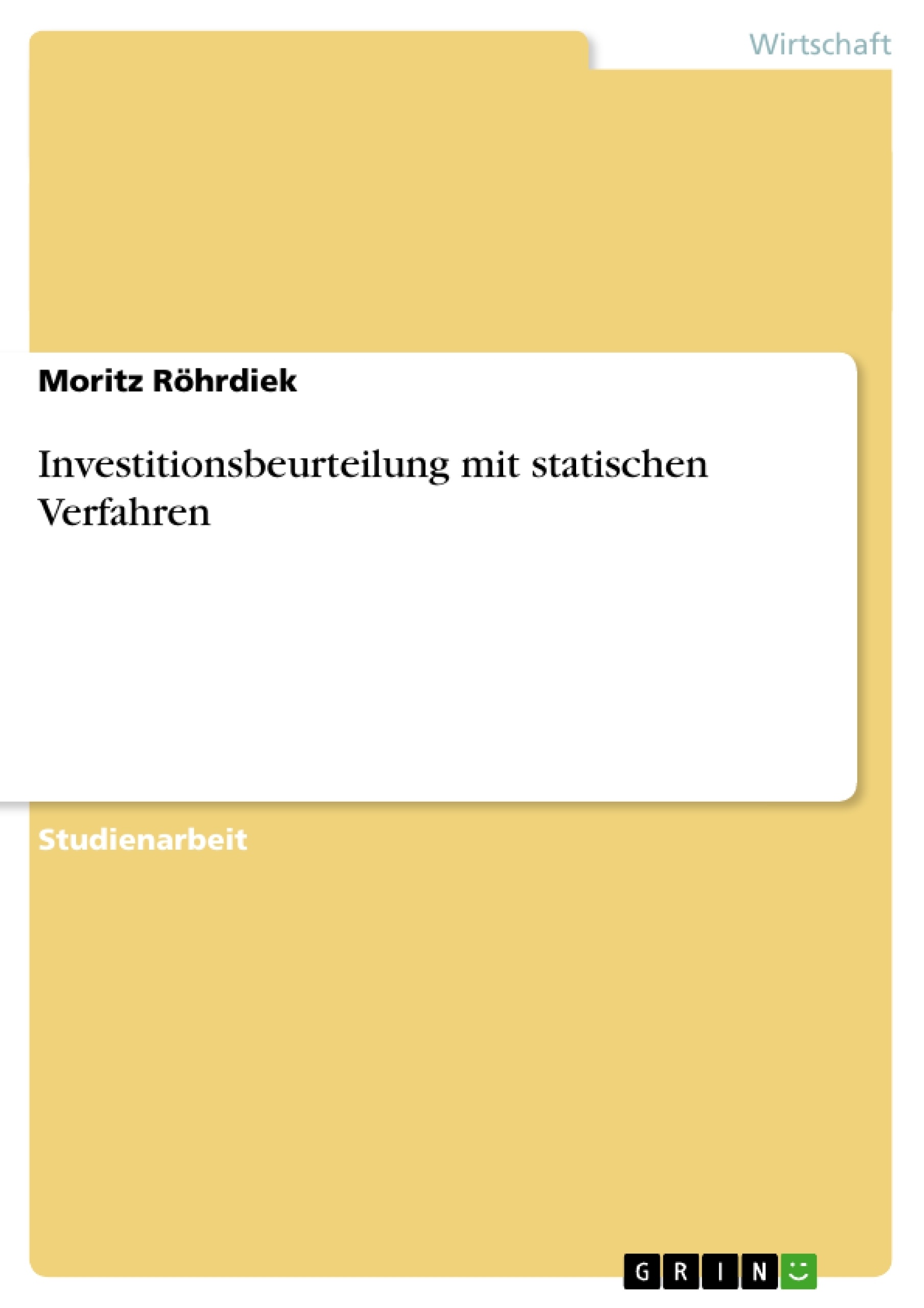Dass Fehlinvestitionen in der Wirtschaft nicht ungewöhnlich sind, zeigt eine für das
Handelsblatt erstellte Studie des „Centrums für Bilanzierung und Prüfung“ der Universität
Saarbrücken. Demnach mussten die 25 Industriekonzerne im Deutschen Aktienindex
als Folge von Fehlinvestitionen und überteuerten Zukäufen seit dem Jahr 2007 43,4
Milliarden Euro abschreiben, davon allein im Jahr 2011 13,3 Milliarden Euro.
Diese Arbeit soll zeigen, inwieweit die statischen Investitionsrechnungen Kostenvergleich,
Gewinnvergleich und Rentabilitätsvergleich geeignet sind, Investitionen zu beurteilen,
Investitionsentscheidungen zu unterstützen und somit Fehlinvestitionen zu
vermeiden. Im ersten Kapitel wird eine kurze Übersicht zu Investitionen gegeben sowie
die unterschiedlichen Arten der Investitionsbeurteilung dargestellt. Anschließend werden
die Kostenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung und die Rentabilitätsvergleichsrechnung
ausführlich und anhand von Beispielen vorgestellt, auf ihre Eignung
untersucht und zum Abschluss kritisch beurteilt. Im dritten Kapitel werden die
alternativen Methoden zur Investitionsbeurteilung kurz vorgestellt und in Kontext mit
den im Kapitel vorher untersuchten Methoden gestellt. Die Arbeit endet mit einem Fazit,
in dem die Ergebnisse zusammengefasst werden. Außerdem wird gezeigt, mit welchen
Investitionsrechnungen Unternehmen in der Praxis arbeiten.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Investitionen und ihre Bewertungsmöglichkeiten
3. Untersuchung der Verfahren
3.1. Kostenvergleichsrechnung
3.2. Gewinnvergleichsrechnung
3.3. Rentabilitätsvergleichsrechnung
3.4. Bewertung der Verfahren
4. Alternative Modelle zur Investitionsbeurteilung
5. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Dass Fehlinvestitionen in der Wirtschaft nicht ungewöhnlich sind, zeigt eine für das Handelsblatt erstellte Studie des „Centrums für Bilanzierung und Prüfung“ der Universität Saarbrücken. Demnach mussten die 25 Industriekonzerne im Deutschen Aktienindex als Folge von Fehlinvestitionen und überteuerten Zukäufen seit dem Jahr 2007 43,4 Milliarden Euro abschreiben, davon allein im Jahr 2011 13,3 Milliarden Euro.[1]
Diese Arbeit soll zeigen, inwieweit die statischen Investitionsrechnungen Kostenvergleich, Gewinnvergleich und Rentabilitätsvergleich geeignet sind, Investitionen zu beurteilen, Investitionsentscheidungen zu unterstützen und somit Fehlinvestitionen zu vermeiden. Im ersten Kapitel wird eine kurze Übersicht zu Investitionen gegeben sowie die unterschiedlichen Arten der Investitionsbeurteilung dargestellt. Anschließend werden die Kostenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung und die Rentabilitätsvergleichsrechnung ausführlich und anhand von Beispielen vorgestellt, auf ihre Eignung untersucht und zum Abschluss kritisch beurteilt. Im dritten Kapitel werden die alternativen Methoden zur Investitionsbeurteilung kurz vorgestellt und in Kontext mit den im Kapitel vorher untersuchten Methoden gestellt. Die Arbeit endet mit einem Fazit, in dem die Ergebnisse zusammengefasst werden. Außerdem wird gezeigt, mit welchen Investitionsrechnungen Unternehmen in der Praxis arbeiten.
2. Investitionen und ihre Bewertungsmöglichkeiten
Unter einer Investition versteht man die gegenwärtige Auszahlung von Kapital in der Absicht, mit diesem Mitteleinsatz in der Zukunft einen höheren Kapitalrückfluss zu erzielen.[2] Spekulationen und Unsicherheiten spielen jedoch bei Investitionen immer eine Rolle, denn es fallen garantiert Auszahlungen an, die Höhe der Einzahlungen und ihre Dauer ist jedoch unsicher.[3] Aufgrund ihrer langfristigen Folgewirkung und ihrer hohen Kapitalbindung besitzen Investitionen einen maßgeblichen Einfluss auf den zukünftigen Erfolg bzw. Misserfolg eines Unternehmens und gehören somit zu den wichtigsten unternehmerischen Entscheidungen.[4]
Aufgrund ihrer hohen Bedeutung für die wirtschaftliche Zukunft eines Unternehmens gilt es bei der Investitionsentscheidung Fehlinvestitionen zu minimieren, wenngleich sie nie komplett vermieden werden können. Bei der Beurteilung von Investitionen wird zwischen zwei Methoden unterschieden: Zum einen gibt es die quantitativen Methoden, die untersuchen ob die Investition zur finanziellen Zielerreichung beiträgt. Zum anderen die qualitativen Methoden, die ausschließlich nicht finanzielle Ziele (z.B. Umweltverträglichkeit oder Mitarbeiterzufriedenheit) in die Entscheidungsfindung mit einbeziehen.[5]
Die Investitionsrechnungen gehören zu den quantitativen Methoden, also werden die finanziellen Aspekte der Investition untersucht. Hierbei wird zwischen den traditionellen statischen Verfahren und den dynamischen Verfahren unterschieden. Die statischen Verfahren sind, bis auf die statische Amortisationsrechnung, einperiodische Verfahren der Wirtschaftlichkeitsprüfung von Investitionsprojekten. Sie unterstellen einen durchschnittlichen Verlauf der relevanten Kosten und ggf. Erlöse und legen
dieser eine repräsentativen Periode zugrunde. Zu den statischen Verfahren zählen. Die Kostenvergleichsrechnung, die Gewinnvergleichsrechnung, die Rentabilitätsvergleichsrechnung sowie die statische Amortisationsrechnung.[6]
Im Gegensatz zu den statischen Verfahren berücksichtigen die dynamischen explizit den zeitlichen Unterschied der Ein- und Auszahlungen der Investition.
Hierfür wird eine Zahlungsreihe mit den durch das Projekt verursachten Ein- und Auszahlungen erstellt und mit Hilfe finanzmathematischer Methoden auf einen gemeinsamen Zeitpunkt bezogen.[7] Die drei gebräuchlichsten dynamischen Verfahren sind die Kapitalwertmethode, die interne Zinssatzmethode sowie die Annuitätenmethode.[8]
[...]
[1] Vgl. Fockenbrock D./Metzger S. Handelsblatt 01.11. 2012
[2] Vgl. Döring U./Wöhe G., 2010, S. 520
[3] Vgl. Adam D. 1994, S. 1
[4] Vgl. Blohm H./Lüders K./Schaefer C., 2011, S. 3
[5] Vgl. Busse von Colbe W. u. a., 2007 S. 309
[6] Vgl. Braunschweid C., 1998 S. 39
[7] Vgl. Busse von Colbe W. u. a.2007 S. 313 ff.
[8] Vgl. Busse von Colbe W. u. a. S. 314
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen statischen und dynamischen Investitionsrechnungen?
Statische Verfahren betrachten eine Durchschnittsperiode und vernachlässigen den Zeitwert des Geldes, während dynamische Verfahren alle Ein- und Auszahlungen zeitgenau erfassen und abzinsen.
Wie funktioniert die Kostenvergleichsrechnung?
Sie vergleicht zwei oder mehr Investitionsalternativen hinsichtlich der anfallenden Kosten pro Periode oder pro Leistungseinheit, um die kostengünstigste Variante zu finden.
Was misst die Rentabilitätsvergleichsrechnung?
Sie setzt den durchschnittlichen jährlichen Gewinn ins Verhältnis zum durchschnittlich eingesetzten Kapital, um die Verzinsung der Investition zu ermitteln.
Warum sind statische Verfahren trotz ihrer Kritik in der Praxis beliebt?
Sie sind einfach anzuwenden, erfordern weniger Daten als dynamische Modelle und bieten eine schnelle erste Orientierung für kleinere Investitionsprojekte.
Was sind die Grenzen der Gewinnvergleichsrechnung?
Sie berücksichtigt nicht die unterschiedliche Höhe des eingesetzten Kapitals und die zeitliche Verteilung der Rückflüsse, was zu Fehlentscheidungen führen kann.
- Citar trabajo
- Moritz Röhrdiek (Autor), 2012, Investitionsbeurteilung mit statischen Verfahren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215270