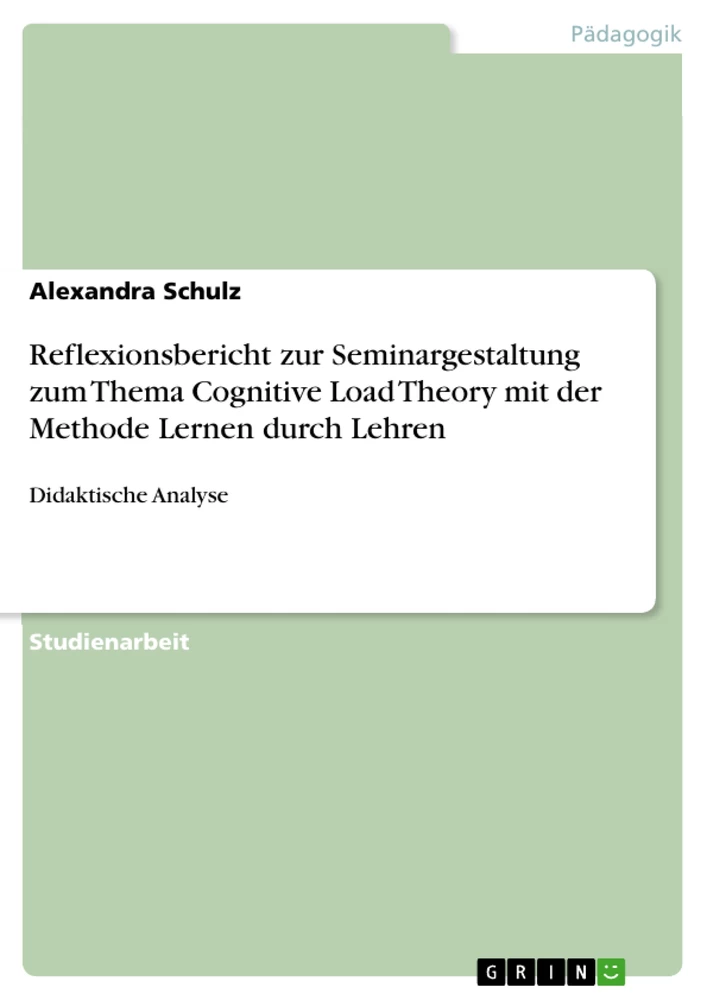Der vorliegende Reflexionsbericht bezieht sich auf die Gestaltung einer Seminarstunde im
Rahmen des Seminars Pädagogische Psychologie. Anhand der Methode Lernen durch Lehren
war ich gemeinsam mit vier weiteren Kommilitonen dafür verantwortlich, im Hinblick auf die
Vermittlung von Wissen, eine Präsentation zum Thema Cognitive-Load Theorie zu planen
und durchzuführen. Im Folgenden werde ich auf die Inhalte und Konzeption der Seminarstunde
eingehen und auf der Grundlage meiner Erfahrungen die praktische Umsetzung bewerten.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Überblick über die Inhalte des Seminars
3 Gesamtkonzept und Lehrziele der Seminarstunde
4 Überblick über die Seminarstunde
4.1 Zeitplanung
4.2 Tatsächlicher Verlauf
5 Reflexion der Seminarstunde
5.1. Pädagogisch-psychologische Theorien zur Konzeption
5.2. Konzeptuelle Schwierigkeiten
5.3 Konzeptuell bewährte Aspekte
5.4 Veränderungsvorschläge für zukünftige Seminargestaltungen
6 Reflexion und Weiterentwicklung der eigenen Lehrkompetenz
6.1 Mein Rollenverständnis als Lehrender
6.2 Schritte für die Entwicklung meiner Lehrkompetenz
7 Literaturverzeichnis
8 Anhang
8.1 Didaktische Planung der Seminarstunde
8.2 PowerPoint-Folien
8.4 Gruppenarbeit
8.5 Gruppenarbeit
8.5 Fotoprotokoll der Lernerfolgsmessung
- Citar trabajo
- Cand. M.Sc. Psych. Alexandra Schulz (Autor), 2010, Reflexionsbericht zur Seminargestaltung zum Thema Cognitive Load Theory mit der Methode Lernen durch Lehren, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215278