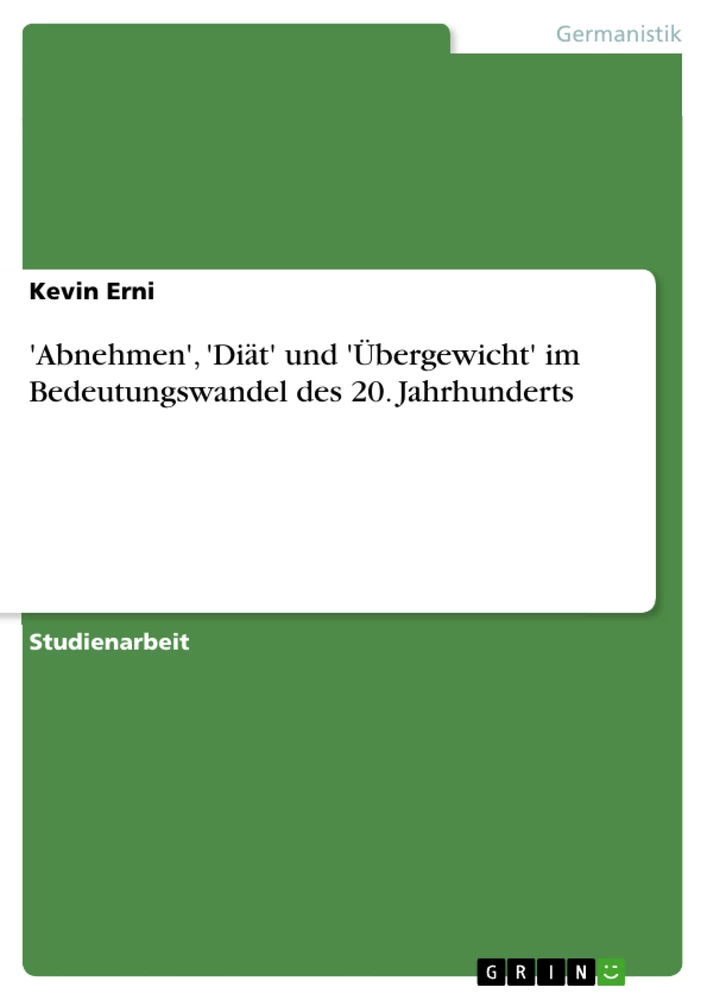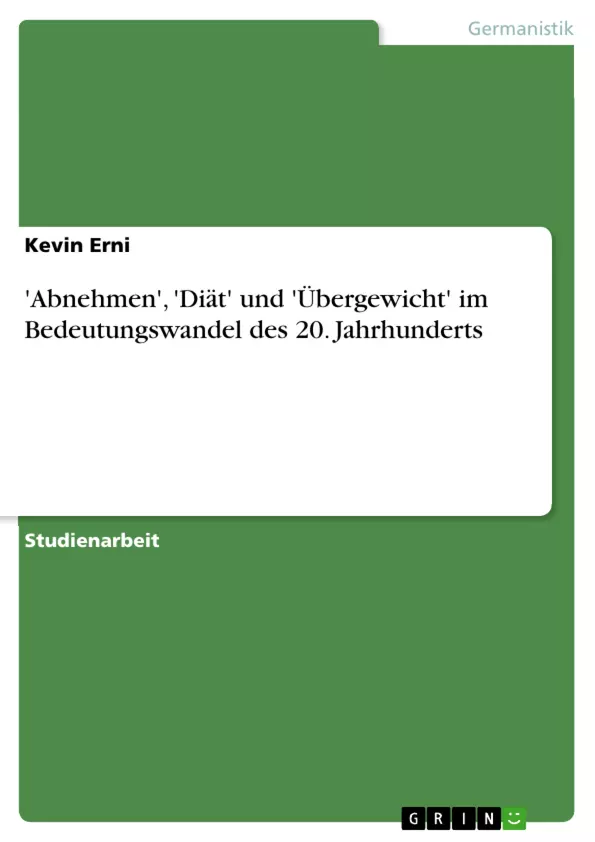Jede Sprache ist überall und zu jeder Zeit einem Wandel ausgesetzt; nicht nur die Sprache per se verändert sich, sondern auch ihre einzelnen Subsysteme wie Phonologie, Lexik und Semantik. Die vorliegende Arbeit befasst sich einschliesslich mit dem semantischen Aspekt der Sprache, genauer gesagt mit der Betrachtung des diachronen Bedeutungswandels dreier Wörter im 20. Jahrhundert. Um den Effekt der rasanten gesellschaftlichen Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg auf allfällige Wortbedeutungsveränderungen in der deutschen Sprache untersuchen zu können, wurde entschieden, drei Wörter aus dem Bereich der Ernährung unter die Lupe zu nehmen. Es sind dies: „Abnehmen“, „Diät“ und „Übergewicht“. Die Arbeit stützt sich auf die Vermutung, dass die erhöhte Nahrungsproduktion nach dem Zweiten Weltkrieg Probleme des Übergewichts in den deutsch-europäischen Nationen zutage förderte. Der Ursprung für die Aktualität, die das Thema Überernährung heute erfährt, müsste somit in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein; zu dieser Zeit müssten die Bedeutungen der erwähnten Wörter einen Wandel erfahren haben. Das Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, ob, wann und in welcher Form ein Bedeutungswandel stattgefunden hat. Zur Überprüfung der Thesen eignen sich das im Online-Korpus C4 verfügbare, länderübergreifende Angebot an Textwörtern sowie der Bestand des DWDS.
INHALTSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
2 THEORETISCHER HINTERGRUND
2.1 Bedeutungswandel
2.1.1 Definition
2.1.2 Arten des Bedeutungswandels
2.1.3 „Soziale Entlehnung“
2.1.4 Die unsichtbare Hand
2.2 Fakten zum Übergewicht
3 Methodisches verfahren
3.1 Konzept und Methode der Korpusanalyse
3.2 Ausgewählte Korpora
4 Ergebnisse und auswertung der analyse
4.1 „Abnehmen“
4.2 „Diät“
4.3 „Übergewicht“
5 SCHLUSSWORT
Häufig gestellte Fragen
Wie hat sich die Bedeutung von „Diät“ im 20. Jahrhundert gewandelt?
Die Arbeit untersucht den semantischen Wandel von einer allgemeinen Lebensweise oder Krankenkost hin zu einem Begriff, der heute stark mit Gewichtsreduktion verknüpft ist.
Welchen Einfluss hatte die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg auf Ernährungswörter?
Die erhöhte Nahrungsproduktion führte erstmals zu Problemen des Übergewichts, wodurch Wörter wie „Abnehmen“ eine neue gesellschaftliche Relevanz und Bedeutungsnuancen erhielten.
Was versteht man unter „sozialer Entlehnung“ in der Sprachwissenschaft?
Es beschreibt den Prozess, bei dem Begriffe aus bestimmten sozialen Gruppen oder Fachsprachen in den allgemeinen Sprachgebrauch übergehen und dabei ihre Bedeutung verändern.
Welche Datenquellen wurden für die Wortanalyse genutzt?
Die Untersuchung stützt sich auf das Online-Korpus C4 sowie auf die digitalen Bestände des DWDS (Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache).
Wann fand der rasanteste Bedeutungswandel statt?
Die Studie vermutet den Ursprung der heutigen Aktualität von Überernährung und dem damit verbundenen Wortwandel in den Jahrzehnten direkt nach dem Zweiten Weltkrieg.
- Citation du texte
- Kevin Erni (Auteur), 2013, 'Abnehmen', 'Diät' und 'Übergewicht' im Bedeutungswandel des 20. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215510