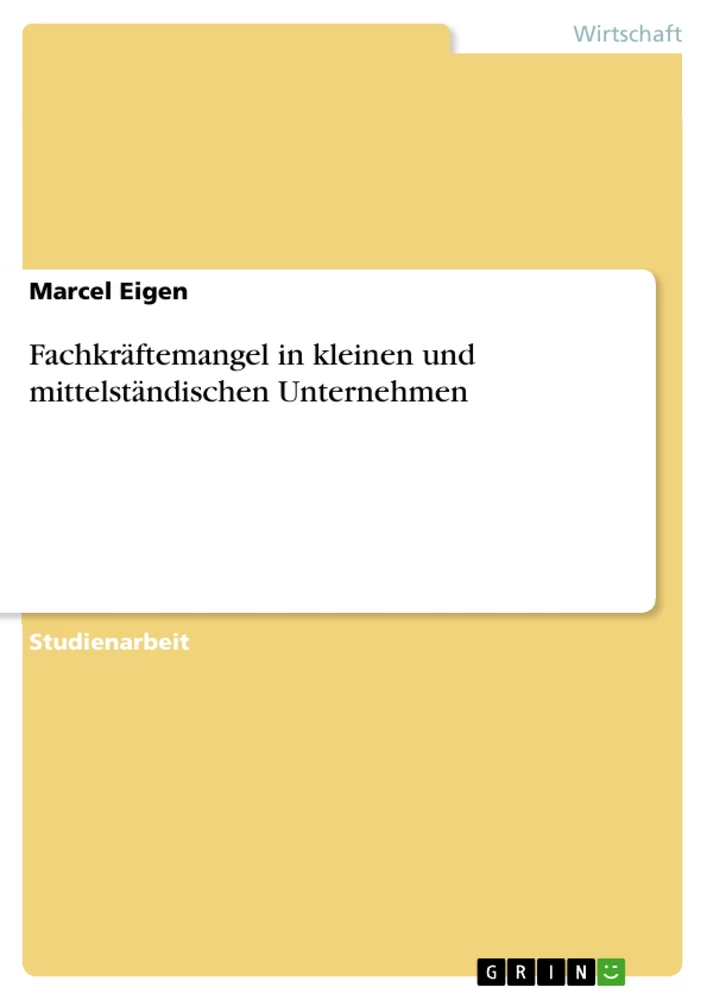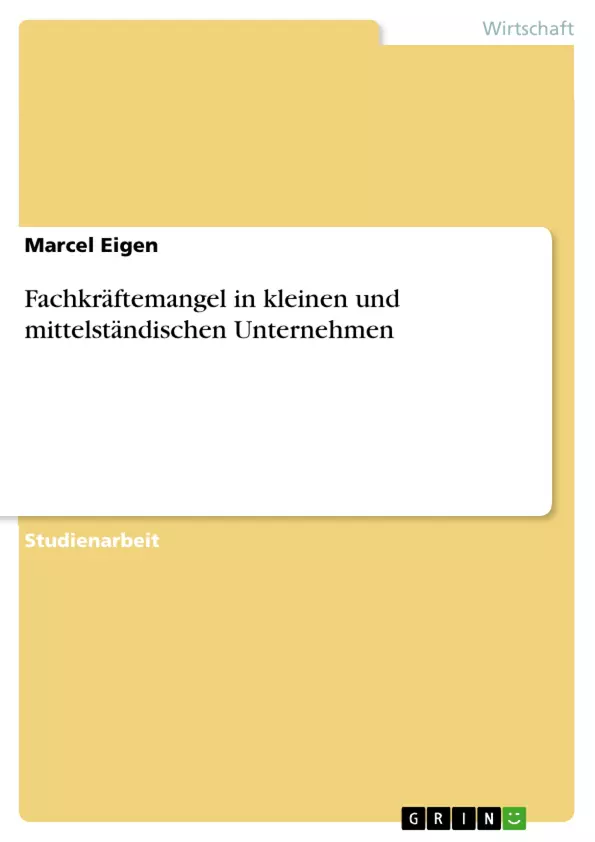Das Thema Fachkräftemangel im Mittelstand erfährt aktuell eine hohe Bedeutung und wird sowohl in der Literatur als auch in den Medien ausführlich diskutiert. Konjunkturell bedingten Fachkräftemangel hat es schon immer gegeben und wird es aller Voraussicht nach auch in Zukunft geben. Doch wird sich die Problematik durch den demografischen Wandel deutlich verstärken.
Die vorliegende Arbeit nimmt sich diesem Thema an und verfolgt das Ziel, den Fachkräftemangel in kleinen und mittelständischen Unternehmen zu veranschaulichen sowie Handlungsempfehlungen aufzuzeigen. Zu diesem Zweck wird zunächst auf die Grundlagen zum Mittelstand eingegangen. Kleine und mittlere Unternehmen werden durch qualifizierte Merkmale der Größenbestimmung abgegrenzt. Die besondere Bedeutung von mittelständischen Unternehmen in Deutschland wird folgend dargelegt. Anschließend werden die Bezeichnungen Fachkraft und Fachkräftemangel definiert, um hiernach am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland den Fachkräftemangel deutlich zu machen. Das Kapitel 3 schließt mit der Betrachtung der zu erwartenden Entwicklung dieses Mangels ab. Den Abschluss der Arbeit bildet die Betrachtung von Handlungsempfehlungen zur Bewältigung des Fachkräftemangels aus politischer und unternehmerischer Sichtweise.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen zum Mittelstand
- 2.1 Definition mittelständische Unternehmen
- 2.2 Bedeutung von mittelständischen Unternehmen in Deutschland
- 3 Skizzierung des Fachkräftemangels
- 3.1 Definition Fachkraft
- 3.2 Definition Fachkräftemangel
- 3.3 Fachkräftemangel am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland
- 3.4 Entwicklung des Fachkräftemangels
- 4 Handlungsempfehlungen zur Bewältigung des Fachkräftemangels
- 4.1 Politische Handlungsfelder
- 4.2 Förderung der Personalpolitik innerhalb der Unternehmen
- 5 Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit im Rahmen des Fernstudiengangs „Betriebswirtschaftslehre" befasst sich mit der Thematik des Fachkräftemangels in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU). Sie analysiert die Ursachen des Fachkräftemangels und die daraus resultierenden Herausforderungen für den Mittelstand. Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Problematik zu veranschaulichen und Handlungsempfehlungen für die Bewältigung des Fachkräftemangels aufzuzeigen.
- Definition von Fachkraft und Fachkräftemangel
- Bedeutung des Mittelstands für die deutsche Wirtschaft
- Ursachen des Fachkräftemangels im Mittelstand
- Handlungsempfehlungen aus politischer und unternehmerischer Sicht
- Zukünftige Entwicklung des Fachkräftemangels
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Fachkräftemangels im Mittelstand ein und stellt die Relevanz des Themas dar. Sie beleuchtet den demografischen Wandel und dessen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt.
Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen zum Mittelstand beleuchtet. Es werden verschiedene Definitionen von mittelständischen Unternehmen vorgestellt und die besondere Bedeutung des Mittelstands für die deutsche Wirtschaft hervorgehoben.
Das dritte Kapitel skizziert den Fachkräftemangel. Es wird die Definition von Fachkraft und Fachkräftemangel erläutert und die Problematik des Fachkräftemangels am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland veranschaulicht. Weiterhin wird die Entwicklung des Fachkräftemangels betrachtet.
Im vierten Kapitel werden Handlungsempfehlungen zur Bewältigung des Fachkräftemangels präsentiert. Es werden politische Handlungsfelder aufgezeigt und die Bedeutung der Förderung der Personalpolitik innerhalb der Unternehmen hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Fachkräftemangel, den Mittelstand, die Personalpolitik, die demografische Entwicklung, die Handlungsempfehlungen und die Bedeutung des Mittelstands für die deutsche Wirtschaft. Der Text analysiert die Ursachen des Fachkräftemangels und die daraus resultierenden Herausforderungen für den Mittelstand. Er beleuchtet die Bedeutung von Personalpolitik innerhalb der Unternehmen und zeigt politische Handlungsfelder auf, die zur Bewältigung des Fachkräftemangels beitragen können.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Hauptursachen für den Fachkräftemangel im Mittelstand?
Neben konjunkturellen Schwankungen ist vor allem der demografische Wandel eine zentrale Ursache, die die Problematik langfristig verschärft.
Wie definiert die Arbeit kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)?
KMU werden durch spezifische qualitative und quantitative Merkmale der Größenbestimmung vom Großgewerbe abgegrenzt.
Welche Bedeutung hat der Mittelstand für Deutschland?
Mittelständische Unternehmen gelten als Rückgrat der deutschen Wirtschaft und haben eine besondere Bedeutung für Beschäftigung und Ausbildung.
Welche politischen Handlungsempfehlungen gibt die Arbeit?
Die Arbeit schlägt politische Maßnahmen vor, die Rahmenbedingungen verbessern sollen, um den Fachkräftebedarf in Deutschland langfristig zu sichern.
Wie können Unternehmen selbst gegen den Fachkräftemangel vorgehen?
Durch eine gezielte Förderung der internen Personalpolitik und attraktive Arbeitsbedingungen können KMU Fachkräfte binden und neu gewinnen.
- Citar trabajo
- Diplom Betriebswirt (FH) Marcel Eigen (Autor), 2013, Fachkräftemangel in kleinen und mittelständischen Unternehmen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/215788