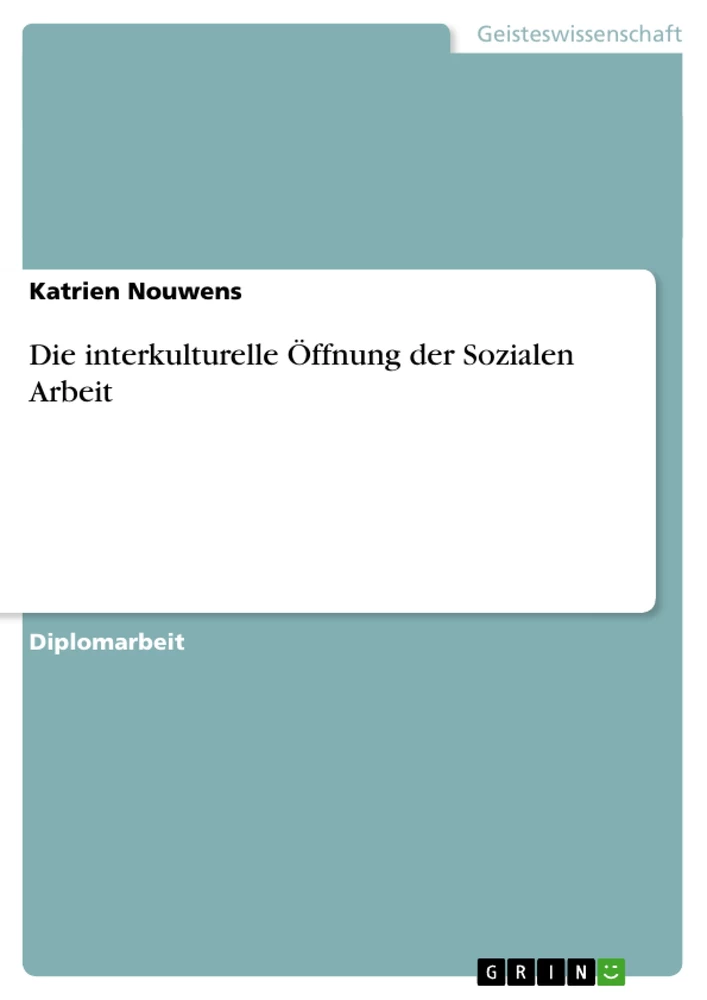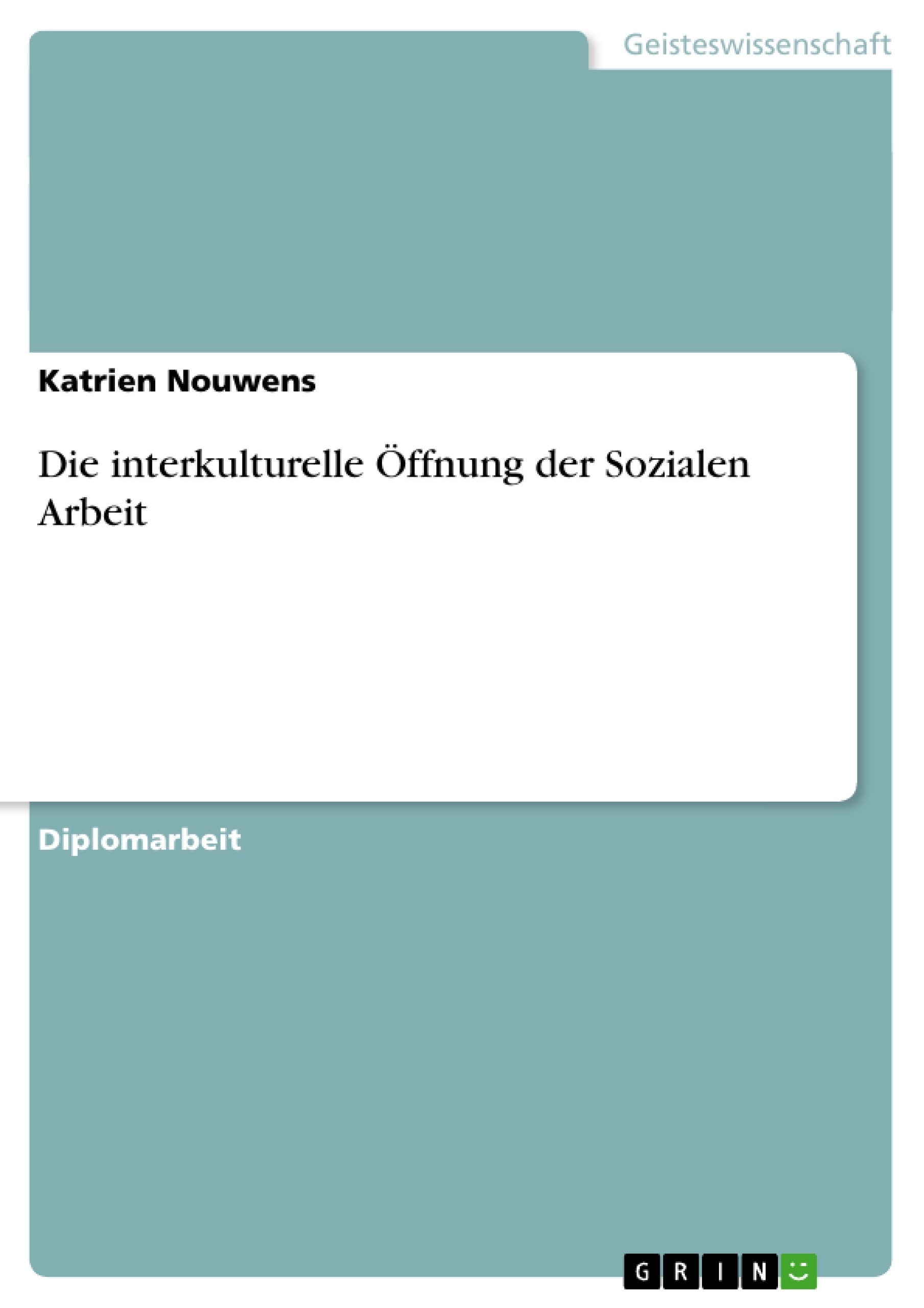Deutschland ist schon immer ein Land gewesen, in dem, in das und durch das sich
Menschen bewegt haben. Deutsche wanderten ins Ausland und Fremde kamen nach
Deutschland. Diese Wanderbewegungen wurden von gesellschaftlichen Prozessen
beeinflußt, denen Armut, Arbeitslosigkeit, Krieg, politische Verfolgung, Umweltkatastrophen
und Bildung zugrunde lagen.
Die Entwicklung von Migration wurde zwar in verschiedenen Modellen beschrieben, aber
eine allgemein anerkannte Definition oder Theorie gibt es nicht. Migration ist ein äußerst
komplexes Phänomen, dass sich nicht auf eine Zuwanderungsgruppe oder ein Motiv von
Zuwanderung beschränken läßt. Daher werden hier alle Formen von Bewegung mit
dauerhafter oder temporärer Verlagerung des Lebensmittelpunktes an einen anderen Ort als
Migration verstanden.
Menschen, die in einen anderen Staat zuwandern oder aus diesem abwandern werden mit
verschiedenen Begriffen beschrieben. Diese werden aufgrund der wachsenden
Heterogenität von Migranten immer vielfältiger und komplizierter. Im folgenden wird versucht,
den jeweils adäquaten Begriff zu verwenden.
Die verschiedenen Zuwanderungsgruppen in Deutschland bilden ethnische Minderheiten
innerhalb der Aufnahmegesellschaft. Diese Aufnahmegesellschaft steht heute erstmals vor
der Situation, dass einerseits immer mehr Menschen die deutsche Staatsbürgerschaft
besitzen, ohne deutschstämmig zu sein. Andererseits gibt es Menschen, die aufgrund ihrer
Deutschstämmigkeit die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, ohne wirklich die Sprache zu
beherrschen. Wenn von deutscher Mehrheitsgesellschaft die Rede ist, so muß also dieser
Umstand mitbedacht werden.
Begriff ethnische Minderheiten
Der Begriff der ethnischen Minderheiten meint im engeren, rechtlichen Sinne
alteingesessene Bevölkerungsgruppen, wie z.B. die Dänen, Sorben und Friesen, die
aufgrund historischer Entwicklungen die deutsche Staatsbürgerschaft haben, jedoch ihre
eigenen kulturellen Merkmale besitzen und ihre Tradition bewahren. Er wird in der
sozialwissenschaftlichen Praxis aber immer mehr durch einen erweiterten Begriff ersetzt, der
auch alle Migrantengruppen umfaßt, die ebenfalls ihre eigenen kulturellen Merkmale
besitzen, aber erst in der jüngeren Geschichte zugewandert sind und zum größten Teil nicht
die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Da es in dieser Arbeit um die zweite Gruppe von
Minderheiten gehen soll, wird der Begriff der ethnischen Minderheiten im folgenden in dieser
erweiterten Bedeutung verwendet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Einleitung
- Begriff ethnische Minderheiten
- Die Entwicklung der Ausländer- und Integrationspolitik in der BRD
- Deutschland: ein Einwanderungsland?
- A. Erörterung eines Kultur- und Integrationsverständnisses
- 1. Zum Begriff Integration
- 1.1 Definition
- 1.2 Erwartungen und Mißverständnisse
- 2. Die Adressaten von Integration
- 2.1 Die Zuwanderer
- 2.1.1 Zuwanderung in Zahlen
- 2.1.2 Die Art und Herkunft der Zuwanderergruppen
- 2.1.3 Welche Gruppen sollen integriert werden?
- 2.1.4 Welchen rechtlichen und gesellschaftlichen Status haben sie?
- 2.2 Die Mehrheitsgesellschaft
- 3. Zum Begriff Kultur
- 3.1 Definition
- 3.2 Verschiedene Kulturen in Deutschland
- 3.3 Deutsche Leitkultur?
- 4. Lebendiges Zusammenleben
- 4.1 Verschiedene Konzepte einer modernen Gesellschaft
- B. Handeln und Umsetzen
- 5. Integrationsbereiche
- 5.1 Schulische und vorschulische Integration
- 5.2 Berufliche Integration
- 5.3 Gesellschaftlich- kulturelle Integration
- 5.4 Politisch- demokratische Integration
- 6. Die Ressourcen von Zuwanderern
- 7. Wahrnehmung von Zuwanderung in Deutschland
- 7.1 Akzeptanz
- 7.2 Differenz
- 7.3 Konfliktbereiche
- 7.4 Beeinflussung durch die Medien
- C. Beitrag der Sozialen Arbeit: Interkulturelle Öffnung
- 8. Neuorientierung in der Migrationsarbeit
- 9. Die Interkulturelle Öffnung der Sozialen Arbeit
- 9.1 „Empfehlungen zur interkulturellen Öffnung sozialer Dienste” nach Hinz-Rommel
- 9.2 Anforderungen an Konzeption, Organisation und Träger
- 9.3 Anforderungen an die Mitarbeiter
- 9.4 Anforderungen an die Einrichtungen der Aus- und Fortbildung
- 9.5 Schwierigkeiten bei der Umsetzung
- 9.6 Aktueller Stand
- D. Untersuchung der Praxis: Dienste, Einrichtungen und Projekte
- 10. Überregionale und bundesweite Beispiele
- 11. Das Beispiel Freiburg
- 12. Diskussion der Ergebnisse
- E. Resümee
- Entwicklung der Ausländer- und Integrationspolitik in Deutschland
- Verschiedene Konzepte von Kultur und Integration
- Die Bedeutung von Sprache und Bildung für Integration
- Herausforderungen und Konfliktpotenziale bei der Integration von Zuwanderern
- Die Rolle der Sozialen Arbeit in der interkulturellen Öffnung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der interkulturellen Öffnung der Sozialen Arbeit im Kontext der Migrationsarbeit. Das Hauptziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen der Integration von Zuwanderern in Deutschland zu entwickeln und die Rolle der Sozialen Arbeit in diesem Prozess zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der interkulturellen Öffnung der Sozialen Arbeit ein und skizziert den thematischen Fokus der Arbeit. Das Kapitel "Begriff ethnische Minderheiten" beleuchtet den Begriff der "ethnischen Minderheit" und seine Bedeutung im Kontext der Migrationsarbeit. Die Entwicklung der Ausländer- und Integrationspolitik in Deutschland wird im nächsten Kapitel analysiert, wobei die zentralen politischen Strömungen und die Herausforderungen des Einwanderungslandes Deutschland im Vordergrund stehen.
Im Abschnitt "A. Erörterung eines Kultur- und Integrationsverständnisses" wird zunächst der Begriff "Integration" im Detail betrachtet, einschließlich seiner Definition, Erwartungen und potenziellen Missverständnisse. Die Adressaten von Integration werden anschließend im Fokus des Kapitels stehen, wobei verschiedene Zuwanderergruppen und ihre spezifischen Herausforderungen beleuchtet werden. Die Mehrheitsgesellschaft und ihr Integrationsverständnis werden ebenfalls analysiert.
Der Abschnitt "B. Handeln und Umsetzen" befasst sich mit den zentralen Integrationsbereichen, wie beispielsweise der schulischen und beruflichen Integration. Des Weiteren wird die Rolle von Sprache und Bildung im Integrationsprozess untersucht. Weitere wichtige Themen sind die gesellschaftlich-kulturelle und die politisch-demokratische Integration sowie die Wahrnehmung von Zuwanderung in Deutschland.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die zentralen Begriffe der interkulturellen Öffnung der Sozialen Arbeit, der Migrationsarbeit, der Integration, der Kultur, des Kulturverständnisses, der Zuwanderer, der Mehrheitsgesellschaft und der Herausforderungen und Chancen der Integration. Dabei werden die verschiedenen Integrationsbereiche und die Rolle der Sozialen Arbeit im Integrationsprozess untersucht.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "interkulturelle Öffnung" in der Sozialen Arbeit?
Es beschreibt die Anpassung von sozialen Diensten und Organisationen an die Bedürfnisse einer heterogenen, durch Migration geprägten Gesellschaft.
Wer gehört zur Gruppe der "ethnischen Minderheiten" in dieser Arbeit?
Der Begriff umfasst hier alle Migrantengruppen, die eigene kulturelle Merkmale besitzen und in der jüngeren Geschichte nach Deutschland zugewandert sind.
Welche Rolle spielt die Sprache für die Integration?
Sprache gilt als zentraler Schlüssel zur schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Teilhabe von Zuwanderern.
Was sind die größten Schwierigkeiten bei der Umsetzung der interkulturellen Öffnung?
Herausforderungen liegen oft in starren Organisationsstrukturen, fehlender Fortbildung der Mitarbeiter und mangelnder Akzeptanz in der Mehrheitsgesellschaft.
Wie hat sich die deutsche Integrationspolitik entwickelt?
Die Arbeit analysiert den Wandel von der frühen Ausländerpolitik hin zu modernen Konzepten eines Einwanderungslandes.
- Citar trabajo
- Katrien Nouwens (Autor), 2002, Die interkulturelle Öffnung der Sozialen Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/21890