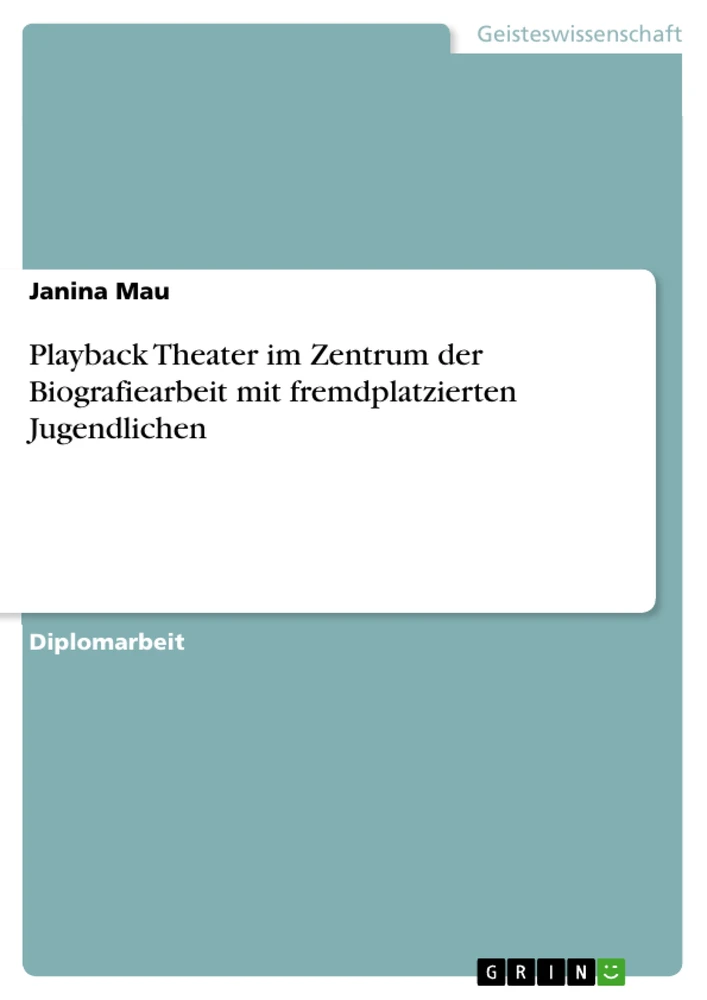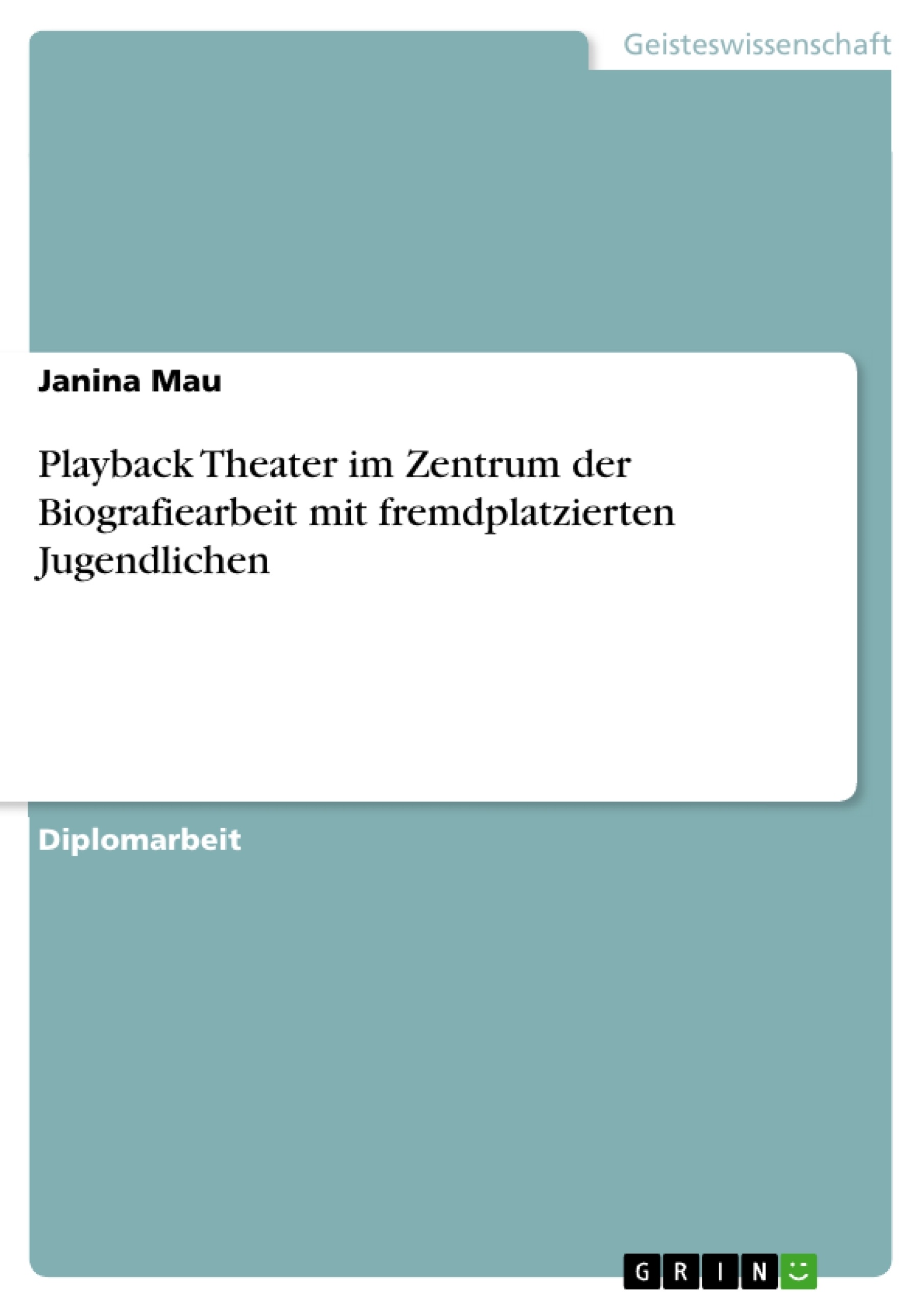In folgender Diplomarbeit werden detailliert die Themen Identität und Identitätsentwicklung, die Zielgruppe Fremdplatzierte (Jugendliche), Biografiearbeit als Methode der Sozialarbeit und Therapie und das Playback Theater nach Jonathan Fox behandelt.
Ziel dieser Arbeit ist es, eine wissenschaftliche Grundlage zu schaffen um aufzuzeigen warum, und zu belegen dass, Playback Theater sich als Methode für die Biografiearbeit mit fremdplatzierten Jugendlichen besonders eignet. Dieser Zusammenhang taucht bisher in äußerst wenigen wissenschaftlichen Arbeiten auf, obwohl es offensichtlich naheliegend ist.
Zunächst wird dargestellt, dass Jugendliche mit der Hauptaufgabe Identitätsentwicklung konfrontiert sind und welche Merkmale Fremdplatzierte kennzeichnen. Anschließend wird Identität definiert und nach einem Überblick über verschiedene Identitätstheorien zusammengeführt, was davon für die weitere Arbeit bedeutsam erscheint. Im Weiteren wird spezifiziert, weshalb die Identitätsentwicklung für fremdplatzierte Jugendliche im Vergleich zu nicht-fremdplatzierten eine außerordentliche Herausforderung darstellt.
Kapitel 4 behandelt die Biografiearbeit und liefert Argumente, weshalb die Verwendung von Narrationen und kreativen Methoden – als spezielle Methoden Playback Theater und Kreatives Schreiben – dabei besonders gewinnbringend sind, und weshalb Fremdplatzierte davon besonders profitieren können.
Kapitel 5 setzt sich fundiert mit der Methode des Playback Theater auseinander. Zunächst werden charakteristische und strukturelle Eigenschaften dieser Theaterform vorgestellt, sowie Vorschläge zu ihrer Modifikation für Fremdplatzierte innerhalb der Biografiearbeit gemacht. Anschließend werden ausführlich identitätsrelevante und heilende Erfahrungen des Playback dargestellt, die für den Biografiearbeitsprozess und die Zielgruppe förderlich sind und im speziellen in der Adolezenz als Gruppenarbeit gut ihre Wirkung entfalten können.
Zuletzt folgen einige didaktische Überlegungen zu Vorarbeit und Durchführung sowie ein Resümee und Ausblick.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Jugendliche
- Pubertät und Adoleszenz
- Entwicklungsaufgaben
- Risikofaktoren
- Schutzfaktoren
- Hauptaufgabe Identitätsentwicklung
- Lebenswelt
- Fremdplatzierte Jugendliche
- Formen der Fremdunterbringung
- Identität
- Begrifflichkeiten
- Gesellschaftliche Bedingungen individueller Identität
- Identitätsentwicklung ein Jugendthema?
- Identität und Biografie als „neue Themen“
- Eine postmoderne Gesellschaft
- Identitätstheorien
- Identitätsentwicklung in Phasen
- Identität durch soziale Interaktion
- Identität als Konstruktion
- Konstruktion durch Narration
- Mögliche Selbste
- Zusammenführung
- Erschwerte Identitätsentwicklung von Fremdplatzierten
- Thesen
- Konfusion
- Negative Gefühle
- Traumata
- Reaktionen und Verhalten
- Biografiearbeit
- Narrationen in der Biografiearbeit
- Verbreitung und Verwendung
- Narrationen
- Autobiografische Geschichten und Identität
- Beispiele
- Ästhetik und Kreativität in der Biografiearbeit
- Kreative Methoden und Ästhetische Bildung
- Wirkungen
- Biografiearbeit mit Fremdplatzierten
- Biografiearbeit während der Adoleszenz
- Biografiearbeit als Gruppenarbeit
- Ziele
- Kohärenz finden
- Verstehen und Bewältigen
- Selbstwertgefühl und Selbstwirksamkeit
- Ressourcen entdecken und nutzen
- Neue Blickwinkel einnehmen
- Dokumentation
- Übungen
- Besonders geeignete Methoden für die Biografiearbeit
- Playback Theater
- Über eine besondere Theaterform
- Wesen
- Abgrenzung zu anderen NST-Formen
- Historie
- Anwendungsfelder
- Playback-Aufführungen – Ablauf und Elemente
- Eröffnung
- Fließende Skulpturen
- Paare
- Geschichten („Szenen“)
- Bühnenausstattung
- Leiter
- Abänderungen für die Biografiearbeit mit Fremdplatzierten
- Playback als Biografie- und Identitätsarbeit
- Identitätsrelevante und heilende Erfahrungen durch Playback Theater
- Mitteilen von persönlichen Geschichten
- Kohärenz, Ressourcen, Autonomie
- Wertfreiheit und Sicherheit
- Veränderter Blickwinkel
- Rollen spielen
- Spontaneität
- Gemeinschaftlichkeit
- Gemeinsam transformieren
- Große Geschichten
- Therapeutische Atmosphäre
- Anwendungsbeispiel: Playback im Heim
- Didaktische Überlegungen
- Planung
- Vorarbeit
- Gruppenzusammensetzung, Häufigkeit, Setting
- Anforderungen an den Biografiearbeiter
- Beziehung
- Gesprächsführung
- Handlungsmaxime
- Gruppenbildende Maßnahmen und Übungen
- Umgang mit Widerständen
- Thematische Übungen
- Resümee und Ausblick
- Identitätsentwicklung von Fremdplatzierten
- Biografiearbeit als pädagogisches Instrument
- Kohärenz und Sinnfindung durch Narrationen
- Ästhetisches Handeln als Ressource
- Playback Theater als Methode der biografischen Selbstfindung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit von Janina Mau widmet sich der Erforschung der Eignung des Playback Theaters als Methode in der Biografiearbeit mit fremdplatzierten Jugendlichen. Sie untersucht die Herausforderungen, die diese Zielgruppe bei der Identitätsentwicklung aufgrund ihrer biografischen Erfahrungen und der Trennung von der Herkunftsfamilie erlebt. Die Arbeit zeigt, dass Playback als ein Mittel der Selbsterfahrung und -findung, der emotionalen Verarbeitung und der Ressourcenaktivierung besonders geeignet ist, um den Jugendlichen bei ihrer Identitätsarbeit zu unterstützen.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einordnung des Jugendalters und seinen Entwicklungsaufgaben, insbesondere der Identitätsentwicklung. Sie beleuchtet die spezifischen Herausforderungen, denen fremdplatzierte Jugendliche gegenüberstehen, und analysiert die Konfusion und die Verarbeitung negativer Gefühle, die durch die Trennung von der Herkunftsfamilie und die Integration in eine neue Familie entstehen. Anschließend werden verschiedene Konzepte von Identität und die Bedeutung der Biografiearbeit für die Identitätsfindung vorgestellt.
Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Analyse des Playback Theaters als Methode der Biografiearbeit. Die Arbeit untersucht die besonderen Eigenschaften des Playback, die es für die Zielgruppe geeignet machen, und beleuchtet die heilende Wirkung von erzählten Geschichten, die Rolle der ästhetischen Prozesse in der Selbstfindung und die Bedeutung der Gemeinschaftlichkeit für die Stabilisierung der Identität. Abschließend werden didaktische Überlegungen zur praktischen Anwendung des Playback in der Biografiearbeit mit fremdplatzierten Jugendlichen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen wie Identitätsentwicklung, Fremdplatzierung, Biografiearbeit, Narrationen, ästhetisches Handeln, Playback Theater, Ressourcenaktivierung, Kohärenz, Trauma und Gemeinschaftlichkeit. Sie verdeutlicht die Bedeutung von emotionalen Erfahrungen, kreativen Methoden und dem Austausch in der Gruppe für die Förderung der Selbstfindung und die Bewältigung von biografischen Herausforderungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Playback Theater?
Eine interaktive Theaterform nach Jonathan Fox, bei der persönliche Geschichten aus dem Publikum spontan von Schauspielern auf der Bühne verkörpert werden.
Warum eignet sich Playback Theater für fremdplatzierte Jugendliche?
Es hilft bei der Identitätsentwicklung, indem es ermöglicht, eigene Erlebnisse (z.B. Trennung von der Familie) aus neuen Blickwinkeln zu sehen und emotional zu verarbeiten.
Was ist "Biografiearbeit" in der Sozialarbeit?
Eine Methode zur Aufarbeitung der eigenen Lebensgeschichte, um Kohärenz, Selbstwertgefühl und Ressourcen für die Zukunft zu finden.
Welche heilenden Erfahrungen bietet Playback Theater?
Dazu gehören das Gefühl von Gemeinschaftlichkeit, die Wertschätzung der eigenen Geschichte und die Stärkung der Selbstwirksamkeit.
Welche Herausforderungen haben fremdplatzierte Jugendliche?
Sie erleben oft Identitätskonfusion, Traumata und negative Gefühle durch den Verlust des familiären Umfelds, was die Adoleszenz erschwert.
- Quote paper
- Janina Mau (Author), 2011, Playback Theater im Zentrum der Biografiearbeit mit fremdplatzierten Jugendlichen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229525