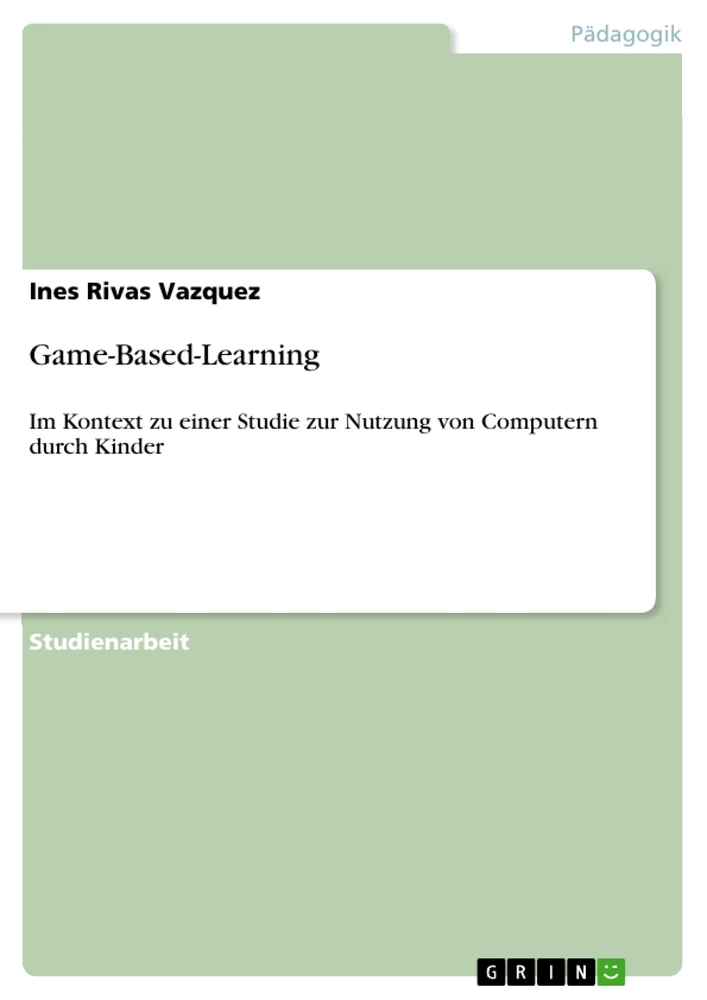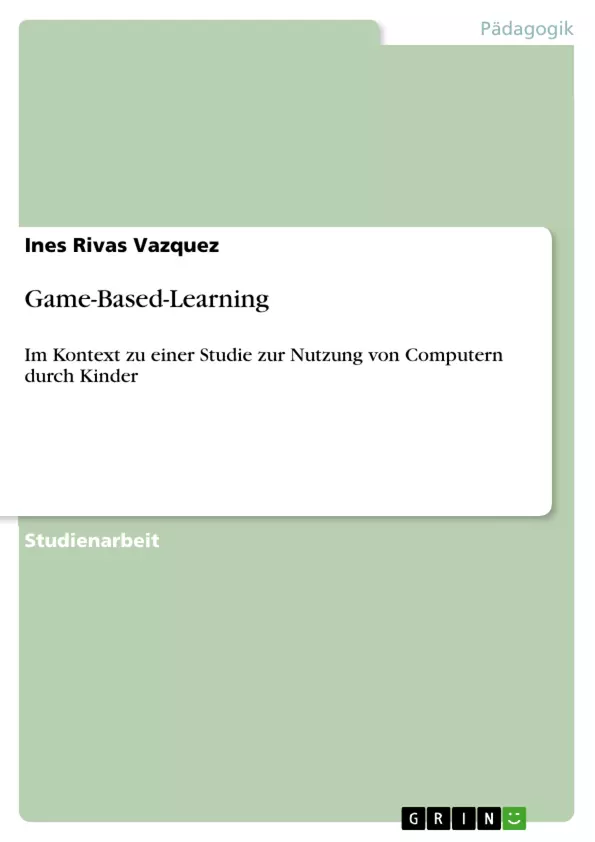Im Alltagswissen wird häufig davon ausgegangen, dass Kinder sich vor allem zu Hause am meisten mit dem Computer bzw. im Besonderen mit Computerspielen beschäftigen würden.
Nun haben mittlerweile seit einigen Jahren auch vermehrt Computer ihren Weg in die Schulen und Klassenzimmer gefunden. Dabei stellt sich nun die Frage, was Kinder in der Schule am Computer lernen können und ob dies negative oder positive Konsequenzen beim Lernen mit sich bringt. Hierbei gibt es zwei entgegengesetzte Positionen, zum einen wird das Lernen am Computer als das Lernen aus zweiter Hand bezeichnet, welches in der Schule eingeschränkt werden müsste und zum Anderen wird dagegen das Lernen am Computer befürwortet, weil die Kinder neben Lesen, Schreiben und Rechnen, noch lernen wie man mit einem Computer umgeht und sich so moderne Methodenkompetenzen erschließen (vgl. DEHN, o.S.).
Heutzutage wird das Lernen am Computer sogar neben der Schule auch schon in Kindertagesstätten eingesetzt, wenngleich dies auch eher in sehr zurückhaltender Weise geschieht.
Wenn man im allgemeinen Sinne, den Begriff der technisch vermittelten Lehr- und Lernprozesse sehr breit fassen würde, so könnte man feststellen dass schon im klassischen Altertum gewisse Techniken zum Lernen benutzt wurden, um Wissen zu erwerben. Der Wissenserwerb durch verschiedene Techniken ist also keine Erfindung unserer Zeit, sondern hat seinen Ursprung schon mindestens in der Antike (vgl. VOGEL, S. 17).
Doch wie effektiv ist das Lernen durch Lernspiele am Computer und wird es von unserer heutigen Gesellschaft überhaupt anerkannt, oder würden Eltern lieber den klassischen Unterricht für ihr Kind bevorzugen? Diese Fragen sind die Leitfragen der vorliegenden Hausarbeit.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Die Anfänge der medialen Nutzung im Zusammenhang mit Kindern und Computerspielen zu Lernzwecken
3. Einsatz von Computerspielen in der Schule
4. Studie: Kinder und der Umgang mit Computern
5. Schlusswort
Anhang: Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was können Kinder in der Schule am Computer lernen?
Neben fachlichen Inhalten durch Lernspiele erwerben Kinder moderne Methodenkompetenzen und lernen den grundlegenden Umgang mit digitaler Technik.
Gibt es negative Konsequenzen beim Lernen am Computer?
Kritiker bezeichnen es als „Lernen aus zweiter Hand“ und befürchten eine Einschränkung direkter Erfahrungen, während Befürworter die Medienkompetenz betonen.
Seit wann werden Medien zu Lernzwecken eingesetzt?
Technisch vermittelte Lehr- und Lernprozesse sind keine Erfindung der Neuzeit; bereits in der Antike wurden verschiedene Techniken zum Wissenserwerb genutzt.
Wie effektiv sind Lernspiele am Computer wirklich?
Die Hausarbeit untersucht die Wirksamkeit dieser Spiele im Vergleich zu klassischem Unterricht und wie die spielerische Komponente den Lernerfolg beeinflusst.
Akzeptieren Eltern das Lernen mit Computern in der Schule?
Dies ist eine Leitfrage der Arbeit, die untersucht, ob die Gesellschaft moderne Lernmethoden anerkennt oder den klassischen Frontalunterricht bevorzugt.
- Citation du texte
- Ines Rivas Vazquez (Auteur), 2012, Game-Based-Learning, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229554