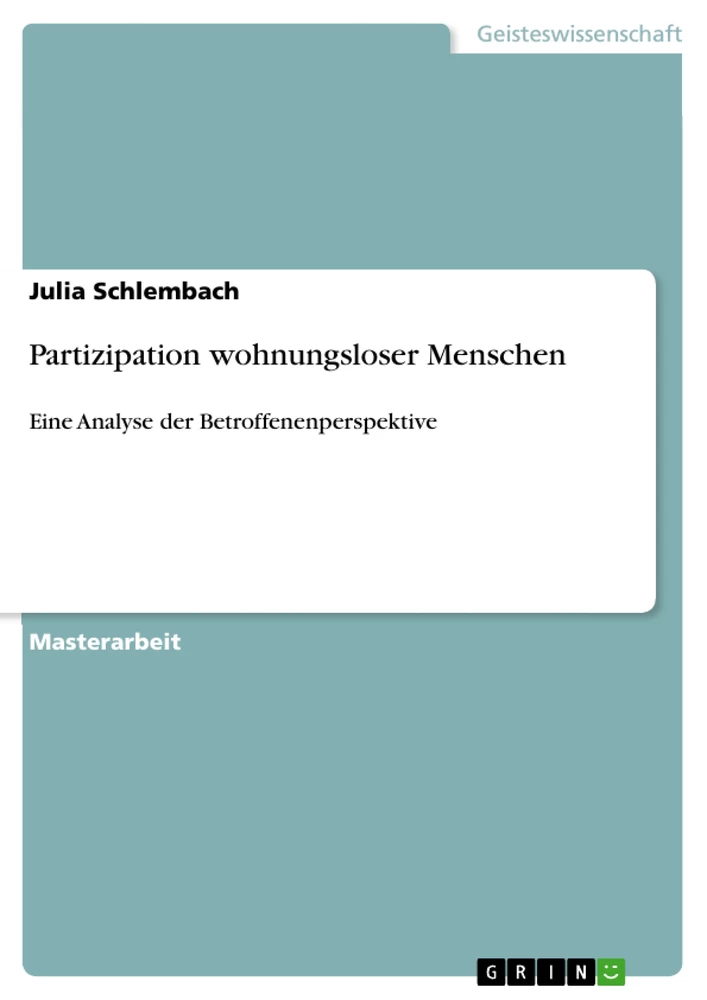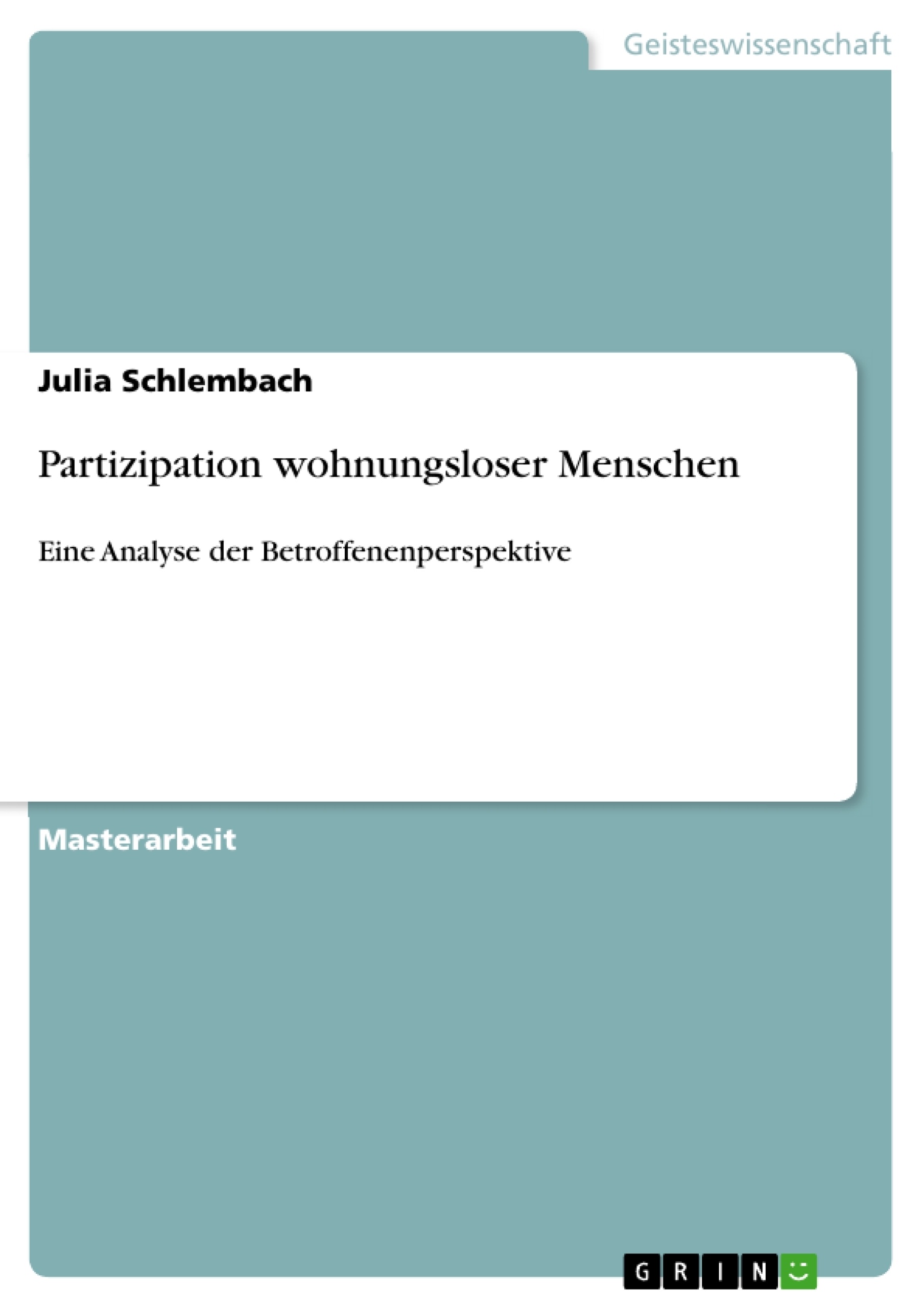Partizipation ist ein großes Schlagwort in der Sozialen Arbeit. Thema dieser qualitativen Untersuchung ist die Partizipation wohnungsloser Menschen, da ich das Gefühl habe,dass v. a. Zielgruppen mit Lobby beteiligt werden. Dabei ist die Adressat_innengruppe der Wohnungsnotfallhilfe gerade durch den Mangel an Teilhabe definiert und es ist somit die Kernaufgabe der Sozialarbeit diese zu fördern und herzustellen. Wie ich ausführlicher in Kapitel II 1.2 beschreiben werde, besteht eine Forschungslücke bezüglich meiner Thematik. Partizipation wird meist in Zusammenhang mit Beteiligungsstrukturen für Kinder
und Jugendliche, Menschen mit Behinderung, alten Menschen oder lediglich im
politischen Bereich thematisiert. Nach intensiver Recherche konnte ich zwar Literatur zur Beteiligung armer, ausgegrenzter und wohnungsloser Menschen finden, jedoch wurde m. E. die Perspektive der wohnungslosen Menschen selbst noch nie erhoben. Ich entschied mich für ein qualitatives Forschungsdesign, da ich die subjektiven Sichtweisen und Wahrnehmungen von wohnungslosen Menschen als Expert_innen ihrer Lebenswelt erheben möchte.
Ziel meiner Arbeit ist es, die Fragen zu beantworten, ob, wie und in welchem Umfang wohnungslose Menschen in welchen Bereichen partizipieren und in welchen Gebieten und auf welche Art und Weise sie das überhaupt möchten.
Meine Arbeit gliedert sich in drei Teile. Nachdem theoretische Vorannahmen erläutert wurden, erörtere ich im Anschluss mein forschungsmethodisches Vorgehen, um danach die empirischen Ergebnisse meiner Untersuchung darzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- I Einführende theoretische Vorannahmen
- I Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit
- 1.1 Konzepte und Ausmaß von Armut
- 1.2 Soziale Ungleichheit und soziale Ausgrenzung
- 1.3 Definition und Fallzahlen von Wohnungslosigkeit
- 2 Das Partizipationskonzept
- 2.1 Allgemeine Grundannahmen
- 2.2 Partizipation und Soziale Arbeit
- 2.3 Partizipation ausgegrenzter, armer und wohnungsloser Menschen
- 2.3.1 Rechtliche Grundlagen für Partizipation wohnungsloser Menschen
- 2.3.2 Partizipation wohnungsloser Menschen
- 2.4 Exkurs: Empowerment
- 3 Theorien Sozialer Arbeit
- 3.1 Lebensweltorientierung nach Thiersch
- 3.2 Lebensbewältigung nach Böhnisch
- 3.3 Lebensgestaltung nach Möller
- I Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit
- II Forschungsmethodisches Vorgehen
- I Forschungsmethodische Grundlagen
- 1.1 Explikation der Fragestellung
- 1.2 Literaturrecherche
- 1.3 Methodologie der Untersuchung
- 1.4 Realisierung von Gütekriterien der qualitativen Sozialforschung
- 1.5 Ethische Reflexion des Forschungsvorhabens
- 2 Erhebung der Daten
- 2.1 Das problemzentrierte Leitfadeninterview
- 2.1.1 Das problemzentrierte Interview nach Witzel
- 2.1.2 Erstellung des Leitfadens
- 2.2 Das Sampling der Untersuchung
- 2.3 Zugang zum Feld
- 2.4 Die Durchführung der Interviews
- 2.1 Das problemzentrierte Leitfadeninterview
- 3 Auswertung der Daten
- 3.1 Transkription der geführten Interviews
- 3.2 Die Grounded Theory
- 3.2.1 Theoretische Grundprinzipien der Grounded Theory
- 3.2.2 Methodische Umsetzung der Grounded Theory
- 3.3 Computergestützte Analyse der Daten
- I Forschungsmethodische Grundlagen
- III Darstellung der empirischen Ergebnisse
- 1 Beschreibung der institutionellen Rahmenbedingungen
- 2 Beschreibung der Interviewpartner_innen und deren Problemlagen
- 3 Beschreibung und Interpretation der Kategorie ,Bewältigung'
- 4 Beschreibung und Interpretation der Schlüsselkategorie ,Partizipation'
- 4.1 Das Phänomen Partizipation
- 4.2 Fördernde und intervenierende Bedingungen
- 4.3 Zusammenfassung der Kernkategorie
- 5 Resümee der empirischen Ergebnisse
- 6 Handlungsstrategien für die Soziale Arbeit
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Partizipation wohnungsloser Menschen. Ziel der qualitativen Untersuchung ist es, die subjektiven Sichtweisen und Wahrnehmungen von wohnungslosen Menschen als Expert_innen ihrer Lebenswelt zu erfassen. Die Arbeit analysiert, ob, wie und in welchem Umfang wohnungslose Menschen in verschiedenen Bereichen partizipieren und in welchen Gebieten und auf welche Art und Weise sie das überhaupt möchten.
- Armut und soziale Ausgrenzung als Kontextfaktoren für Wohnungslosigkeit
- Das Partizipationskonzept und seine Bedeutung in der Sozialen Arbeit
- Rechtliche Grundlagen und Umsetzungsmöglichkeiten von Partizipation für wohnungslose Menschen
- Theorien Sozialer Arbeit und ihre Relevanz für die Lebensbewältigung von wohnungslosen Menschen
- Empirische Analyse von Partizipationserfahrungen und -wünschen wohnungsloser Menschen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Oberkapitel behandelt die Themen Armut, Ausgrenzung und Wohnungslosigkeit sowie das Partizipationskonzept und Theorien Sozialer Arbeit. Es werden verschiedene Armuts- und Ausgrenzungskonzepte erörtert, das Ausmaß von Armut und Wohnungslosigkeit in Deutschland dargestellt und die rechtlichen Grundlagen für Partizipation wohnungsloser Menschen beleuchtet. Darüber hinaus werden Theorien Sozialer Arbeit wie die Lebensweltorientierung, die Lebensbewältigung und die Lebensgestaltung vorgestellt, die Konzepte zur Überwindung problematischer Lebenssituationen beinhalten.
Das zweite Oberkapitel widmet sich dem Forschungsdesign der Arbeit. Es werden die methodischen Grundlagen, die Erhebungsmethode des problemzentrierten Leitfadeninterviews und die Auswertungsmethode der Grounded Theory beschrieben. Außerdem werden die Samplingstrategie, der Feldzugang und die Durchführung der Interviews erläutert. Abschließend werden ethische Aspekte des Forschungsvorhabens reflektiert.
Das dritte Oberkapitel präsentiert die empirischen Ergebnisse der Untersuchung. Es werden die institutionellen Rahmenbedingungen der Wohnungsnotfallhilfe in der Stadt X beschrieben und die Interviewpartner_innen sowie deren Problemlagen vorgestellt. Im Anschluss werden die Kategorien ,Bewältigung' und ,Partizipation' analysiert. Die Ergebnisse der Auswertung werden in Bezug zu den im ersten Kapitel dargestellten Theorien Sozialer Arbeit gesetzt und Handlungsstrategien für die Soziale Arbeit abgeleitet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Partizipation, Wohnungslosigkeit, Armut, soziale Ausgrenzung, Lebensweltorientierung, Lebensbewältigung, Lebensgestaltung, Empowerment, Grounded Theory, qualitative Sozialforschung, Handlungsstrategien und Soziale Arbeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Partizipation für wohnungslose Menschen wichtig?
Wohnungslosigkeit ist oft durch einen Mangel an Teilhabe definiert. Partizipation soll diese Menschen wieder als Experten ihrer eigenen Lebenswelt einbeziehen.
Welches Forschungsdesign wurde für diese Masterarbeit gewählt?
Es wurde ein qualitatives Forschungsdesign mit problemzentrierten Leitfadeninterviews und der Auswertung nach der Grounded Theory gewählt.
Was sind die zentralen Theorien der Sozialen Arbeit in diesem Kontext?
Die Arbeit bezieht sich auf die Lebensweltorientierung nach Thiersch, die Lebensbewältigung nach Böhnisch und die Lebensgestaltung nach Möller.
Was ist das Ziel der Untersuchung?
Ziel ist es herauszufinden, in welchen Bereichen wohnungslose Menschen partizipieren möchten und wie die Soziale Arbeit sie dabei unterstützen kann.
Welche Rolle spielt Empowerment?
Empowerment zielt darauf ab, die Selbstbestimmung und Handlungsfähigkeit ausgegrenzter Menschen zu stärken, damit sie ihre Interessen selbst vertreten können.
- Quote paper
- Julia Schlembach (Author), 2012, Partizipation wohnungsloser Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229662