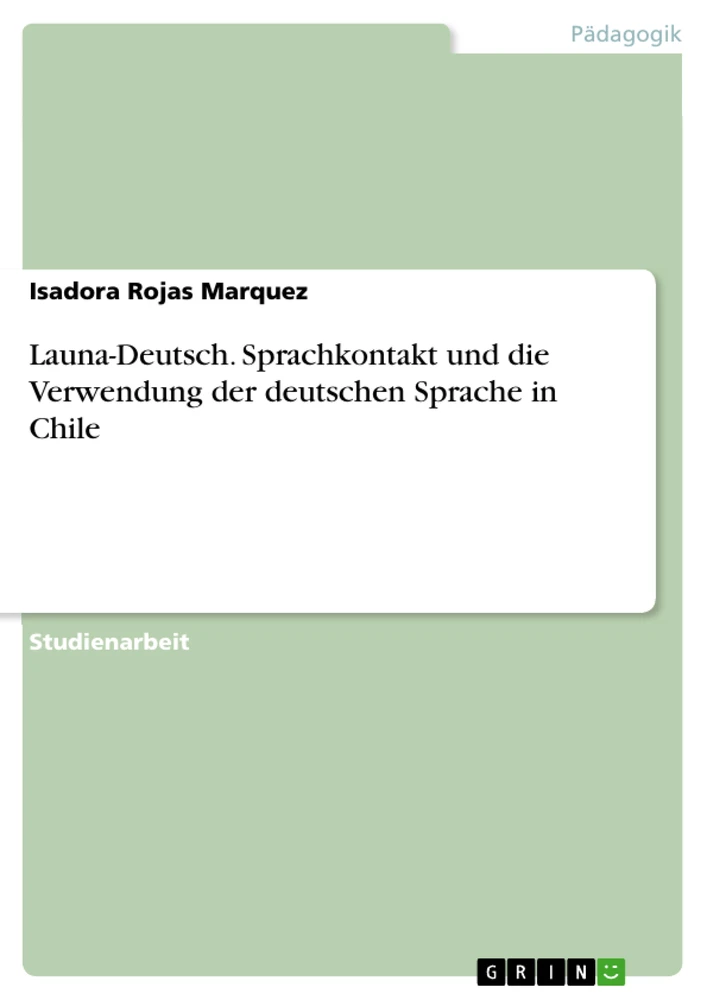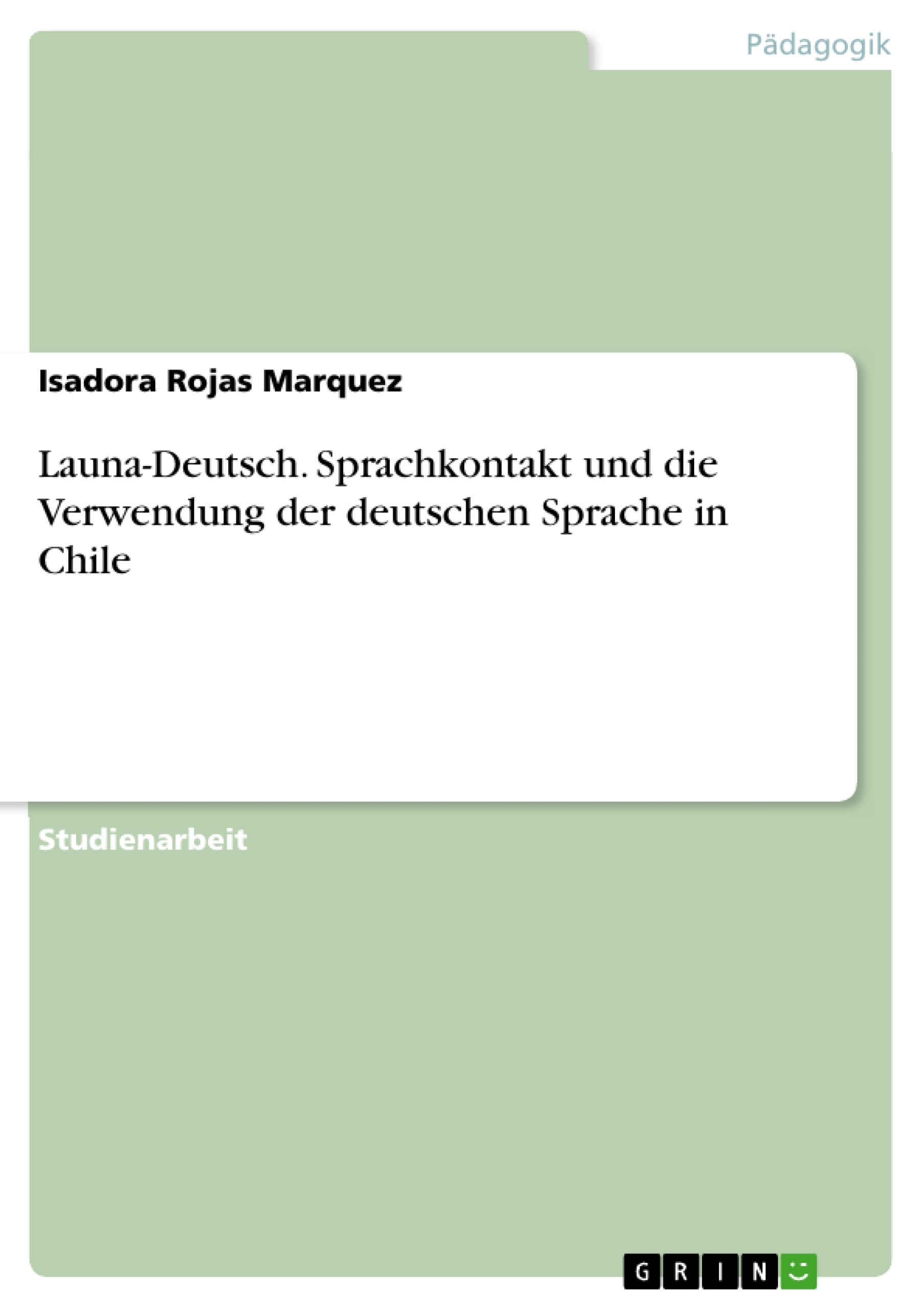Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Geschichte und Verwendung der deutschen Sprache und mit der Entstehung der sogenannten Sprachvarietät des „Launa – Deutschs“ in Chile.
Im 19. Jahrhundert fand eine der wichtigsten europäischen Auswanderungen nach Lateinamerika statt. Diese Auswanderung war vielleicht die größte Umsiedlungsbewegung in der Geschichte und sie stellte einen entscheidenden Faktor für die Stabilisierung vieler europäischer Nationen in der Welt dar. Eine historische Bedeutung hatte vor allem die deutsche Migration nach Chile. Ihr Beitrag zur inländischen Wirtschaft Chiles sowie ihr kulturelles Erbe waren von grundlegender Bedeutung für die chilenische Gesellschaft. Besonders im Süden Chiles wirkten die Deutschen maßgeblich an der wirtschaftlichen Erschließung, sowie auch im Erziehungswesen und in der Kultur mit.
Die Integration und die Beschäftigung der Einwanderer in der chilenischen Wirtschaft erwirkten auch Konsequenzen in der deutschen Sprache dieser Immigranten. Diese Arbeit konzentriert sich auf die Situation und Entwicklung der deutschen Sprache vom 19. Jahrhundert bis heute und auf die Folgen und Auswirkungen aufgrund des Kontakts mit der spanischen Sprache besonders in Süd-Chile. Als Resultat dieses Sprachkontakts vermutet man die Entstehung des „Launa-Deutschs“. Deswegen wird in dieser Hausarbeit das „Launa-Deutsch“ beschrieben und analysiert.
Zuerst soll auf die Grundlagen des Sprachkontakts, Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit und auf die Auswirkungen des Sprachkontakts eingegangen werden. Innerhalb dieser Auswirkungen sind wichtige Begriffe wie Diglossie, Sprachwechsel, Sprachinsel, Sprachverlust, u.a. zu erklären. Im Anschluss wird die deutsche Migration nach Chile, ihre Integration und die Entwicklung ihrer Sprache behandelt. Es soll aus soziolinguistischer Perspektive erklärt werden, wie die deutschen Einwanderer sich in der chilenischen Gesellschaft integriert und entwickelt haben und inwiefern all diese Aspekte die deutsche Sprache beeinflussten, wie das „Launa-Deutsch“ entstand und schließlich beschreiben wie die Sprachsituation der deutschen Sprache in Chile heutzutage ist.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Sprachkontakt
- 1.1. Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit
- 1.1.1. Erwerb der Zweisprachigkeit
- 1.2. Auswirkungen des Sprachkontaktes
- 1.2.1. Sprachwahl
- 1.2.2. Codewechsel
- 1.2.3. Interferenz
- 1.2.4. Sprachwechsel und Sprachverlust
- 1.2.5. Sprachloyalität und Sprachinsel
- 1.2.6. Diglossie
- 1.1. Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit
- 2. Deutsche Migration in Lateinamerika
- 2.1. Die große Auswanderung aus Europa
- 2.1.1. Motive für die Auswanderung
- 2.1. Die große Auswanderung aus Europa
- 3. Die deutsche Migration nach Chile
- 3.1. Allgemeine Information über Chile
- 3.2. Die geförderte Einwanderung
- 3.3. Entwicklung der Deutschen in Chile
- 3.4. Die Deutschen in Chile heute
- 3.4.1. Aktuelle Situation
- 3.4.2. Integration und Sprache
- 3.4.3. Die Entwicklung der deutschen Sprache in Südchile
- 3.4.4. Das „Launa-Deutsch“
- 3.4.5. Die deutsche Sprache in Chile heute
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschichte und Entwicklung der deutschen Sprache in Chile, insbesondere die Entstehung der Sprachvarietät „Launa-Deutsch“. Sie analysiert den Einfluss der deutschen Migration auf die chilenische Gesellschaft und beleuchtet die soziolinguistischen Prozesse, die zur Herausbildung des „Launa-Deutsch“ führten. Die Arbeit betrachtet die Auswirkungen des Sprachkontakts zwischen Deutsch und Spanisch auf die Sprachentwicklung und -verwendung.
- Sprachkontakt und seine Auswirkungen auf die deutsche Sprache in Chile
- Die Geschichte der deutschen Migration nach Chile und ihre Integration
- Die Entstehung und Merkmale des „Launa-Deutsch“
- Soziolinguistische Aspekte der Sprachentwicklung und -verwendung
- Der Einfluss des Sprachkontakts auf Sprachwandel und Sprachvariation
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein und beschreibt die Zielsetzung, den Fokus auf die Geschichte und Verwendung der deutschen Sprache in Chile und die Entstehung des „Launa-Deutschs“. Sie skizziert den historischen Kontext der deutschen Migration nach Lateinamerika und ihre Bedeutung für Chile, insbesondere im Süden des Landes. Die Arbeit konzentriert sich auf die soziolinguistische Perspektive der Integration der deutschen Einwanderer und die Auswirkungen des Sprachkontakts mit Spanisch auf die deutsche Sprache, insbesondere die Entstehung des „Launa-Deutschs“. Es wird ein Überblick über die behandelten Kapitel gegeben, wobei die Analyse des Sprachkontakts, der Mehrsprachigkeit und die Entwicklung der deutschen Sprache in Chile im Mittelpunkt stehen.
1. Sprachkontakt: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse des Sprachkontakts zwischen Deutsch und Spanisch in Chile. Es definiert den Begriff „Sprachkontakt“ und unterscheidet verschiedene Perspektiven auf die wechselseitige Beeinflussung von Sprachen. Es wird der Zusammenhang zwischen Sprachkontakt und Mehrsprachigkeit hergestellt und verschiedene Formen des Spracherwerbs in Mehrsprachigkeitssituationen erläutert. Das Kapitel dient als methodische Grundlage für die spätere Analyse der konkreten Sprachkontaktsituation in Chile.
2. Deutsche Migration in Lateinamerika: Dieses Kapitel behandelt die große europäische Auswanderungswelle nach Lateinamerika im 19. Jahrhundert, mit besonderem Fokus auf die Motive der Auswanderer und die Bedeutung dieses Ereignisses für die europäische und lateinamerikanische Geschichte. Es bildet den historischen Rahmen für die nachfolgende Untersuchung der deutschen Migration nach Chile und ihrer Auswirkungen auf die dortige Sprachlandschaft.
3. Die deutsche Migration nach Chile: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die deutsche Migration nach Chile, deren Geschichte und deren Einfluss auf die chilenische Gesellschaft. Es beschreibt die Entwicklung der deutschen Gemeinschaft in Chile, ihre Integration in die chilenische Wirtschaft und Kultur, und beleuchtet die soziolinguistischen Konsequenzen der Migration, die zur Entwicklung verschiedener Varietäten der deutschen Sprache führten, darunter das „Launa-Deutsch“. Es werden verschiedene Aspekte der Integration der deutschen Einwanderer beleuchtet, um die Entwicklung der deutschen Sprache in Chile zu verstehen.
Schlüsselwörter
Sprachkontakt, Mehrsprachigkeit, Deutsche Migration, Chile, „Launa-Deutsch“, Soziolinguistik, Sprachwandel, Sprachvariation, Sprachinsel, Code-Switching, Integration.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Deutsche Sprache in Chile und das "Launa-Deutsch"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Geschichte und Entwicklung der deutschen Sprache in Chile, insbesondere die Entstehung der Sprachvarietät „Launa-Deutsch“. Sie analysiert den Einfluss der deutschen Migration auf die chilenische Gesellschaft und beleuchtet die soziolinguistischen Prozesse, die zur Herausbildung des „Launa-Deutsch“ führten. Die Arbeit betrachtet die Auswirkungen des Sprachkontakts zwischen Deutsch und Spanisch auf die Sprachentwicklung und -verwendung.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themenschwerpunkte: Sprachkontakt und dessen Auswirkungen auf die deutsche Sprache in Chile; die Geschichte der deutschen Migration nach Chile und deren Integration; die Entstehung und Merkmale des „Launa-Deutsch“; soziolinguistische Aspekte der Sprachentwicklung und -verwendung; und der Einfluss des Sprachkontakts auf Sprachwandel und Sprachvariation.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: Kapitel 0 (Einleitung): Einführung in das Thema, Zielsetzung und Überblick über die Arbeit. Kapitel 1 (Sprachkontakt): Theoretische Grundlagen zum Sprachkontakt, Mehrsprachigkeit und Spracherwerb. Kapitel 2 (Deutsche Migration in Lateinamerika): Die große europäische Auswanderungswelle nach Lateinamerika im 19. Jahrhundert. Kapitel 3 (Die deutsche Migration nach Chile): Fokus auf die deutsche Migration nach Chile, deren Geschichte, Integration und soziolinguistische Konsequenzen, inklusive der Entstehung des „Launa-Deutsch“.
Was ist "Launa-Deutsch"?
„Launa-Deutsch“ ist eine spezifische Sprachvarietät des Deutschen, die sich in Chile, insbesondere im Süden des Landes, entwickelt hat. Die Arbeit untersucht ihre Entstehung und Merkmale im Detail.
Welche Rolle spielt der Sprachkontakt zwischen Deutsch und Spanisch?
Der Sprachkontakt zwischen Deutsch und Spanisch spielt eine zentrale Rolle in der Entstehung und Entwicklung des „Launa-Deutsch“. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen dieses Sprachkontakts auf die Sprachentwicklung und -verwendung.
Welche soziolinguistischen Aspekte werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene soziolinguistische Aspekte, wie z.B. die Integration der deutschen Einwanderer, die Sprachwahl, Code-Switching, Interferenz, Sprachwechsel und Sprachverlust, Sprachloyalität, Sprachinseln und Diglossie, um die Entwicklung der deutschen Sprache in Chile zu verstehen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Sprachkontakt, Mehrsprachigkeit, Deutsche Migration, Chile, „Launa-Deutsch“, Soziolinguistik, Sprachwandel, Sprachvariation, Sprachinsel, Code-Switching, Integration.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und richtet sich an Personen, die sich für die Geschichte der deutschen Sprache in Chile, Soziolinguistik, Sprachkontakt und Migration interessieren.
- Citar trabajo
- Diplom Übersetzerin Isadora Rojas Marquez (Autor), 2011, Launa-Deutsch. Sprachkontakt und die Verwendung der deutschen Sprache in Chile, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229693