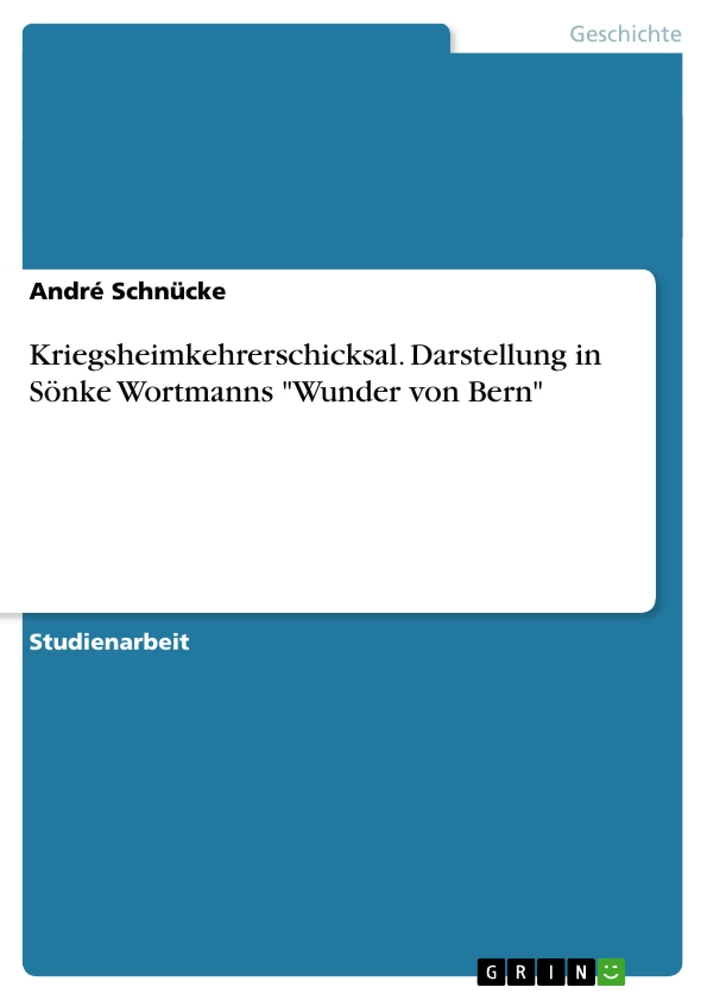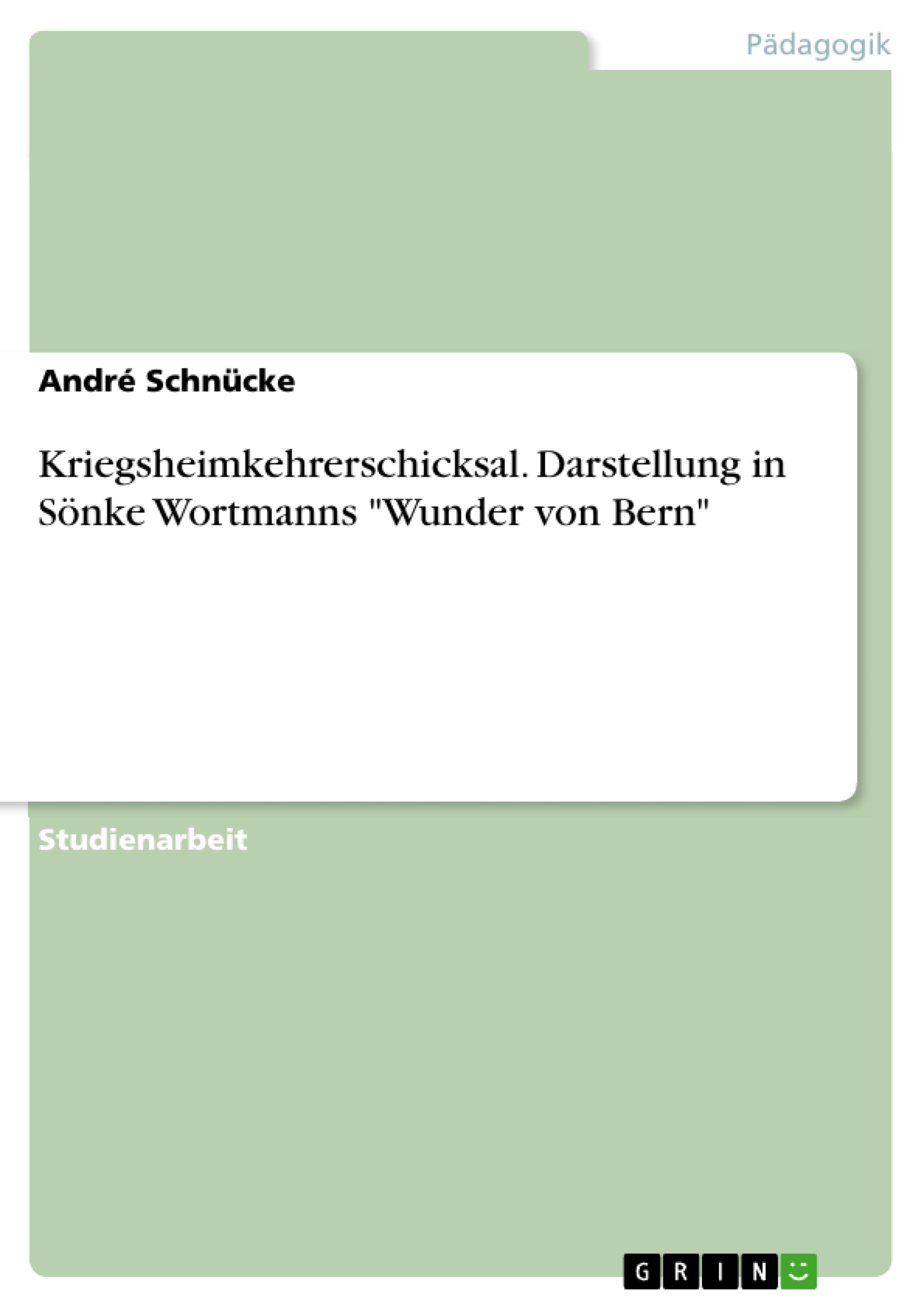Besonders bei für das kommerzielle Kino produzierten historischen Spiel-filmen ist davon auszugehen, dass der inhaltlichen wie ästhetischen Gestaltung die Orientierung am Zuschauer, der Ausformung der Geschichtsbilder eine Antizipation der Vorstellungen des erwarteten Publikums zugrunde liegt. Kommerzielle Spielfilme sind im Rahmen der kontemporären Geschichtskultur folglich nicht allein als Produzenten, sondern ebenso als Produkte von Geschichtsbildern und Geschichtsbewusstsein zu betrachten. Dies kann als Ausgangspunkt einer Filmanalyse angesehen werden, die weniger nach der historischen Korrektheit der vermittelten Geschichtsbilder fragt, sondern vielmehr diese in ihrer Ausgestaltung zu analysieren und auf ihre Quellen hin zu hinterfragen bemüht ist. Wird Sönke Wortmanns Wunder von Bern offenkundig als Abbild der Nachkriegsgeschichte begriffen, wie Forderungen nach der Einbindung des Filmes in den Schulunterricht suggerieren, so scheint es angebracht zu sein, nach der Ausgestaltung der Geschichtsbilder im Film zu fragen. Diese Annäherung muss notgedrungen aufgrund des vorgegebenen Rahmens einer Hauptseminararbeit aspektorientiert erfolgen. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit der Darstellung des Kriegsheimkehrerschicksals, die entworfene Geschichte der Heimkehr der fiktiven Figur Richard Lubansky. Dabei wird versucht aufzuzeigen, dass sich Wortmann im Wunder von Bern Bildern, Vorstellungen und Denkmustern bedient, die im Diskurs um die Spätheimkehrer im Westdeutschland der frühen fünfziger Jahren entwickelt worden sind. Dabei ist bemerkenswert, dass für die Auseinandersetzung mit dem Kriegsheimkehrerschicksal in der Öffentlichkeit sozial-psychologische und erinnerungspolitische Faktoren mitbestimmend waren, die das Bild des Kriegsheimkehrers auch in der Folge determinierten. Das Schicksal der Spätheimkehrer wurde mit Bedeutungen aufgeladen, die das sich auf diese beziehende populäre Geschichtsbild bis in unsere Tage prägt. Dies bezeugt, so die These, die Darstellung des Kriegsheimkehrerschicksals in Wortmanns Wunder von Bern.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Viktimisierungsdiskurs und Spätheimkehrer
- Friedland in Essen-Katernberg
- Der Kriegsheimkehrer als Dystrophiker
- Schuld und Sühneleistung
- Die Rolle der Frau bei der Wiedereingliederung des Heimkehrers
- Schlussbetrachtung
- Quellen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Darstellung des Kriegsheimkehrerschicksals im Film „Das Wunder von Bern“ von Sönke Wortmann. Sie untersucht, inwiefern die Darstellung des Heimkehrers Richard Lubansky von den populären Geschichtsbildern der frühen Bundesrepublik beeinflusst ist und welche Auswirkungen diese auf die Rezeption des Films haben.
- Viktimisierungsdiskurs und die Konstruktion der deutschen Opferrolle
- Die Darstellung der Spätheimkehrer als Opfer zweier totalitärer Systeme
- Die Rolle des Dystrophiediskurses in der Darstellung der psychischen Belastung der Heimkehrer
- Die Ambivalenz von Schuld und Sühne in der Darstellung des Kriegsheimkehrerschicksals
- Die Rolle der Frau in der Wiederherstellung der Familienverhältnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und beleuchtet die Rezeption des Films „Das Wunder von Bern“ im Kontext der deutschen Nachkriegsgeschichte. Sie stellt die Frage nach der Bedeutung filmischer Geschichtsbilder und deren Einfluss auf die historische Vorstellungskraft.
Kapitel 2 analysiert den Viktimisierungsdiskurs der frühen Bundesrepublik und zeigt auf, wie die deutsche Gesellschaft sich als Opfergemeinschaft konstituierte. Die Erfahrungen von Vertreibung und Kriegsgefangenschaft wurden dabei in den Vordergrund gestellt, während die Frage nach individueller und kollektiver Schuld an den Verbrechen des Nationalsozialismus ausgeklammert wurde.
Kapitel 3 beleuchtet die Bedeutung des Lagers Friedland für die mediale Inszenierung der Heimkehr der deutschen Kriegsgefangenen. Die Bilder aus Friedland prägten die populäre Vorstellung von Gefangenschaft und Heimkehr und wurden von Sönke Wortmann in seiner Darstellung des Heimkehrers Richard Lubansky aufgegriffen.
Kapitel 4 widmet sich dem Krankheitsbild der Dystrophie, welches in der Nachkriegszeit zur Beschreibung der psychischen Probleme der Kriegsheimkehrer verwendet wurde. Die Dystrophiediagnose beförderte den Viktimisierungsdiskurs, indem sie den Heimkehrenden eine wissenschaftlich fundierte Opferrolle zuordnete.
Kapitel 5 untersucht die Ambivalenz von Schuld und Sühne in der Darstellung des Kriegsheimkehrerschicksals. Die Hinweise auf die deutschen Gräueltaten an der Ostfront werden in der Gesamtkonzeption des Films marginal gehalten und dienen eher der Konstruktion einer völkerübergreifenden Opfergemeinschaft.
Kapitel 6 analysiert die Rolle der Frau in der Wiedereingliederung des Heimkehrers. Die Frau wird in der Darstellung des Films als Expertin für die emotionale Bindung im familiären Kontext dargestellt, die dem Heimkehrer Orientierung und Unterstützung bietet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Viktimisierungsdiskurs, die deutsche Nachkriegsgeschichte, die Spätheimkehrer, die Kriegsgefangenschaft, das Lager Friedland, die Dystrophie, Schuld und Sühne, die Rolle der Frau, die Familie und der Film „Das Wunder von Bern“. Die Arbeit beleuchtet die Konstruktion von Geschichtsbildern im Film und ihre Bedeutung für die nationale Identität. Sie zeigt auf, wie die Darstellung des Kriegsheimkehrerschicksals von den populären Geschichtsbildern der frühen Bundesrepublik geprägt ist und welche Auswirkungen diese auf die Rezeption des Films haben.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Schicksal der Kriegsheimkehrer im Film "Das Wunder von Bern" dargestellt?
Der Film nutzt die fiktive Figur Richard Lubansky, um die psychischen Belastungen und die schwierige Wiedereingliederung der Spätheimkehrer in die westdeutsche Gesellschaft der 1950er Jahre zu zeigen.
Was bedeutet der Begriff "Viktimisierungsdiskurs" in diesem Kontext?
Er beschreibt die Tendenz der deutschen Nachkriegsgesellschaft, sich primär als Opfer von Krieg, Vertreibung und Gefangenschaft zu sehen, während die eigene Schuld oft ausgeblendet wurde.
Welche Rolle spielt das Lager Friedland im Film?
Das Lager Friedland dient als symbolischer Ort der Heimkehr und prägte durch mediale Bilder die populäre Vorstellung von der Ankunft der Kriegsgefangenen.
Was versteht man unter dem "Dystrophiediskurs"?
Dystrophie war ein medizinisches Krankheitsbild, das zur Beschreibung der körperlichen und psychischen Auszehrung der Heimkehrer genutzt wurde und deren Opferrolle wissenschaftlich untermauerte.
Welche Rolle wird der Frau bei der Heimkehr des Mannes zugeschrieben?
Die Frau wird im Film als emotionale Stütze und Expertin für die Wiederherstellung der familiären Bindungen dargestellt, die dem traumatisierten Heimkehrer bei der Orientierung hilft.
- Citation du texte
- André Schnücke (Auteur), 2010, Kriegsheimkehrerschicksal. Darstellung in Sönke Wortmanns "Wunder von Bern", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/229765