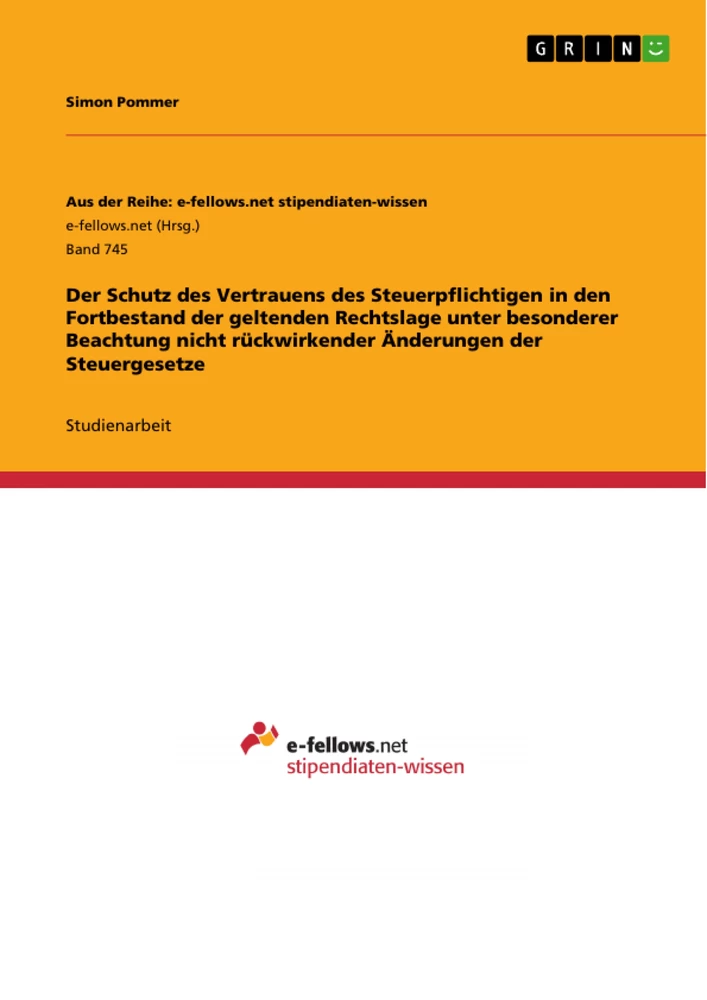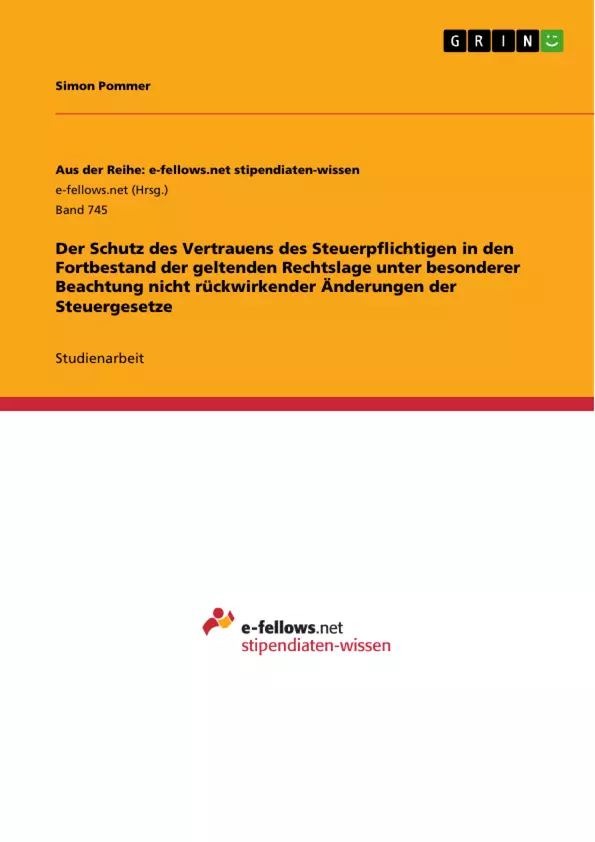Die Arbeit befasst sich mit dem Bestehen von Vertrauensschutz des Steuerpflichtigen in Deutschland gegenüber Änderungen der geltenden Steuergesetze. Dazu werden zunächst die Rechtsgrundlagen des (steuerrechtlichen) Vertrauensschutzes herausgearbeitet, bevor sodann die Reichweite dieses Schutzes dargestellt wird. Besonderer Augenmerk wurde dabei auf die Auswirkungen von 3 Urteilen des Bundesverfassungsgerichts aus dem Juli 2010 gelegt, die den Vertrauensschutz (im Steuerrecht, aber auch allgemein) in Fällen unechter Rückwirkung erheblich ausgeweitet haben.
Gliederung
A. Einleitung
B. Herleitung des Vertrauensschutzes
I. Herleitung aus dem nationalen Recht
1. Herleitung aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 III GG)
2. Herleitung aus den Grundrechten
3. Herleitung aus dem Grundsatz von Treu & Glauben (§ 242 BGB)
II. Herleitung aus dem Unionsrecht
C. Voraussetzungen des Vertrauensschutzes
I. Das Steuergesetz als Vertrauensgrundlage
1. Auswirkungen der Verfassungswidrigkeit von Steuernormen
2. Auswirkungen von unklaren Steuernormen
3. Beschränkung des Vertrauensschutzes auf spezielle Normengruppen
II. Das Vertrauen auf den Fortbestand der Rechtslage
III. Die Vertrauensbetätigung
IV. Schutzwürdigkeit des Vertrauens
D. Grenzen des Vertrauensschutzes bei Änderungen von Steuergesetzen
I. Auswirkungen von Änderungen des nationalen Steuerrechts
1. Genereller Umfang des Vertrauensschutzes
2. Vertrauensschutz bei Änderungen von Steuergesetzen mit rückwirkender Geltung
(echte Rückwirkung)
3. Vertrauensschutz bei Änderungen von Steuergesetzen mit zukünftiger Geltung ..
a) Änderungskompetenz des Gesetzgebers
b) Die unechte Rückwirkung
aa) Vereinbarkeit mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 III GG)
(1) Vereinbarkeit mit dem Vorbehalt des Gesetzes
(2) Vereinbarkeit mit dem Vertrauensschutzprinzip
(3) Vereinbarkeit mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip
(a) Abwägungsbelange zugunsten des Steuerpflichtigen
(aa) Befristete Steuerrechtsnormen
(bb) Regelungszweck der Norm
(cc) Bestand von Grundprinzipien
(dd) Unmöglichkeit der Änderung von Dispositionen
(b) Abwägungsbelange zugunsten des Gesetzgebers
(aa) Beseitigung einer unklaren oder verfassungswidrigen Gesetzeslage
(bb) Beseitigung systemfremder Ausnahmeregelungen
(cc) Finanzbedarf des Staates
(4) Ergebnis zur Vereinbarkeit mit dem Rechtsstaatsprinzip
bb) Vereinbarkeit mit den Grundrechten
(1) Vereinbarkeit mit der Eigentumsfreiheit (Art. 14 I GG)
(2) Vereinbarkeit mit der Berufsfreiheit (Art. 12 I GG)
(3) Vereinbarkeit mit der allg. Handlungsfreiheit (Art. 2 I GG)
(4) Vereinbarkeit mit dem allg. Gleichheitsgebot (Art. 3 I GG)
(a) Vereinbarkeit mit dem Gebot der Folgerichtigkeit
(b) Vereinbarkeit mit dem Leistungsfähigkeitsprinzip
(5) Ergebnis zur Vereinbarkeit mit den Grundrechten
c) Entwertung konkret gefestigter Vermögenspositionen
aa) Vorliegen einer konkret gefestigten Vermögensposition
bb) Vereinbarkeit mit dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 III GG)
cc) Vereinbarkeit mit den Grundrechten
(1) Vereinbarkeit mit der Eigentumsfreiheit (Art. 14 I GG) 23
(2) Vereinbarkeit mit der Berufsfreiheit (Art. 12 I GG) 24
(3) Vereinbarkeit mit der allg. Handlungsfreiheit (Art. 2 I GG) 24
(4) Vereinbarkeit mit dem allg. Gleichheitsgebot (Art. 3 I GG)
(5) Ergebnis zur Vereinbarkeit mit den Grundrechten
d) Bewertung der neuen BVerfG-Rechtsprechung
e) Sonderfall der periodisch erhobenen Steuern
II. Auswirkungen von Änderungen des Unionsrechts
1. Änderungskompetenz der Unionsorgane
2. Vertrauensschutz bei Änderungen von Steuergesetzen mit rückwirkender Geltung (echte Rückwirkung)
3. Vertrauensschutz bei Änderungen von Steuergesetzen mit zukünftiger Geltung
III. Vertrauensschutz durch Übergangsregelungen
E. Fazit
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Vertrauensschutz im Steuerrecht?
Vertrauensschutz bedeutet, dass Bürger darauf vertrauen dürfen, dass der Gesetzgeber Gesetze nicht willkürlich rückwirkend zu ihrem Nachteil ändert, wenn sie bereits Dispositionen im Vertrauen auf die geltende Rechtslage getroffen haben.
Was ist der Unterschied zwischen echter und unechter Rückwirkung?
Eine echte Rückwirkung liegt vor, wenn ein Gesetz nachträglich in bereits abgeschlossene Sachverhalte eingreift (meist unzulässig). Eine unechte Rückwirkung betrifft laufende Sachverhalte, die für die Zukunft neu geregelt werden (oft zulässig).
Wie leitet sich der Vertrauensschutz rechtlich her?
Er ergibt sich primär aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG), den Grundrechten und dem Grundsatz von Treu und Glauben.
Welche Bedeutung hatten die BVerfG-Urteile von 2010?
Das Bundesverfassungsgericht hat in diesen Urteilen den Schutz des Steuerpflichtigen bei Fällen unechter Rückwirkung gestärkt und die Anforderungen an den Gesetzgeber bei Gesetzesänderungen erhöht.
Gibt es Grenzen für den Vertrauensschutz?
Ja, der Vertrauensschutz endet dort, wo überragende Belange des Gemeinwohls oder die Beseitigung einer unklaren/verfassungswidrigen Rechtslage die Änderung rechtfertigen.
- Quote paper
- Simon Pommer (Author), 2012, Der Schutz des Vertrauens des Steuerpflichtigen in den Fortbestand der geltenden Rechtslage unter besonderer Beachtung nicht rückwirkender Änderungen der Steuergesetze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230232