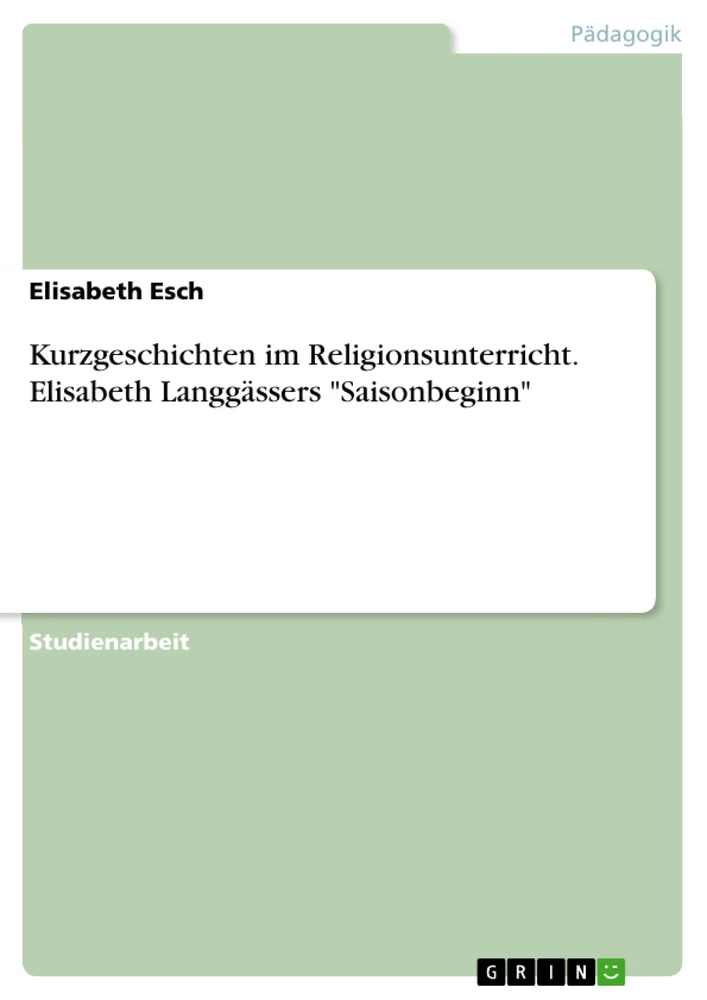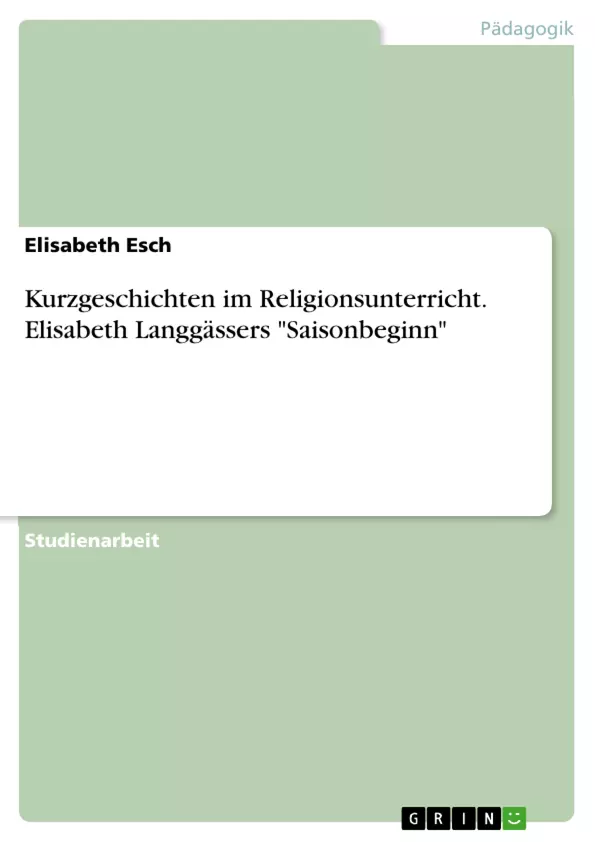Warum sollten literarische Texte im Religionsunterricht besprochen werden, wenn sie gar nicht von Theologen verfasst worden sind und augenscheinlich keine religiöse Intention verfolgen? Verfällt die Religionslehre dabei nicht zu sehr in die Arbeitsweise des Deutschunterrichts? Können literarische Werke überhaupt etwas Göttliches enthalten? Mit diesen und weiteren Fragen wird sich die vorliegende Ausarbeitung beschäftigen. Es wird beleuchtet, inwieweit Kurzgeschichten im Religionsunterricht geeignet scheinen.
Damit diese Auseinandersetzung gelingen kann, muss zuerst geklärt werden, was eine Kurzgeschichte ist und welche Merkmale diese Gattung auszeichnen. Im Anschluss daran werden die Chancen und Grenzen vom Einsatz der Kurzgeschichten im Religionsunterricht gegenübergestellt. Anhand eines Beispiels werden diese Überlegungen weiter vertieft. Dabei wird Elisabeth Langgässers Saisonbeginn zunächst gegliedert, woraufhin die religiösen Symbole und Metaphern analysiert werden, um aufzuzeigen, inwieweit die literarische Arbeit der Autorin mit der theologischen vergleichbar ist. Anschließend wird auf die Biographie der Autorin eingegangen, die erklärt, warum sich in ihren Werken biblische Züge finden lassen. Zum Schluss wird ein denkbarer Unterrichtsentwurf aufgezeigt. Anhand der didaktischen Impulse wird theoretisch die Relevanz von Saisonbeginn im Unterricht begründet und die Ziele und Absichten dieser Stunde werden genannt, die mit dem Kernlehrplan für Nordrhein Westfalen vereinbar sind. Zusätzlich werden Methoden aufgezeigt, durch die Schülerinnen und Schüler adäquat die Kurzgeschichte Saisonbeginn ergründen können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kurzgeschichten im Religionsunterricht
- Merkmale von Kurzgeschichten
- Chancen und Grenzen des Einsatzes von Kurzgeschichten im Religionsunterricht
- Saisonbeginn von Elisabeth Langgässer
- Inhalt und Gliederung der Kurzgeschichte Saisonbeginn
- Religiöse Symbole in Saisonbeginn und deren theologische Bedeutung
- Einbeziehung der Biographie von Elisabeth Langgässer
- Unterrichtsentwurf zu Saisonbeginn für eine achte Klasse eines Gymnasiums
- Didaktische Impulse
- Methodische Impulse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung untersucht die Eignung von Kurzgeschichten im Religionsunterricht. Sie beleuchtet die Merkmale dieser Gattung, analysiert die Chancen und Grenzen ihres Einsatzes und untersucht anhand von Elisabeth Langgässers Saisonbeginn, wie literarische Texte mit theologischen Inhalten in Verbindung gebracht werden können.
- Die Merkmale von Kurzgeschichten und ihre Eignung für den Religionsunterricht
- Die Analyse religiöser Symbole in Literatur
- Die Verbindung von literarischen Texten mit theologischen Inhalten
- Die Entwicklung eines Unterrichtsentwurfs für eine achte Klasse
- Die Bedeutung von Kurzgeschichten im Religionsunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Einleitung und der Problematik des Einsatzes literarischer Texte im Religionsunterricht. Kapitel zwei definiert die Gattung Kurzgeschichte und beleuchtet ihre Merkmale sowie die Chancen und Grenzen ihrer Anwendung im Religionsunterricht. In Kapitel drei wird Elisabeth Langgässers Kurzgeschichte Saisonbeginn analysiert. Es werden sowohl die Inhalte und die Struktur des Textes als auch die darin verwendeten religiösen Symbole und ihre Bedeutung im Kontext der Geschichte untersucht. Zudem wird die Biographie von Elisabeth Langgässer in Bezug auf ihre literarische Arbeit betrachtet. Kapitel vier präsentiert einen möglichen Unterrichtsentwurf zu Saisonbeginn für eine achte Klasse eines Gymnasiums und beinhaltet didaktische und methodische Impulse. Im Fazit wird die Eignung von Kurzgeschichten für den Religionsunterricht zusammengefasst und die Relevanz von Elisabeth Langgässers Saisonbeginn für den Unterricht hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Kurzgeschichte, Religionsunterricht, Elisabeth Langgässer, Saisonbeginn, religiöse Symbole, theologische Bedeutung, Unterrichtsentwurf, Didaktik, Methodik, Doppelmoral, Antisemitismus, Judendiskriminierung, christliche Werte, Nächstenliebe, Kreuzigung Jesu Christi
Häufig gestellte Fragen
Warum werden Kurzgeschichten im Religionsunterricht eingesetzt?
Kurzgeschichten ermöglichen es, existenzielle menschliche Fragen und religiöse Symbole anhand literarischer Beispiele zu diskutieren, auch wenn sie keine explizit theologische Intention verfolgen.
Worum geht es in Elisabeth Langgässers „Saisonbeginn“?
Die Kurzgeschichte thematisiert Antisemitismus und Judendiskriminierung in einem Dorf, wobei religiöse Metaphern (z. B. die Kreuzigung) eine zentrale Rolle spielen.
Welche religiösen Symbole finden sich in der Geschichte?
Die Arbeit analysiert Symbole und Metaphern, die Parallelen zwischen dem Leiden der Diskriminierten und der biblischen Passionsgeschichte ziehen.
Wie beeinflusst die Biographie der Autorin ihr Werk?
Aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen und ihres Hintergrunds finden sich in Elisabeth Langgässers Werken häufig tiefgreifende biblische Züge und theologische Fragestellungen.
Für welche Klassenstufe ist der vorgeschlagene Unterrichtsentwurf?
Der Entwurf ist für eine achte Klasse eines Gymnasiums konzipiert und orientiert sich am Kernlehrplan für Nordrhein-Westfalen.
- Citation du texte
- Elisabeth Esch (Auteur), 2013, Kurzgeschichten im Religionsunterricht. Elisabeth Langgässers "Saisonbeginn", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230867