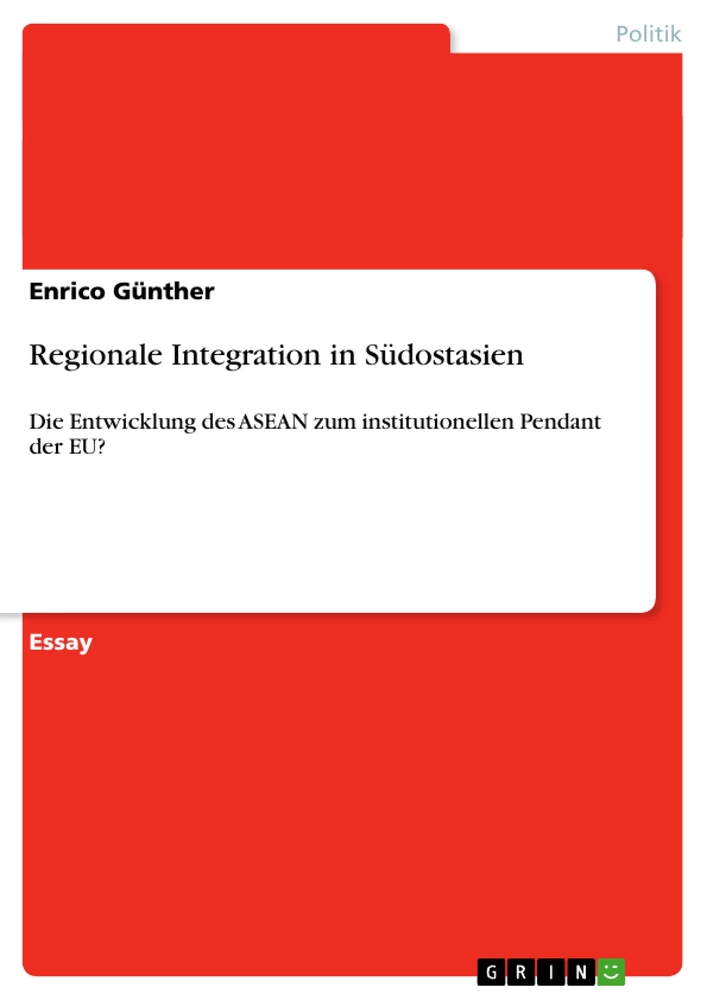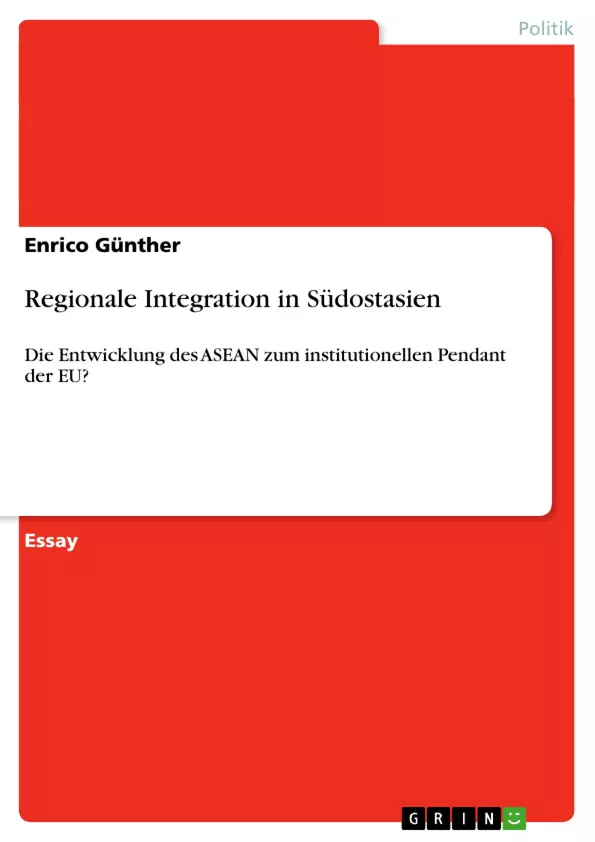Aus der eigenen Erfahrung heraus versucht die Europäische Union (EU) seit dem Ende des Kalten Krieges in ihren Außenbeziehungen, regionale Zusammenarbeit und Integrati-on zu fördern (vgl. Börzel/ Risse 2009: 10). In Europa wird zwischenstaatliche Kooperation in einer geographischen Region als Katalysator für Stabilität, Sicherheit und ökonomisches Wachstum betrachtet. Im Rahmen der Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik versucht die EU, regionale Kooperation zu unterstützen, um ihre direkte Nachbarschaft zu stabilisieren und zu befrieden (vgl. ebd.: 16ff.). Auch in ihren weiterreichenden Außenbeziehungen motiviert die Union regionale Kooperationen zu schaffen bzw. bestehende Verbindungen auszu-bauen und zu vertiefen. Diese Tendenzen lassen sich subsumieren unter dem Ansatz ‚new regionalism‘, der Regionen als widerstandsfähig gegenüber globalen Herausforderungen beschreibt und deren Entstehung, Reaktivierung oder Vertiefung in den letzten zwanzig Jah-ren beobachtet (vgl. Telò 2007: 4).
Das interessanteste Pendant zur EU in Asien ist der Verband südostasiatischer Nationen (ASEAN – Association of Southeast Asian Nations), der bereits 1967 gegründet wurde. Aus welchen Gründen kam es in den 1960er-Jahren zu einer regionalen Zusammenarbeit im südostasiatischen Raum? Ziel dieses Essays ist einerseits, die Motivlage der Entwicklung des ASEAN zu beschreiben, auch vor dem Hintergrund der Theorie regionaler Sicherheitskomplexe. Andererseits soll nach der ASEAN-Charta neue institutionelle Design vergleichend mit dem der EU betrachtet werden.
Regionale Integration in Südostasien: Die Entwicklung des ASEAN zum institutionellen Pendant der EU?
Einleitung
Aus der eigenen Erfahrung heraus versucht die Europäische Union (EU) seit dem Ende des Kalten Krieges in ihren Außenbeziehungen, regionale Zusammenarbeit und Integration zu fördern (vgl. Börzel/ Risse 2009: 10). In Europa wird zwischenstaatliche Kooperation in einer geographischen Region als Katalysator für Stabilität, Sicherheit und ökonomisches Wachstum betrachtet. Im Rahmen der Erweiterungs- und Nachbarschaftspolitik versucht die EU, regionale Kooperation zu unterstützen, um ihre direkte Nachbarschaft zu stabilisieren und zu befrieden (vgl. ebd.: 16ff.). Auch in ihren weiterreichenden Außenbeziehungen motiviert die Union regionale Kooperationen zu schaffen bzw. bestehende Verbindungen auszubauen und zu vertiefen. Diese Tendenzen lassen sich subsumieren unter dem Ansatz ‚new regionalism‘, der Regionen als widerstandsfähig gegenüber globalen Herausforderungen beschreibt und deren Entstehung, Reaktivierung oder Vertiefung in den letzten zwanzig Jahren beobachtet (vgl. Telò 2007: 4).
Das interessanteste Pendant zur EU in Asien ist der Verband südostasiatischer Nationen (ASEAN – Association of Southeast Asian Nations), der bereits 1967 gegründet wurde. Aus welchen Gründen kam es in den 1960er-Jahren zu einer regionalen Zusammenarbeit im südostasiatischen Raum? Ziel dieses Essays ist einerseits, die Motivlage der Entwicklung des ASEAN zu beschreiben, auch vor dem Hintergrund der Theorie regionaler Sicherheitskomplexe. Andererseits soll nach der ASEAN-Charta neue institutionelle Design vergleichend mit dem der EU betrachtet werden.
Motive für die regionale Zusammenarbeit in Südostasien
Laut Best und Christiansen (2011: 431) können drei Motivgruppen die Dynamiken der Regionalisierung erklären. Zum Einen sei dies das Unabhängigkeitsmanagement: in historischer Perspektive hätten vormals kolonialisierte Staaten mit Regionalverbänden ihre neue Unabhängigkeit gestützt, indem sie so die Beziehungen untereinander, zu den Kolonialmächten und zu anderen Machtblöcken regeln und einhegen konnten. Nach dem Abzug der Kolonialmächte aus Südostasien in den 1940er- und 1950er-Jahren kann man mehrere Versuche der politischen Eliten beobachten, eine Form der Zusammenarbeit zu etablieren, die dann im August 1967 in der Gründung des ASEAN (Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und die Philippinen waren die Gründungsstaaten) gipfelten (vgl. Ufen 2004: 89). In dieser ersten Phase des westlich orientierten ASEAN war das Motiv der Abwehr kommunistischer Bewegungen während des Vietnamkrieges sowie aus Laos und Kambodscha besonders bedeutend für die Mitgliedsstaaten. Hinzu kommt, dass intraregionale Spannungen befriedet werden sollten, auch um (erneute) externe Interventionen zu vermeiden (vgl. Best/ Christiansen 2011: 436). Es handelte sich also „um ein lockeres Bündnis zur sicherheitspolitischen Stabilisierung in der Region“ (Ufen 2004: 89).
Damit kann man bei der Entwicklung des ASEAN auch Elemente aus dem zweiten Motivbündel für regionale Zusammenarbeit erkennen, das nach Best und Christiansen (2011: 431) im Interdependenzmanagement besteht: Staaten geben sich Mechanismen, Regeln und Normen, um Frieden und Sicherheit zu garantieren oder transnationale wirtschaftliche und soziale Interaktionen zu ermöglichen. So legte sich der ASEAN 1976 mit dem Treaty of Amity and Cooperation auf eine friedliche Konfliktbeilegung sowie Gewaltverzicht fest und stellte die Koordinierung von nationalen Politiken in Aussicht. Die Intention dabei war nach wie vor die Eindämmung der perzipierten kommunistischen Bedrohung aus Vietnam, Kambodscha, Laos sowie mittelbar aus der Sowjetunion und China (vgl. Ufen 2004: 90). Die Kooperation im ASEAN während des Kalten Krieges war vorwiegend sicherheitspolitisch, auch wenn Formen der ökonomischen Zusammenarbeit vorgesehen waren (vgl. Best/ Christiansen 2011: 436). Nach dem Ende des Kalten Krieges steckte der ASEAN in der Krise und sah seine Bedeutung schwinden (vgl. Ufen 2004: 90). Auf dem Gipfeltreffen des ASEAN in Singapur 1992 wurde allerdings der economic turn der Regionalorganisation eingeleitet, indem perspektivisch die Schaffung einer ASEAN Freihandelszone (AFTA) beschlossen wurde – getrieben von der Aufwertung neuer regionaler Mächte wie Indien, China und Japan sowie der Etablierung westlicher Handelsblöcke wie EU und NAFTA (vgl. ebd.: 90). Gleichzeitig büßte der ASEAN in sicherheitspolitischen Fragen kaum an Bedeutung ein, da er an neuen Dialogforen im asiatisch-pazifischen und europäisch-asiatischen Raum mitwirkte (vgl. ebd.: 90). Es folgten die Aufnahmen von Vietnam, Kambodscha, Laos und Myanmar. Ende der 1990er-Jahre allerdings verlor die Region wegen politischer Krisen, Naturkatastrophen und der Asien-Wirtschaftskrise an Bedeutung und Einfluss. Im Jahr 2003 einigte sich der ASEAN auf die Schaffung einer Security Community, die allerdings „kaum neue Impulse“ enthielten. Die bis 2020 zu verwirklichende Economic Community mit einem gemeinsamen Markt inklusive Dienstleistungs-, Waren- und Kapitalfreiheit seien dahingegen „wesentlich konkreter“ (vgl. ebd.: 91).
Im dritten Charakteristikum nach Best und Christiansen (2011: 431f.) geht es um die Beziehungen zwischen Regionalorganisationen und dem Rest der Welt und insbesondere um die Frage, inwiefern solche Kooperation hinderlich oder förderlich für den Multilateralismus sind. Im ASEAN+3 arbeitet der Verband mit China, Japan und Südkorea zusammen, was seine Ausrichtung auf eine gesamtostasiatische Kooperation verdeutlicht (vgl. Ufen 2004: 91). Auch über eine Kooperation im Rahmen von ASEAN+6 (Indien, Australien und Neuseeland) wird seit 2002 vorrangig in Japan nachgedacht. Mit den USA gibt es seit 2009 Kooperationsformen im Rahmen von ASEAN-USA Gipfeltreffen (vgl. Best/ Christiansen 2011: 437). Natürlich sind dies nur Indizien für eine multilaterale Orientierung des ASEAN – eine umfassendere Analyse der interregionalen Beziehungen des ASEAN und seines Verhaltens in internationalen Organisationen wie der Welthandelsorganisation kann im Rahmen dieser Darstellung nicht erfolgen.
Die Entwicklungen des ASEAN lassen sich anhand der drei Dynamiken Unabhängigkeits- und Interdependenzmanagement sowie interregionale und multilaterale Außenbeziehungen nachvollziehen. Gegründet als Garant für Frieden und Stabilität zwischen der westlich orientierten Vertragsstaaten und als gemeinsames Plädoyer gegen kommunistische Bewegungen hat die sicherheitspolitische Komponente des ASEAN nach dem Ende des Kalten Krieges zum Teil an Bedeutung verloren. Mit der ASEAN 2020 Strategie versucht der ASEAN jedoch, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verstärken und wirtschaftliche Interdependenzen zu institutionalisieren. Bevor die institutionelle Struktur des ASEAN und deren Anleihen bei der EU betrachtet werden, soll im Folgenden gezeigt werden, dass die südostasiatischen Staaten einen regionalen Sicherheitskomplex bzw. Subkomplex konstituieren, was als eine ergänzende bzw. zum Teil überschneidende Erklärung für die Bildung des ASEAN gesehen werden kann.
Südostasien als regionaler Sicherheitskomplex
Buzan und Wæver (2003: 6-26) argumentieren, dass sowohl neorealistische als auch globalistische Theorien den internationalen Beziehungen, insbesondere nach dem Ende des Kalten Krieges, nicht gerecht werden, da diese Ansätze immer nur „one dominant story to impose on the whole international system“ (ebd.: 26) suchen würden. Dies sei eine zu kurzsichtige Strategie, da es „distinct stories at several levels with none holding the master key to a full interpretation“ (ebd.: 26) gebe. Die Autoren sprechen von einer „1+4+regions“-Struktur des internationalen Systems nach dem Ende des Kalten Krieges bestehend aus der Supermacht USA, den Großmächten Russland, China, Japan und der EU sowie mehreren regionalen Sicherheitskomplexen (vgl. ebd.: 27-39). Ihre „regional security complex theory (RSCT)“ (ebd.: 40) verstehen Buzan und Wæver nicht als konkurrierend, sondern als komplementär zu und interoperabel mit den meisten klassischen realistischen oder liberalen Theorien der Internationalen Beziehungen. Dieser Ansatz betrachtet historische Kontinuitäten verschiedener Regionen und bezieht Freundschaft und Feindschaft sowie akteurszentrierte Interpretationen innerhalb einer Region als konstruktivistische Elemente mit ein. Regionale Sicherheitskomplexe schafften somit eine Substruktur des internationalen Systems (vgl. ebd.: 40). Staaten fürchteten ihre Nachbarn und verbündeten sich daher mit anderen Staaten in ihrer Region, zwischen zwei regionalen Sicherheitskomplexen gebe es kaum Interaktionen, aber zum Teil isolierende Staaten („insulator“ (ebd.: 41)), die wie beispielweise die Türkei die schwierige Aufgabe haben, die Implikationen beider Regionen auszuhalten. Daher sei die Region die Ebene, in der die Sicherheitspolitiken der Staaten die größten Auswirkungen haben und interdependent miteinander verbunden sind (vgl. ebd.: 43). Regionale Sicherheitskomplexe werden als „a set of units whose major processes of securitisation, desecuritisation, or both are so interlinked that their security problems cannot reasonably be analyzed or resolved apart from another“ (ebd.: 44) definiert, die anhaltende Muster von Freundschaft und Feindschaft aufweisen und sich in subglobalen, geographisch kohärenten Strukturen von Sicherheitsinterdependenz manifestieren.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was ist die ASEAN und wann wurde sie gegründet?
Die ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) wurde 1967 von Thailand, Malaysia, Singapur, Indonesien und den Philippinen gegründet.
Was waren die Hauptmotive für die Gründung der ASEAN?
Zu den Motiven gehörten das Unabhängigkeitsmanagement nach der Kolonialzeit, die Abwehr kommunistischer Bewegungen und die Befriedung intraregionaler Spannungen.
Was versteht man unter der „Regional Security Complex Theory“ (RSCT)?
Die RSCT besagt, dass Sicherheitsinteressen von Staaten in einer Region so eng miteinander verknüpft sind, dass sie nicht isoliert voneinander gelöst werden können.
Wie unterscheidet sich die ASEAN von der EU?
Während die EU eine tiefe politische und wirtschaftliche Integration anstrebt, war die ASEAN lange ein lockeres Bündnis zur sicherheitspolitischen Stabilisierung, das sich erst später ökonomisch vertiefte.
Was ist die „ASEAN 2020 Strategie“?
Diese Strategie zielt auf die Schaffung einer Wirtschaftsgemeinschaft mit einem gemeinsamen Markt sowie einer Sicherheitsgemeinschaft ab.
- Citation du texte
- Enrico Günther (Auteur), 2013, Regionale Integration in Südostasien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/230878