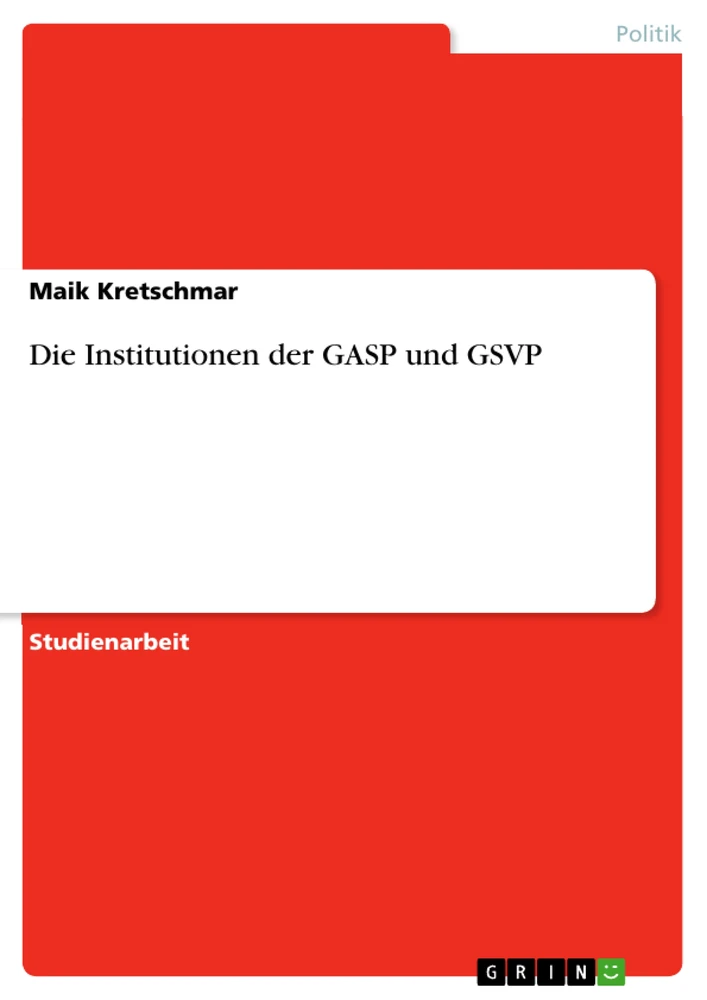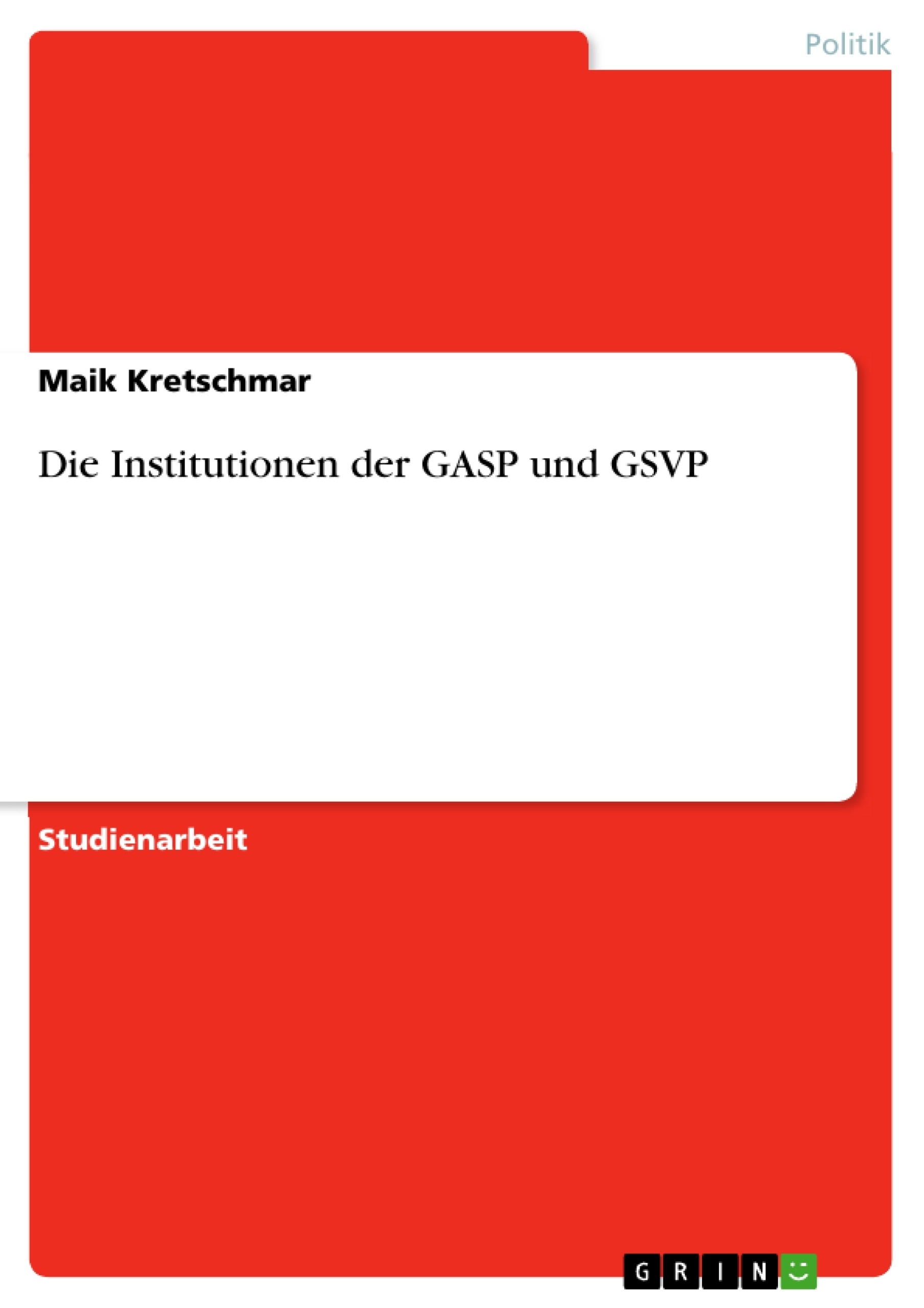Auch 2013 ist die „Krise“ der vergangenen Jahre noch immer allgegenwärtig. Doch bleiben in der medialen Berichterstattung dabei einige Bereiche der aktuellen Situation in ihrer Beachtung durchaus deutlich hinter anderen zurück. So dürften inzwischen kaum jemandem die finanzielle Notlage der europäischen Krisenstaaten, die wirtschaftliche Schwäche der „Südländer“ oder der steigende Schuldenstand der USA, nebst den daraus resultierenden politischen Kontroversen, unbekannt sein.
Doch wie steht es eigentlich um ein Kernprojekt der Europäischen Union – der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik? Was ist im vierten Jahr nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon aus diesem Projekt mit historischer Dimension – galt doch jeher insbesondere die Sicherheitspolitik als quasi unantastbarer Souveränitätsbereich - geworden? Spricht Europa hier mit einer Stimme? Und wie sind die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union (GASP) beziehungsweise ihr Krisenreaktionszweig, die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) institutionell organisiert?
Angesichts einer großen Anzahl von Konflikten, aktuell etwa in Syrien oder Mali, in denen sich zumindest Teile der EU auch militärisch engagieren , werden jene Fragen in naher Zukunft wohl eine deutlich größere Rolle spielen.
Mit ihnen wird sich daher vorliegende Arbeit, die sich vor allem auf einen Seminarbeitrag im Hauptseminar „Vertragliche Grundlagen, Institutionen und Struktur der Union“ aus dem Wintersemester 2012/2013 an der TU Chemnitz stützt, beschäftigen.
Sie stellt dabei trotz der Vielzahl an Publikationen zur Europäischen Union durchaus ein Forschungsdesiderat dar, da sich mit diesem Politikfeld in jüngster Zeit vergleichsweise wenige Arbeiten intensiv auseinandergesetzt haben und auch bestehende Lehrbücher, wie etwa das Standardwerk „Europarecht“ von Matthias Herdegen aus dem Jahr 2012 dieser Materie nur wenige Seiten widmen.
Die nachfolgende Arbeit wird sich dazu eingangs mit dem verwendeten Institutionen-Begriff auseinandersetzen sowie kurz die vertraglichen Grundlagen und Instrumente der GASP/GSVP beleuchten.
Anschließend wird Sie die Institutionen der GASP im Einzelnen darlegen, vom Europäischen Rat bis hin zur EU-Kommission.
Im dritten Teil der Arbeit erfolgt dann eine Auseinandersetzung mit den spezifischen Institutionen der GSVP, die nicht bereits im vorangegangen Abschnitt beschrieben wurden.
Am Ende der Arbeit stehen ein Fazit der Zusammenarbeit...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Institutionsbegriff.
- Vertragliche Grundlagen der GASP/GSVP.
- GASP
- GSVP.
- Die Institutionen im Rahmen der GASP
- Europäischer Rat
- Ministerrat
- Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik..
- Ausschuss der Ständigen Vertreter..
- Politisches und Sicherheitspolitisches Komitee.
- Sonderbeauftragte......
- EU-Parlament
- EU-Kommission
- Institutionen der GSVP
- Dem EAD zugehörige Institutionen
- Crisis Management and Planning Directorate.
- Civilian Planning and Conduct Capability.
- EU Militärstab
- EU-Lagezentrum
- dem PSK angegliederte Institutionen
- Politisch-Militärische-Gruppe.
- Arbeitsgruppe Außenbeziehungen
- Ausschüsse
- Militärausschuss
- Ausschuss für zivile Aspekte des Krisenmanagements..
- Agenturen
- Europäische Verteidigungsagentur.
- Satellitenzentrum.
- Institut für Sicherheitsstudien...
- Sonstige Institutionen der GSVP.
- Strategieplanungs- und Frühwarneinheit......
- Operationszentren...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Institutionen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und ihrer Krisenreaktionszweig, der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP). Ziel ist es, die institutionelle Organisation dieser Politikfelder zu analysieren und die Rolle der einzelnen Institutionen zu beleuchten. Dabei wird die Arbeit den vertraglichen Grundlagen der GASP/GSVP sowie die spezifischen Institutionen der GSVP im Detail darlegen.
- Institutionelle Organisation der GASP/GSVP
- Vertragliche Grundlagen der GASP/GSVP
- Rolle der einzelnen Institutionen
- Spezifische Institutionen der GSVP
- Zusammenarbeit im Rahmen der GASP/GSVP
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Arbeit in den Kontext der aktuellen politischen und medialen Diskussionen. Sie erläutert die Bedeutung des Forschungsdesiderats und stellt die Struktur der Arbeit vor. Im ersten Kapitel wird der Institutionsbegriff geklärt und die vertraglichen Grundlagen der GASP/GSVP beleuchtet. Das zweite Kapitel widmet sich den einzelnen Institutionen der GASP, beginnend mit dem Europäischen Rat und endend mit der EU-Kommission. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den spezifischen Institutionen der GSVP, die nicht bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben wurden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den wichtigsten Institutionen der GASP und GSVP, den vertraglichen Grundlagen dieser Politikfelder sowie der Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Akteuren. Zentral sind dabei die Analyse des Institutionsbegriffs, die Darstellung der verschiedenen Institutionen der GASP und GSVP, die Bedeutung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik sowie die Herausforderungen der gemeinsamen Verteidigungspolitik. Weitere wichtige Begriffe sind: Europäischer Rat, Ministerrat, Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, EU-Parlament, EU-Kommission, Europäische Verteidigungsagentur, Strategieplanungs- und Frühwarneinheit, Operationszentren, Crisis Management and Planning Directorate, Civilian Planning and Conduct Capability, EU Militärstab, EU-Lagezentrum, Politisch-Militärische-Gruppe, Arbeitsgruppe Außenbeziehungen, Militärausschuss, Ausschuss für zivile Aspekte des Krisenmanagements.
Häufig gestellte Fragen
Was sind GASP und GSVP?
GASP steht für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Die GSVP (Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik) ist deren operativer Krisenreaktionszweig.
Welche Rolle spielt der Hohe Vertreter der Union?
Der Hohe Vertreter leitet die GASP, führt den Vorsitz im Rat für Auswärtige Angelegenheiten und ist zugleich Vizepräsident der EU-Kommission, um Kohärenz im außenpolitischen Handeln zu gewährleisten.
Was ist das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK)?
Das PSK beobachtet die internationale Lage, trägt zur Definition von Politiken bei und übt die politische Kontrolle und strategische Leitung von Krisenbewältigungseinsätzen aus.
Welche Institutionen gehören speziell zur GSVP?
Dazu zählen unter anderem der EU-Militärstab (EUMS), das Satellitenzentrum der EU, die Europäische Verteidigungsagentur (EVA) sowie verschiedene Planungsstäbe wie das CPCC.
Was änderte der Vertrag von Lissabon für die Sicherheitspolitik?
Der Vertrag wertete die GASP/GSVP institutionell auf, schuf das Amt des Hohen Vertreters und den Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD), um die EU als globalen Akteur zu stärken.
- Citation du texte
- Maik Kretschmar (Auteur), 2013, Die Institutionen der GASP und GSVP, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231163