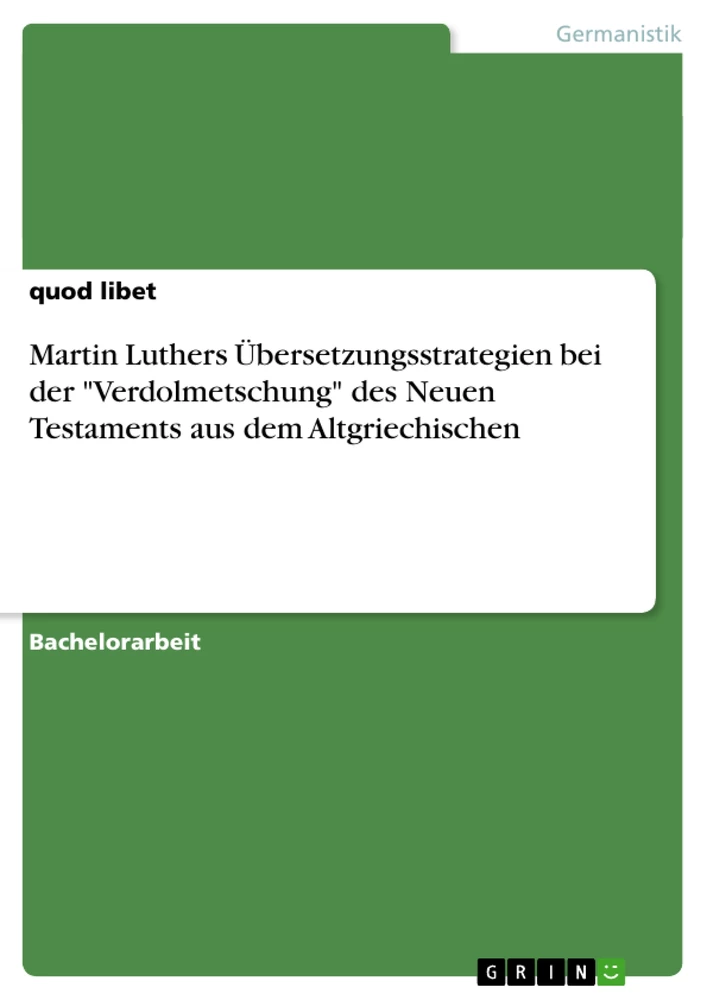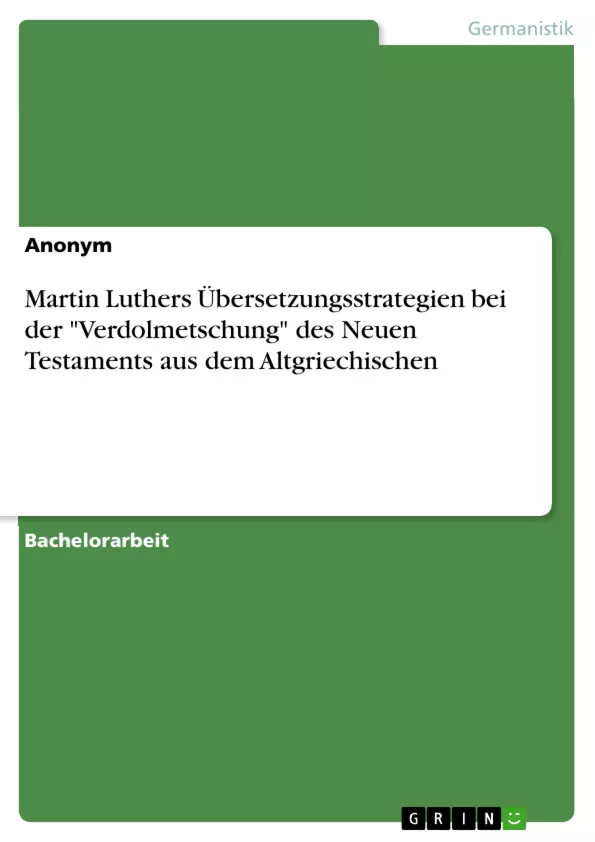Im "Sendbrief vom Dolmetschen" beschrieb Luther die harte Arbeit des Übersetzers einmal folgendermaßen:
"Lieber / nu es verdeutscht vn(d) bereit ist / kans ein yeder lesen vnd meistern / Laufft einer ytzt mit den augen durch drey vier bletter vnd stost nicht ein mal an / wird aber nicht gewar welche wacken vnd klo(e)tze da gelegen sind / da er ytzt vber hin gehet / wie vber ein gehoffelt1 bret / da wir haben mu(e)ssen schwitzen vn(d) vns engsten / ehe den wir solche wacken vnd klotze aus dem wege reümeten / auff das man ku(e)ndte so fein daher gehen. Es ist gut pflugen / wenn der acker gereinigt ist. Aber den wald vnd die sto(e)cke aus rotten / vnd de(n) acker zu richten / da will niemandt an."
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es nun, ein wenig nachzuvollziehen, wie Luther seinerzeit die „Wacken und Klötze“ des griechischen Textes aus dem Weg räumte, um einen fruchtbaren deutschen Boden zu gewinnen, auf dem das Neue Testament, die Lehre Christi und der reformierte Glauben gemeinsam gedeihen konnten. Um hierbei Luthers Arbeit, sein „Schwitzen und Ängsten“, richtig würdigen zu können, scheint es mir unabdingbar, immer wieder einen Blick auf den "wilden" Ausgangsacker zu werfen, und ihn mit dem bestellten Feld Martin Luthers zu vergleichen. Das heißt: In der vorliegenden Arbeit wird durchgehend der griechische Text mit Luthers Übersetzung verglichen. Denn ich bin der Meinung, nur so kann Luthers Eigenanteil an der Übersetzung wirklich zur Geltung kommen (und nur so kann man entdecken, ob Luther beim Herrichten des Ackers nicht doch ein paar „Stöcker“ vergessen hat „auszurotten“).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Martin Luther: biographischer Abriss
- Luther ad fontes
- Luthers eigene Aussagen zu seiner Übersetzungstätigkeit
- Luthers Hauptziel: „rein vnd klar teutsch geben“
- Sinn für Sinn/ „die wort faren lassen“
- Wort für Wort/ „stracks den worten nach gedolmetscht“
- Luthers Übersetzungsstrategien
- Literarisierung
- Metaphernverstärkung
- Klangfiguren: Alliteration
- Epanalepse
- Figura etymologica
- Wortneuschöpfungen
- Anpassung an die gesprochene Sprache
- Grußformeln und Anreden
- Modalpartikel
- Idiomatik
- Idiomatik im griechischen Text
- Idiomatik im deutschen Text
- Rücksicht auf die Schicklichkeit
- Kulturelle Eigenheiten
- Exegese
- Literarisierung
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Martin Luthers Übersetzungsstrategien beim Übersetzen des Neuen Testaments aus dem Altgriechischen. Ziel ist es, Luthers Herangehensweise an die Übersetzung zu analysieren und seinen Beitrag zur Entwicklung der deutschen Sprache zu beleuchten. Dabei wird der griechische Originaltext mit Luthers deutscher Übersetzung verglichen, um Luthers Eigenleistung und seine Entscheidungen transparent zu machen.
- Luthers Hauptziele bei der Bibelübersetzung
- Analyse seiner verschiedenen Übersetzungsmethoden (Wort-für-Wort, Sinn-für-Sinn)
- Der Einfluss der griechischen Sprache und Idiomatik auf Luthers Übersetzung
- Luthers Anpassung an die gesprochene Sprache und die deutsche Kultur
- Die Rolle der Exegese in Luthers Übersetzungsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Herausforderungen der Bibelübersetzung. Sie betont die Notwendigkeit, den griechischen Originaltext mit Luthers Übersetzung zu vergleichen, um sein Vorgehen und seine Entscheidungen besser zu verstehen. Der Autor hebt die Schwierigkeit hervor, Luthers Arbeit angemessen zu würdigen, ohne den "wilden" Ausgangsacker, den griechischen Text, aus den Augen zu verlieren. Die Einleitung weist außerdem auf die methodischen Herausforderungen hin, die sich aus dem Vergleich von Neuhochdeutsch und Altgriechisch ergeben.
Martin Luther: biographischer Abriss: Dieses Kapitel (sofern vorhanden im Originaltext und nicht nur eine kurze Notiz) würde einen kurzen Abriss von Luthers Leben und Wirken bieten, insbesondere im Hinblick auf seine theologischen und sprachlichen Überzeugungen, die seine Übersetzungstätigkeit beeinflusst haben. Der Fokus läge auf den Aspekten seines Lebens, die relevant für seine Herangehensweise an die Bibelübersetzung sind.
Luther ad fontes: (sofern vorhanden im Originaltext) Dieses Kapitel würde Luthers Quellen für seine Übersetzung beleuchten und analysieren, welchen Einfluss diese auf seine Arbeit hatten. Es könnte beispielsweise den Gebrauch von Erasmus' griechischem Neuen Testament erörtern und dessen Bedeutung für Luthers Übersetzung.
Luthers eigene Aussagen zu seiner Übersetzungstätigkeit: (sofern vorhanden im Originaltext) Diese Zusammenfassung würde Luthers eigene Kommentare und Reflexionen über seine Übersetzungstätigkeit untersuchen. Sie würde seine Hauptziele, wie "rein vnd klar teutsch geben", sowie seine Strategien des "Sinn für Sinn" und "Wort für Wort" Übersetzens im Detail analysieren und deren Bedeutung für seine Arbeit herausstellen.
Luthers Übersetzungsstrategien: Diese Zusammenfassung würde die verschiedenen Übersetzungsstrategien Luthers umfassend behandeln. Sie würde seine Techniken der Literarisierung (Metaphernverstärkung, Klangfiguren, etc.), seine Wortneuschöpfungen, seine Anpassung an die gesprochene Sprache (Grußformeln, Modalpartikel), seine Berücksichtigung der Idiomatik und der kulturellen Eigenheiten, sowie seine exegetischen Vorgehensweisen und deren Auswirkungen auf die Übersetzung detailliert beleuchten und deren jeweilige Bedeutung für seine Gesamtstrategie analysieren.
Schlüsselwörter
Martin Luther, Bibelübersetzung, Neues Testament, Altgriechisch, Deutsch, Übersetzungsstrategien, Literarisierung, Idiomatik, Sprachgeschichte, Exegese, Reformation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Martin Luthers Bibelübersetzung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Martin Luthers Übersetzungsstrategien beim Übersetzen des Neuen Testaments aus dem Altgriechischen ins Deutsche. Der Fokus liegt auf Luthers Herangehensweise, seinen Entscheidungen und seinem Beitrag zur Entwicklung der deutschen Sprache.
Welche Aspekte von Luthers Übersetzung werden untersucht?
Die Analyse umfasst Luthers Hauptziele bei der Bibelübersetzung, seine verschiedenen Übersetzungsmethoden (Wort-für-Wort, Sinn-für-Sinn), den Einfluss der griechischen Sprache und Idiomatik, seine Anpassung an die gesprochene Sprache und deutsche Kultur, und die Rolle der Exegese in seinem Übersetzungsprozess. Es werden auch seine literarischen Techniken wie Metaphernverstärkung und Klangfiguren untersucht.
Wie wird die Analyse durchgeführt?
Der griechische Originaltext wird mit Luthers deutscher Übersetzung verglichen, um Luthers Eigenleistung und seine Entscheidungen transparent zu machen. Luthers eigene Aussagen zu seiner Übersetzungstätigkeit spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
Welche Übersetzungsstrategien Luthers werden behandelt?
Die Arbeit behandelt detailliert Luthers Strategien der Literarisierung (einschließlich Metaphernverstärkung, Alliteration, Epanalepse und Figura etymologica), Wortneuschöpfungen, Anpassung an die gesprochene Sprache (Grußformeln, Modalpartikel), Idiomatik (im griechischen und deutschen Text), Berücksichtigung der Schicklichkeit, kulturelle Eigenheiten und Exegese.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält eine Einleitung, ein Kapitel zu Luthers Biographie (sofern im Originaltext vorhanden), ein Kapitel zu Luthers Quellen ("Luther ad fontes"), ein Kapitel zu Luthers eigenen Aussagen über seine Übersetzung, ein Kapitel zu seinen Übersetzungsstrategien und eine Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Martin Luther, Bibelübersetzung, Neues Testament, Altgriechisch, Deutsch, Übersetzungsstrategien, Literarisierung, Idiomatik, Sprachgeschichte, Exegese, Reformation.
Was ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, Luthers Herangehensweise an die Bibelübersetzung zu analysieren und seinen Beitrag zur Entwicklung der deutschen Sprache zu beleuchten.
Wie wird der "wilde" griechische Originaltext berücksichtigt?
Die Arbeit betont die Notwendigkeit, den griechischen Originaltext im Vergleich mit Luthers Übersetzung zu betrachten, um sein Vorgehen und seine Entscheidungen besser zu verstehen und seine Leistung angemessen zu würdigen. Die methodischen Herausforderungen des Vergleichs von Neuhochdeutsch und Altgriechisch werden ebenfalls angesprochen.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2012, Martin Luthers Übersetzungsstrategien bei der "Verdolmetschung" des Neuen Testaments aus dem Altgriechischen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231497