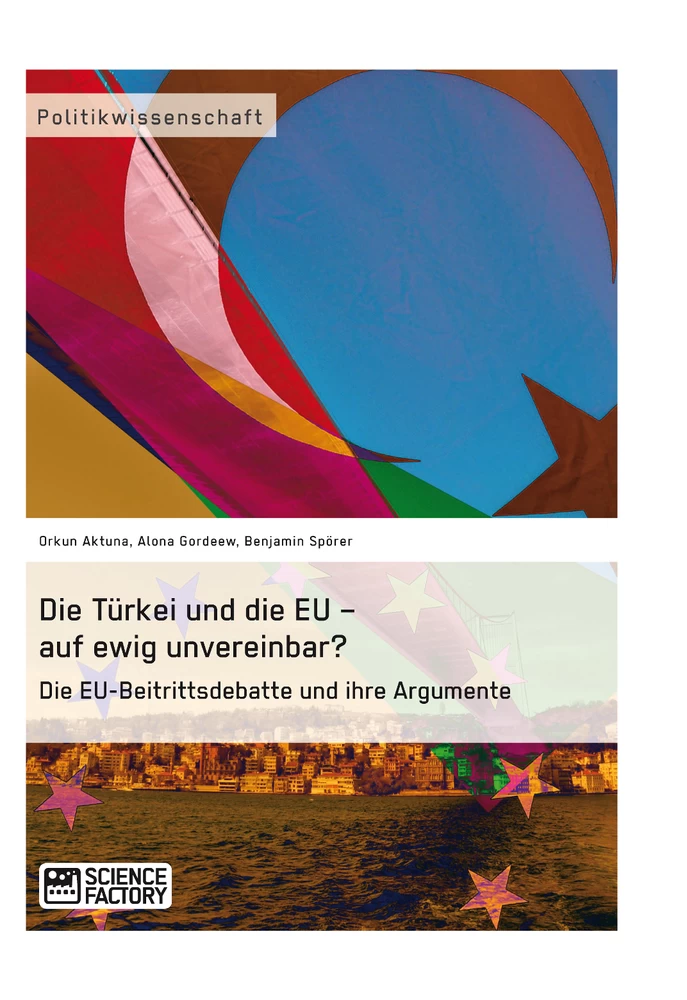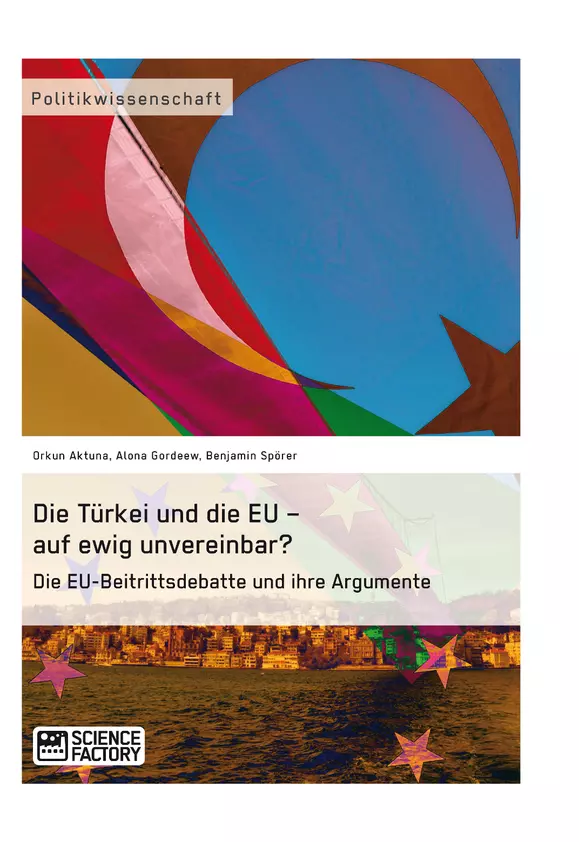Darf die Türkei in die EU? Eine endlos erscheinende und hitzig debattierte Streitfrage, bei der zwei Kulturen aufeinanderprallen. Dabei steht die Zukunft sowohl der Türkei als auch der EU auf dem Spiel. Der Ausgang ist entscheidend für die Erweiterungspolitik und zukünftige Ausrichtung der EU. Doch es ist auch eine Frage nach Identität und nach den Kernwerten Europas.
Dieses Buch zeichnet wesentliche Argumentationslinien der EU-Erweiterungs-Debatte nach und erläutert die europäische und türkische Haltung zur Beitrittsfrage. Es stellt gleichzeitig einen Versuch dar, das Staatengebilde der EU mit politikwissenschaftlichen Kategorien zu erfassen.
Aus dem Inhalt:
Die Kopenhagener Kriterien für den EU-Beitritt; Wirtschaftliche Voraussetzungen; Stereotype in der EU bezüglich der Türkei; Kernproblematiken in der Türkei: Die Zypernfrage, Das KurdInnenproblem, Die Rolle des Militärs in der Türkei; Außen- und sicherheitspolitische Implikationen; Geostrategische und -politische Bedeutung der Türkei; Demographische und migrationspolitische Argumentationskriterien; Die EU als "Union der Staaten" und "Union der Bürger"
Inhaltsverzeichnis
- Die Türkei und die EU - auf ewig unvereinbar?
- Die EU-Beitrittsdebatte und ihre Argumente
- Orkun Aktuna (2009): Die Türkei und die EU. Eine unendliche Geschichte mit ungewissem Ausgang
- Einleitende Worte
- Assoziierungsabkommen von Ankara
- Über die Kopenhagener Kriterien
- Verschiedene Auslegungen des Minderheitenbegriffs
- Minderheitenbegriff im Osmanischen Reich
- Minderheitenbegriff in der Türkei
- Minderheitenbegriff in Europa
- Die Lazlnnen
- Die GeorgierInnen
- Die Roma
- Pro und Kontra einer eventuellen türkischen EU-Mitgliedschaft
- Vorteile der türkischen EU-Mitgliedschaft aus türkischer Sicht
- Vorteile der türkischen EU-Mitgliedschaft aus europäischer Sicht
- Nachteile der türkischen Mitgliedschaft aus türkischer Sicht
- Nachteile der türkischen EU-Mitgliedschaft aus europäischer Sicht
- Die Rolle der Türkei in ihrem Umfeld
- Geostrategische und -politische Bedeutung der Türkei
- Energieträgerin zwischen dem Kaspischen Meer und Europa
- Vermittlerrolle und Vorbildfunktion im Nahen Osten
- Stereotype in der EU bezüglich der Türkei
- Bedeutsame Kernproblematiken in der Türkei
- Das KurdInnenproblem und die PKK
- Der Zypernkonflikt
- Die Rolle des Militärs — „Hüter der Republik"
- Persönliches Schlussresümee
- Literaturverzeichnis
- Atona Gordeew (2008): Die Debatte über den EU-Beitritt der Türkei und die Rückschlüsse daraus über das Europabild
- Einleitung
- Bisherige Entwicklung der EU-Türkei Beziehungen
- Zum Konzept der Argumentationslinien
- Vorpolitische Argumentation
- Geographische Kriterien
- Historisch-kulturelle Kriterien
- Religiöse Kriterien
- Die Europäische Identität als Kriterium
- Politische und geostrategische Argumentation
- Die Innenpolitische Situation in der Türkei als Kriterium
- Ökonomische Kriterien
- Geostrategische Kriterien
- Europapolitische Kriterien
- Demographische und migrationspolitische Kriterien
- Die Folgen einer Absage als Kriterium
- Fazit
- Literatur
- Benjamin Spörer (2011): Die EU — Vom Elitenprojekt zum Bürgerprojekt. Der EU-Beitritt der Türkei als Testfall für das Verhältnis zwischen einer Union der Staaten und einer Union der Bürger
- Einleitung
- Ist der EU-Beitritt der Türkei ein Testfall für das Verhältnis zwischen einer Union der Staaten und einer Union der Bürger?
- Die europäische Integration und das Verhältnis zwischen EU, Mitgliedstaaten und Bürgern
- Union der Staaten und Union der Bürger - eine Begriffsbestimmung
- Die Kopenhagener Kriterien und der Erweiterungsprozess der EU
- Der Weg der Türkei in die EU
- Wie stellt sich das Verhältnis zwischen einer Union der Staaten und einer Union der Bürger anhand des EU-Beitritts der Türkei als Testfall dar?
- Die Debatte um den EU-Beitritt der Türkei
- Der aktuelle Forschungsstand hinsichtlich der Analyse der Türkei-Debatte
- Eine Kategorisierung der Türkei-Debatte
- Die Türkei-Debatte vor dem Hintergrund der jeweiligen Idealtypen
- „Die EU als föderaler Bundesstaat mit einer exklusiven Identität"
- „Die EU als föderaler Bundesstaat mit einer inklusiven Identität"
- „Die EU als intergouvernementaler Staatenbund mit einer inklusiven Identität"
- „Die EU als intergouvemementaler Staatenbund mit einer exklusiven Identität"
- Ein Zwischenfazit
- Wie ist das Verhältnis einzuordnen?
- Die politische Entscheidung
- Das Spannungsverhältnis als Ausdruck des Integrationsgrades
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Die Türkei und die EU - auf ewig unvereinbar?
- Die EU-Beitrittsdebatte und ihre Argumente
- Das Europabild und die Türkei
- Die EU als Union der Staaten und der Bürger
- Der EU-Beitritt der Türkei als Testfall
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Publikation ist eine Anthologie, die sich mit der Debatte um den EU-Beitritt der Türkei auseinandersetzt. Sie umfasst drei Beiträge, die verschiedene Aspekte der Debatte beleuchten und unterschiedliche Perspektiven auf das Verhältnis zwischen der Türkei und der EU sowie auf die Zukunft der europäischen Integration darlegen.
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Beitrag von Orkun Aktuna beleuchtet die historische Entwicklung der Beziehungen zwischen der Türkei und der EU. Er analysiert das Assoziierungsabkommen von Ankara, die Kopenhagener Kriterien sowie die verschiedenen Auslegungen des Minderheitenbegriffs in der Türkei und in Europa. Aktuna untersucht die Vor- und Nachteile eines möglichen türkischen EU-Beitritts aus türkischer und europäischer Sicht und beleuchtet die Rolle der Türkei in ihrem Umfeld. Der Beitrag widmet sich außerdem den Stereotypen in der EU bezüglich der Türkei und den Kernproblematiken in der Türkei, wie dem KurdInnenproblem, dem Zypernkonflikt und der Rolle des Militärs.
Der zweite Beitrag von Alona Gordeew untersucht die Debatte um den EU-Beitritt der Türkei und die Rückschlüsse, die daraus über das Europabild gezogen werden können. Gordeew analysiert die verschiedenen Argumentationslinien, die in der Debatte vorgebracht werden, und stellt die unterschiedlichen Vorstellungen von Europa, die sich aus diesen Argumenten herauskristallisieren, dar. Sie untersucht dabei die geographischen, historisch-kulturellen, religiösen und identitären Kriterien, die in der Debatte eine Rolle spielen, sowie die politischen und geostrategischen Argumente, die für oder gegen einen Beitritt der Türkei angeführt werden.
Der dritte Beitrag von Benjamin Spörer widmet sich der Frage, ob der EU-Beitritt der Türkei einen geeigneten Testfall für das Verhältnis zwischen der EU als einer Union der Staaten und als einer Union der Bürger darstellt. Spörer stellt die europäische Integration im Hinblick auf das Verhältnis zwischen der EU, den Mitgliedstaaten und den Bürgern dar und definiert die Begriffe Union der Staaten und Union der Bürger. Er beleuchtet den Erweiterungsprozess der EU und die Kopenhagener Kriterien sowie den Weg der Türkei in die EU. Anschließend analysiert er die Debatte um den EU-Beitritt der Türkei und stellt die verschiedenen Positionen, die in dieser Debatte vertreten werden, anhand von Idealtypen dar. Spörer untersucht, wie sich das Verhältnis zwischen der EU als einer Union der Staaten und als einer Union der Bürger anhand des EU-Beitritts der Türkei als Testfall darstellt, und ordnet dieses Verhältnis schließlich in einen größeren Zusammenhang ein.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den EU-Beitritt der Türkei, die europäische Integration, das Europabild, die Kopenhagener Kriterien, die türkische Identität, die europäische Identität, die Union der Staaten, die Union der Bürger, die politische Auseinandersetzung, die öffentliche Debatte, die Medien, die nationalen Parteien und die Zukunft der EU.
Häufig gestellte Fragen
Welche Voraussetzungen muss die Türkei für einen EU-Beitritt erfüllen?
Die Türkei muss die sogenannten Kopenhagener Kriterien erfüllen, die stabile demokratische Institutionen, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und eine funktionierende Marktwirtschaft fordern.
Was sind die zentralen Streitpunkte in der Beitrittsdebatte?
Wichtige Themen sind der Zypernkonflikt, das Kurdenproblem, die Rolle des Militärs in der türkischen Politik sowie unterschiedliche Auffassungen von Identität und Kultur.
Welche geostrategische Bedeutung hat die Türkei für die EU?
Die Türkei gilt als wichtige Energietransitregion zwischen dem Kaspischen Meer und Europa sowie als potenzieller Vermittler und Vorbild im Nahen Osten.
Was versteht man unter der EU als „Union der Bürger“ im Gegensatz zur „Union der Staaten“?
Diese Begriffe beschreiben das Spannungsfeld zwischen einer EU, die primär auf der Zusammenarbeit von Nationalstaaten basiert, und einer EU, die eine direkte demokratische Identität für ihre Bürger schafft.
Wie werden Minderheitenbegriffe in der Türkei und Europa unterschiedlich ausgelegt?
Die Arbeit analysiert die historische Entwicklung des Minderheitenbegriffs vom Osmanischen Reich bis zur modernen Türkei und vergleicht diese mit europäischen Standards.
Welche Rolle spielen Stereotype in der Debatte?
Es wird untersucht, wie kulturelle und religiöse Vorurteile in der EU die politische Entscheidung über eine türkische Mitgliedschaft beeinflussen.
- Quote paper
- Orkun Aktuna (Author), Alona Gordeew (Author), Benjamin Spörer (Author), 2013, Die Türkei und die EU – auf ewig unvereinbar? Die EU-Beitrittsdebatte und ihre Argumente, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231630