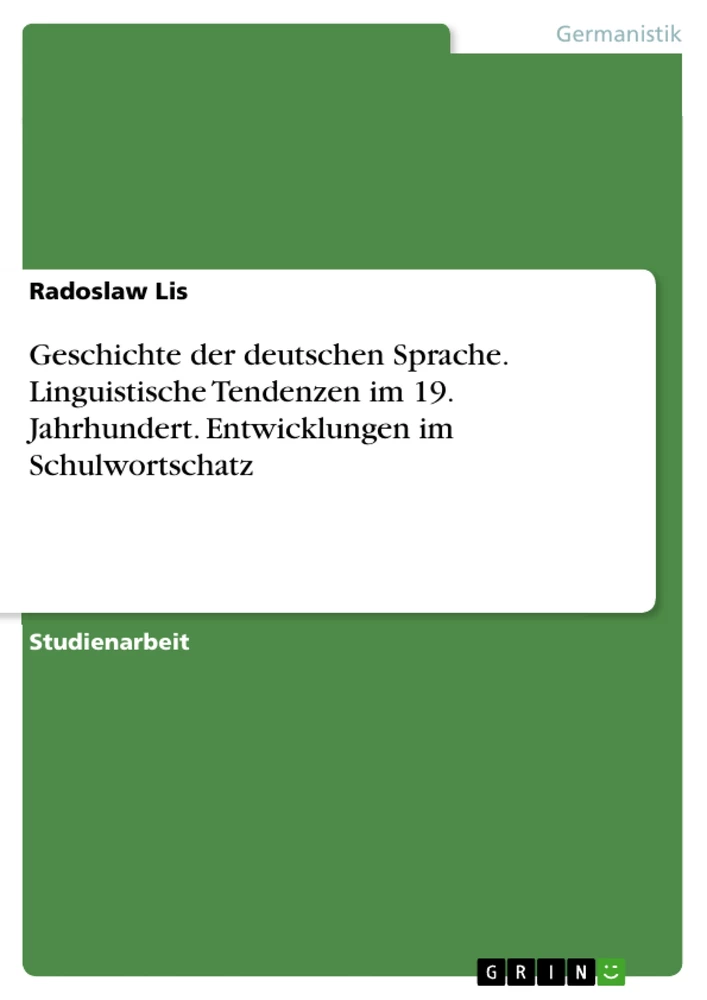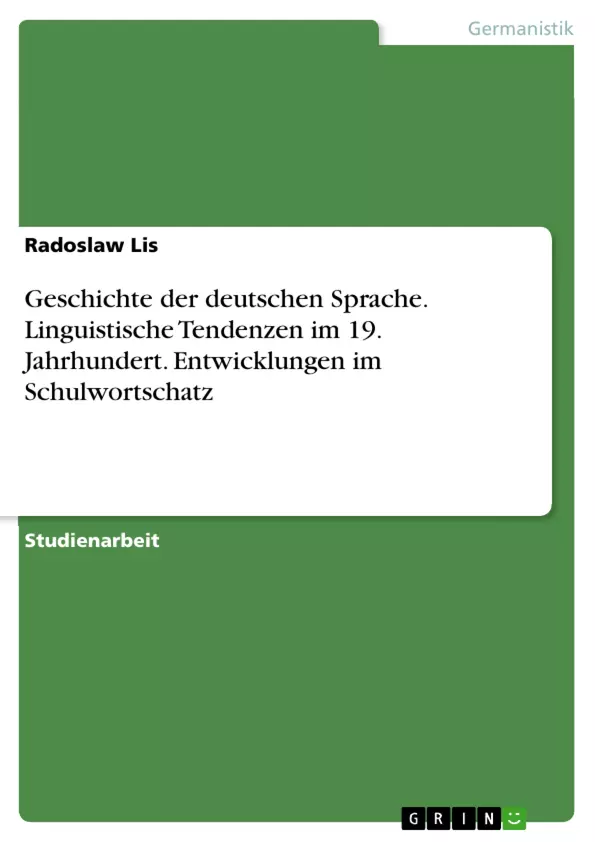Die deutsche Sprache hat sich über Jahrhunderte ausgebildet und verändert sich ständig. Der Wortschatz ist nämlich jener Teil der Sprache, der den Bezeichnungsbedürfnissen eines Volkes am stärksten unterliegt. Der Umfang und die Größe des Wortschatzes hängen immer von den kommunikativen Bedürfnissen und Gewohnheiten einer Sprachgemeinschaft ab. So entstehen auch lexikalische Mittel, um neue Sachen, Erscheinungen, Sachverhalte aus der Schule zu benennen, andere Bezeichnungen veralten und kommen außer Gebrauch, ihre Bedeutung verändert sich oder sie sterben aus und verschwinden aus der Schulterminologie.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Archaismen und Neologismen
- Bedeutungswandel
- Entlehnungen und Fremdwörter
- Zusammensetzungen
- Schlusswort
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Geschichte der deutschen Sprache im 19. Jahrhundert, wobei der Fokus auf den Sprachwandel im Schulwortschatz liegt. Sie untersucht die Entwicklungen im Wortschatz des Deutschen, die durch gesellschaftliche Veränderungen und die zunehmende Bedeutung der Bildung im 19. Jahrhundert geprägt waren.
- Archaismen und Neologismen: Die Arbeit analysiert die Entstehung neuer Wörter (Neologismen) und das Aussterben veralteter Begriffe (Archaismen) im Schulwortschatz.
- Bedeutungswandel: Die Arbeit untersucht die Veränderung der Bedeutung von Wörtern im Laufe der Zeit und die Gründe für diese Veränderungen.
- Entlehnungen und Fremdwörter: Die Arbeit analysiert die Übernahme von Wörtern aus anderen Sprachen (Entlehnungen) und die Entwicklung von Fremdwörtern im Schulwortschatz.
- Zusammensetzungen: Die Arbeit befasst sich mit der Bildung von Komposita und deren Bedeutung für die Entwicklung des Schulwortschatzes im 19. Jahrhundert.
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort führt in die Thematik der Sprachentwicklung und -veränderung ein und betont die Bedeutung des Wortschatzes als Spiegelbild gesellschaftlicher Entwicklungen. Es wird die These aufgestellt, dass der Wortschatz ein dynamisches System ist, das sich ständig an neue Bedürfnisse und Entwicklungen anpasst.
Das Kapitel "Archaismen und Neologismen" beleuchtet die Entstehung neuer Wörter (Neologismen) und das Aussterben veralteter Begriffe (Archaismen) im Schulwortschatz. Es werden verschiedene Beispiele für Archaismen und Neologismen aus der Schulterminologie des 19. Jahrhunderts vorgestellt und die Gründe für ihre Entstehung und ihren Rückgang analysiert.
Das Kapitel "Bedeutungswandel" untersucht die Veränderung der Bedeutung von Wörtern im Laufe der Zeit und die Gründe für diese Veränderungen. Es werden verschiedene Typen des Bedeutungswandels vorgestellt und anhand von Beispielen aus der Schulterminologie des 19. Jahrhunderts illustriert.
Das Kapitel "Entlehnungen und Fremdwörter" analysiert die Übernahme von Wörtern aus anderen Sprachen (Entlehnungen) und die Entwicklung von Fremdwörtern im Schulwortschatz. Es werden die wichtigsten Gebersprachen für das Deutsche im 19. Jahrhundert vorgestellt und die Auswirkungen der Entlehnungen auf die Schulterminologie untersucht.
Das Kapitel "Zusammensetzungen" befasst sich mit der Bildung von Komposita und deren Bedeutung für die Entwicklung des Schulwortschatzes im 19. Jahrhundert. Es werden die verschiedenen Arten von Komposita vorgestellt und anhand von Beispielen aus der Schulterminologie des 19. Jahrhunderts illustriert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die deutsche Sprache, Sprachgeschichte, Schulwortschatz, Wortschatzentwicklung, Archaismen, Neologismen, Bedeutungswandel, Entlehnungen, Fremdwörter, Zusammensetzungen, Determinativkomposita, Schulterminologie, 19. Jahrhundert.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte sich die deutsche Sprache im 19. Jahrhundert?
Die Sprache passte sich den neuen kommunikativen Bedürfnissen einer wachsenden Bildungsgesellschaft an, was besonders im Schulwortschatz durch neue Begriffe und Bedeutungswandel sichtbar wurde.
Was sind Archaismen und Neologismen im Schulkontext?
Neologismen sind Wortneuschöpfungen für neue schulische Phänomene, während Archaismen veraltete Begriffe sind, die aus der Schulterminologie verschwunden sind.
Welche Rolle spielen Fremdwörter im 19. Jahrhundert?
Durch Entlehnungen aus anderen Sprachen wurden neue fachliche und pädagogische Konzepte benannt, wobei der Einfluss des Lateinischen und Französischen weiterhin stark war.
Warum ist der Wortschatz so dynamisch?
Der Wortschatz unterliegt den Bezeichnungsbedürfnissen eines Volkes. Ändern sich gesellschaftliche Strukturen oder Bildungssysteme, entstehen sofort neue lexikalische Mittel.
Was versteht man unter Bedeutungswandel bei Schulbegriffen?
Bestehende Wörter blieben erhalten, änderten aber über die Jahrzehnte ihre Bedeutung, um modernere pädagogische Sachverhalte oder Organisationsformen abzubilden.
- Citar trabajo
- Radoslaw Lis (Autor), 2013, Geschichte der deutschen Sprache. Linguistische Tendenzen im 19. Jahrhundert. Entwicklungen im Schulwortschatz, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/231734