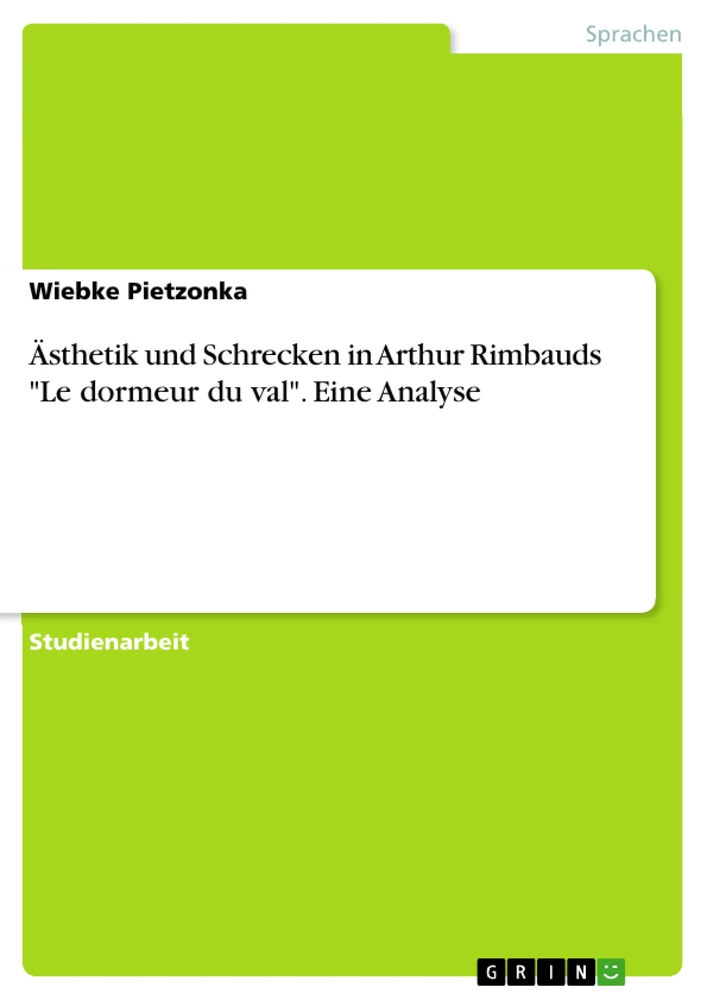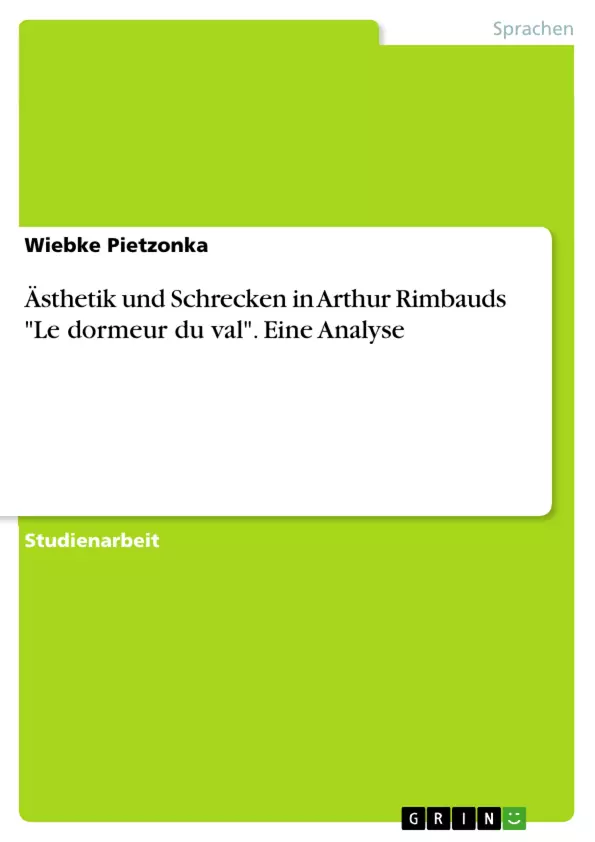„Der Eindruck Rimbaudscher Texte ist um so desorientierender, als er von einer Sprache ausgeht, die nicht nur mit brutalen Stößen verletzt, sondern auch der zauberhaftesten Melodien fähig sein kann.“ (Friedrich 1988: 61)
Diese Aussage Hugo Friedrichs in Die Struktur der modernen Lyrik lässt bereits vermuten, warum die Werke Arthur Rimbauds bis heute von Interesse und Relevanz sind, und das nicht nur in der wissenschaftlichen Forschung. Sicherlich mag daran auch die exzentrische Persönlichkeit des Dichters selbst nicht ganz unbeteiligt sein. Charakterisierungen Rimbauds als „Bürgerschreck“ (Thoma 2009: 34) oder „`enfant terrible` der neuen Dichterschule“ (Stackelberg 1990: 217) unterstreichen umso mehr den Mythos des Dichters als `literarischen Rebellen`, dessen Leben und Gesamtwerk sich gleichermaßen mit einem einzigen Wort beschreiben lassen können: „Heftigkeit“ (Friedrich 1988: 59).
Ziel dieser Arbeit ist es nun, das einleitende Zitat Friedrichs, welches von ihm zweifelsohne auf das Gesamtwerk Arthur Rimbauds bezogen wird, an einem konkreten Beispiel, dem Sonett Le dormeur du val aus dem Jahr 1870, zu belegen. Konkret bedeutet dies, dass im Folgenden untersucht werden soll, welche sprachlichen und stilistischen Mitttel in diesem Gedicht dazu führen, dass es im klassischen Sinne `ästhetisch` wirkt. Welche, um es mit Friedrichs Worten zu sagen, „zauberhaftesten Melodien“ (siehe oben) können wir in Le dormeur du val finden? Auf der anderen Seite soll diese Arbeit ebenfalls aufzeigen, inwiefern man bei diesem Sonett gleichermaßen von einem `schrecklichen`, `grausamen` Gedicht sprechen kann. Auch bei der Antwort auf diese Frage soll die formale und sprachliche Analyse des Sonetts die Basis für die Interpretation zu der Fragestellung sein, mit welchen, von Friedrich besagten, „brutalen Stößen“ dieses besondere Gedicht Rimbauds „verletzt“ (siehe oben). Hierzu ist zu sagen, dass, um in dieser Arbeit Ästhetik und Schrecken in Le dormeur du val zu untersuchen, sich in der Analyse und Interpretation hauptsächlich auf jene Aspekte konzentriert wird, die auch relevant für eben diese Zielstellung sind. Darüber hinaus ist es mein Ziel, in der vorliegenden Arbeit am Beispiel von Rimbauds Sonett Le dormeur du val „die bestürzende Faszination [Rimbauds] Sprache“ (Stenzel/ Thoma 1987: 30), welche bis in die heutige Zeit währt, entschlüsseln und bezeugen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Le dormeur du val im biographischen und zeitgenössischen Kontext
- II.I. Verortung von Le dormeur du val in Vita und Gesamtwerk Arthur Rimbauds
- II.II. Einordnung von Le dormeur du val in die französischen Literaturströmungen des 19. Jahrhunderts
- III. Das Sonett Le dormeur du val
- III.I. Die Sonettform von Le dormeur du val
- III.II. Inhalt des Sonetts
- IV. Ästhetik und Schrecken in Le dormeur du val
- IV.I. Le dormeur du val als `ästhetisches Gedicht
- IV.II. Le dormeur du val als `grausames Gedicht
- V. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Arthur Rimbauds Sonett "Le dormeur du val" (1870) im Hinblick auf seine ästhetischen und schrecklichen Aspekte. Sie beleuchtet, wie sprachliche und stilistische Mittel im Gedicht zu seiner ästhetischen Wirkung beitragen und gleichzeitig ein Gefühl des Grauens erzeugen. Die Analyse konzentriert sich auf die Verbindung zwischen Form, Sprache und Interpretation, um die "bestürzende Faszination" von Rimbauds Sprache zu entschlüsseln.
- Analyse der ästhetischen Qualitäten von "Le dormeur du val".
- Untersuchung der schrecklichen und grausamen Elemente im Gedicht.
- Einordnung des Gedichts in Rimbauds Gesamtwerk und Biografie.
- Kontextualisierung des Gedichts innerhalb der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts.
- Erforschung des Zusammenspiels von Form, Sprache und Bedeutung.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Relevanz von Rimbauds Werk, insbesondere die ambivalente Natur seiner Sprache, die gleichzeitig Schönheit und Grauen hervorbringen kann. Sie formuliert das Ziel der Arbeit: die Analyse von "Le dormeur du val" unter dem Aspekt von Ästhetik und Schrecken, indem sie die sprachlichen und stilistischen Mittel untersucht, die zu beiden Effekten beitragen. Die Einleitung verweist auf Hugo Friedrichs Aussage über den desorientierenden Eindruck von Rimbauds Texten als Ausgangspunkt der Analyse.
II. Le dormeur du val im biographischen und zeitgenössischen Kontext: Dieses Kapitel ordnet "Le dormeur du val" in den biographischen und literaturgeschichtlichen Kontext ein. Es beschreibt die Entstehung des Sonetts im Kontext des frühen Schaffens Rimbauds und des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71. Der Bezug zum Krieg und die persönliche Situation Rimbauds während der Entstehung werden diskutiert, ebenso wie die Einordnung des Werkes in Rimbauds Gesamtwerk und in die französischen Literaturströmungen des 19. Jahrhunderts. Der Einfluss des Lehrers Georges Izambard auf die frühe Entwicklung Rimbauds wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Arthur Rimbaud, Le dormeur du val, Ästhetik, Schrecken, Sonett, Sprachstil, Französische Literatur des 19. Jahrhunderts, Biographischer Kontext, Deutsch-Französischer Krieg 1870/71, Lyrik, Form und Inhalt.
Häufig gestellte Fragen zu Arthur Rimbauds "Le dormeur du val"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Arthur Rimbauds Sonett "Le dormeur du val" (1870) im Hinblick auf seine ästhetischen und schrecklichen Aspekte. Sie untersucht, wie sprachliche und stilistische Mittel im Gedicht zu seiner ästhetischen Wirkung beitragen und gleichzeitig ein Gefühl des Grauens erzeugen. Der Fokus liegt auf der Verbindung zwischen Form, Sprache und Interpretation, um die ambivalente Wirkung des Gedichts zu entschlüsseln.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die ästhetischen Qualitäten von "Le dormeur du val", die schrecklichen und grausamen Elemente im Gedicht, die Einordnung des Gedichts in Rimbauds Gesamtwerk und Biografie, die Kontextualisierung innerhalb der französischen Literatur des 19. Jahrhunderts und das Zusammenspiel von Form, Sprache und Bedeutung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Eine Einleitung, ein Kapitel zur Einordnung des Gedichts in den biographischen und zeitgenössischen Kontext (inkl. Bezug zum Deutsch-Französischen Krieg und Rimbauds Biografie), ein Kapitel zur Analyse des Sonetts selbst (Form und Inhalt), ein Kapitel zur Ästhetik und zum Schrecken im Gedicht und ein Fazit. Zusätzlich werden eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter bereitgestellt.
Welche Rolle spielt der biographische und zeitgenössische Kontext?
Das zweite Kapitel ordnet "Le dormeur du val" in den biographischen und literaturgeschichtlichen Kontext ein. Es beschreibt die Entstehung des Sonetts im Kontext des frühen Schaffens Rimbauds und des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71. Der Bezug zum Krieg und die persönliche Situation Rimbauds während der Entstehung werden diskutiert, ebenso wie die Einordnung des Werkes in Rimbauds Gesamtwerk und in die französischen Literaturströmungen des 19. Jahrhunderts. Der Einfluss des Lehrers Georges Izambard wird ebenfalls thematisiert.
Wie werden Ästhetik und Schrecken im Gedicht analysiert?
Das vierte Kapitel analysiert die ästhetischen und schrecklichen Aspekte des Gedichts. Es untersucht, wie sprachliche und stilistische Mittel gleichzeitig Schönheit und Grauen hervorbringen. Die Analyse konzentriert sich auf das Zusammenspiel von Form, Sprache und Interpretation, um die "bestürzende Faszination" von Rimbauds Sprache zu entschlüsseln.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Arthur Rimbaud, Le dormeur du val, Ästhetik, Schrecken, Sonett, Sprachstil, Französische Literatur des 19. Jahrhunderts, Biographischer Kontext, Deutsch-Französischer Krieg 1870/71, Lyrik, Form und Inhalt.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit wird im fünften Kapitel präsentiert (im bereitgestellten Auszug nicht detailliert beschrieben).
- Quote paper
- Wiebke Pietzonka (Author), 2012, Ästhetik und Schrecken in Arthur Rimbauds "Le dormeur du val". Eine Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232045