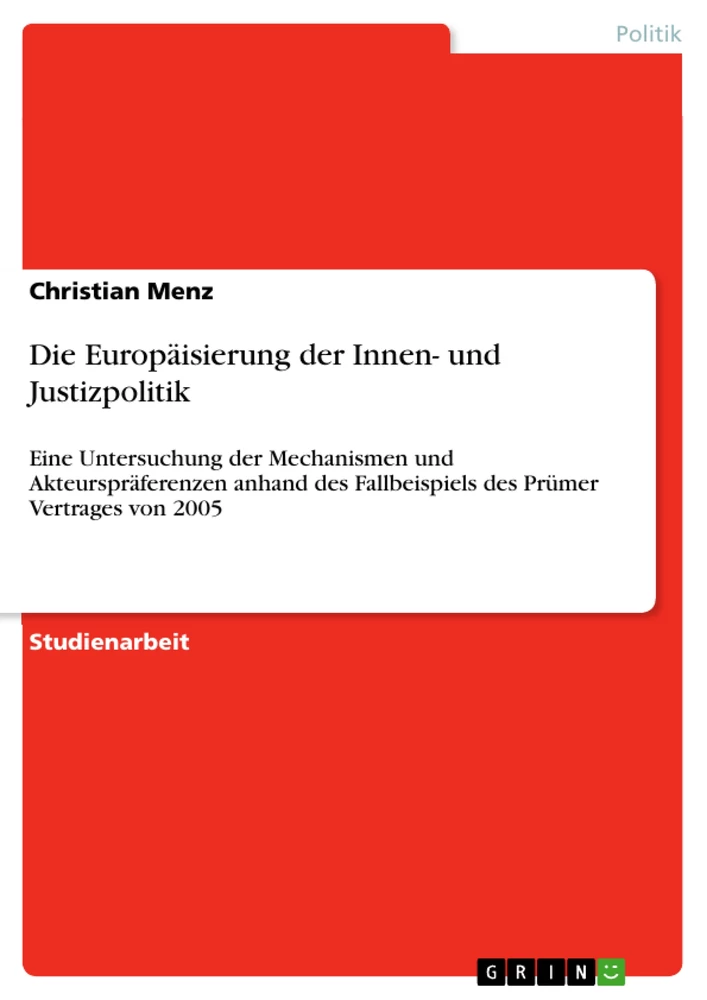Obwohl besonders sensible Bereiche der staatlichen Souveränität betroffen sind und trotz der unterschiedlichen Rechtstraditionen und Regelungen im Zivil- und Strafrecht der EU-Mitgliedstaaten, gehört die Innen- und Justizpolitik bereits seit Jahren zu den dynamischsten Integrationsbereichen. Anhand des Zwei-Ebenen-Modells aus der Europäisierungsforschung von Börzel (2002, 2003) ist es einerseits möglich, aus einer „bottom-up“-Perspektive zu erklären, warum sieben Mitgliedstaaten unter der Führung Deutschlands am 27.05.2005 den Prümer Vertrag zunächst außerhalb des EU-Vertrags und weitestgehend unbeeinflusst von öffentlichen und parlamentarischen Kontrollverfahren unterzeichneten und gerade dadurch die Europäisierung der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS) vorantrieben. Andererseits lässt sich nachweisen, wie und warum ihnen nur wenige Jahre später ohne wesentliche Änderungen der „Uploading“-Prozess auf die europäische Ebene gelang und inwiefern die Europäische Kommission und das Europäische Parlament (EP) gezwungen waren, ihre eigene Agenda an das Vorgehen der Mitgliedstaaten anzupassen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Merkmale, Entwicklung und offene Fragen in der Europäisierungsforschung
3. Die Europäisierung im Bereich der Innen- und Justizpolitik
4. Der „uploading“-Mechanismus anhand des Vertrages von Prüm unter besonderer Berücksichtigung der Rolle Deutschlands
4.1 Entstehungsprozess und Inhalt des Prümer Vertrages
4.2 Präferenzen und Strategien der maßgeblichen Akteure beim „uploading“-Prozess
5. Schluss
6. Anhang
7. Literaturverzeichnis
7. 1 Primärquellen
7.2 Sekundärquellen
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Prümer Vertrag?
Der Prümer Vertrag wurde am 27.05.2005 von sieben Mitgliedstaaten unterzeichnet, um die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS) zu intensivieren.
Was bedeutet „Europäisierung“ in der Innenpolitik?
Es beschreibt den Prozess, bei dem nationale Politiken in den europäischen Rahmen integriert werden, oft durch Mechanismen wie „Uploading“ oder „Downloading“.
Welche Rolle spielte Deutschland beim Vertrag von Prüm?
Deutschland gehörte zu den führenden Kräften, die den Vertrag zunächst außerhalb des EU-Rahmens vorantrieben (Bottom-up-Perspektive).
Was ist der „Uploading-Mechanismus“?
Der Prozess, bei dem nationale oder intergouvernementale Abkommen (wie der Prümer Vertrag) ohne wesentliche Änderungen auf die europäische Unionsebene übertragen werden.
Warum wurde der Vertrag zunächst außerhalb des EU-Vertrags geschlossen?
Dies ermöglichte es den Unterzeichnerstaaten, schneller und weitestgehend unbeeinflusst von öffentlichen und parlamentarischen Kontrollverfahren zusammenzuarbeiten.
Welches theoretische Modell liegt der Arbeit zugrunde?
Die Arbeit nutzt das Zwei-Ebenen-Modell aus der Europäisierungsforschung nach Börzel (2002, 2003).
- Quote paper
- Christian Menz (Author), 2009, Die Europäisierung der Innen- und Justizpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232072