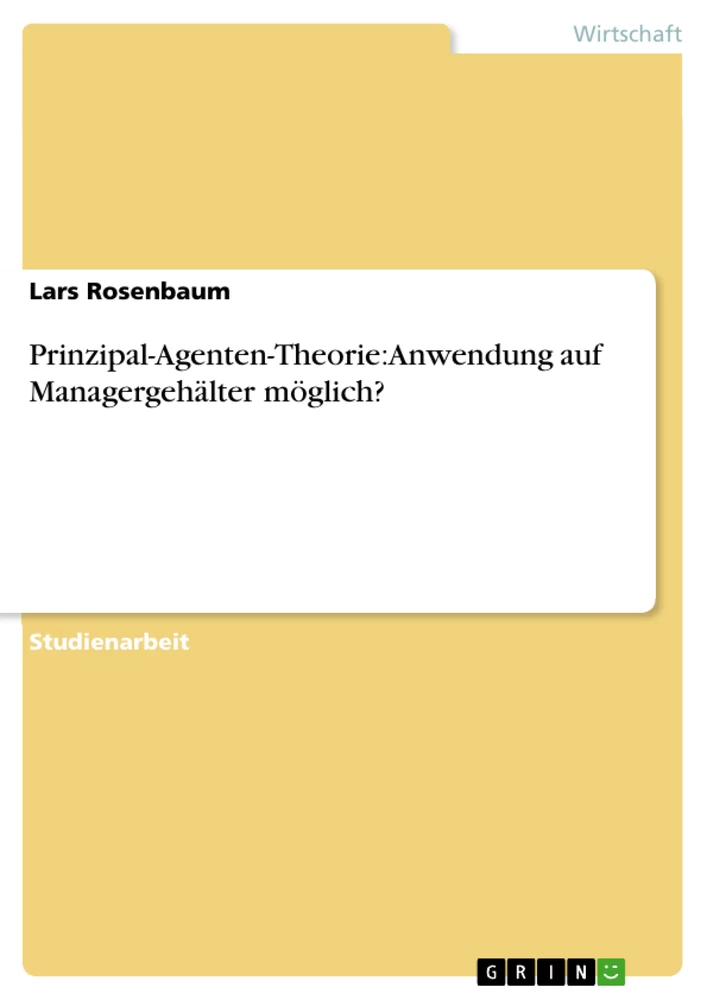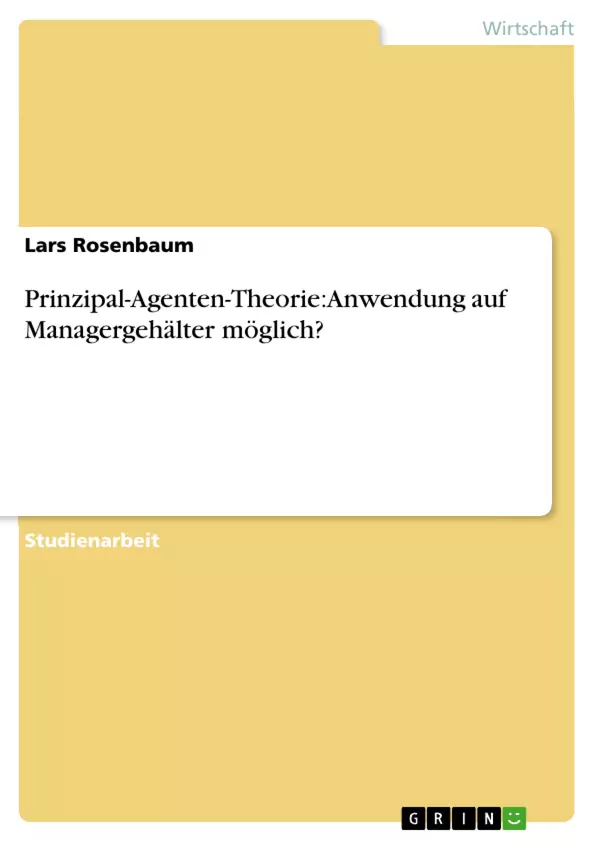"Bezahlt Manager wie Beamte!" lautet die Schlagzeile der FAZ vom 25.02.2008. Lange Zeit galt die variable Vergütung von Managern als unantastbar, da mit einer leistungsabhängigen Entlohnung der Gedanke einhergeht, dass Manager dann im Sinne der Aktionäre/Unternehmenseigner handeln. Aufgrund dessen sollten Manager nicht wie Bürokraten bezahlt werden, sondern nach ihrer Leistung, ähnlich wie Leistungssportler. Je mehr Leistung erbracht wird, umso höher ist das Gehalt. Allerdings ergeben sich daraus etwaige Probleme. Der umstrittene Leistungsbegriff wirft hierbei eines der größten Dilemmata auf. Häufig kann eine Leistung nicht nur einer Person und deren Performanz zugerechnet werden. Vielmehr stehen viele Individuen hinter einer Leistung, jedoch erhält nur eine Person die finanziellen Boni. Weiterhin ist der sogenannte Crowding-Out-Effect nicht zu vernachlässigen. Hiermit ist gemeint, dass die intrinsische Motivation durch externe Belohnungen abgeschwächt oder sogar gänzlich ausgelöscht wird. Dies kann wiederum zur Folge haben, dass Unternehmensverantwortlich nur noch den Blick zum Geld haben und entgegen dem Wohl aller, also für das Unternehmen, egoistisch und opportunistisch handeln (vgl. Beck 2008). Beim Nachgehen der Frage nach einer angemessenen Managervergütung, kann die Agenturtheorie Hinweise und Erklärungsmodelle geben, weswegen sie Thema dieser Hausarbeit ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Neue Institutionenökonomik
- Vorstellung und theoretische Grundlagen Agenturtheorie
- Grundlagen
- Grundgedanken
- Problemtypen der Agency-Beziehung
- Lösung der Agenturprobleme
- Kritik an der Agentur-Theorie
- Anwendung
- Forschungsinteresse
- Vorgehensweise/Methodik
- Ergebnisse
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht die Anwendbarkeit der Prinzipal-Agenten-Theorie auf die Vergütung von Managern. Sie analysiert die theoretischen Grundlagen der Agenturtheorie und prüft, ob deren Prinzipien auf die Praxis der Managervergütung übertragen werden können.
- Informationsasymmetrie zwischen Prinzipal und Agent
- Opportunistisches Verhalten von Agenten
- Anreizsysteme und deren Einfluss auf die Motivation von Managern
- Mangelnde Messbarkeit von Managerleistung
- Bedeutung nicht-finanzieller Anreize für Manager
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Hausarbeit vor und erläutert die Relevanz der Agenturtheorie für die Managervergütung. Sie zeigt die Herausforderungen auf, die sich aus der Differenz zwischen Leistung und Entlohnung ergeben.
Kapitel 2 führt in die Neue Institutionenökonomik ein und erläutert deren Kernaussagen sowie die Bedeutung von Institutionen für ökonomische Prozesse. Es werden wichtige Begriffe und Hypothesen der Neuen Institutionenökonomik vorgestellt, darunter die Nutzenmaximierung und das opportunistische Verhalten von Individuen.
Kapitel 3 erläutert die Agenturtheorie, insbesondere die Prinzipal-Agenten-Theorie. Es werden die Grundlagen der Theorie, die Grundgedanken, die Problemtypen der Agency-Beziehung und deren Lösungen dargestellt. Die Kritikpunkte an der Agenturtheorie werden ebenfalls beleuchtet.
Kapitel 4 stellt eine empirische Untersuchung zur Steuerung von Geschäftsführern vor. Es werden das Erkenntnisinteresse der Studie, die verwendete Methodik und die Ergebnisse der Forschung dargestellt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Anwendung der Agenturtheorie auf die Steuerung von Geschäftsführern problematisch ist, da die Motive von Geschäftsführern nicht nur durch finanzielle Anreize beeinflusst werden, sondern auch durch weiche Faktoren wie Entscheidungsfreiheit und Betriebsklima.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Prinzipal-Agenten-Theorie, Managervergütung, Informationsasymmetrie, Opportunismus, Anreizsysteme, Leistungsmessung und nicht-finanzielle Anreize. Die Hausarbeit analysiert die Anwendbarkeit der Agenturtheorie auf die Gestaltung von Managergehältern und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus der komplexen Beziehung zwischen Prinzipal und Agent ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernidee der Prinzipal-Agenten-Theorie bei Managergehältern?
Die Theorie untersucht das Verhältnis zwischen Eigentümern (Prinzipal) und Managern (Agent) und sucht nach Wegen, die Interessen beider durch Anreizsysteme in Einklang zu bringen.
Welche Probleme entstehen durch Informationsasymmetrie?
Da der Manager oft mehr über die internen Abläufe weiß als der Eigentümer, besteht das Risiko von opportunistischem Verhalten, bei dem der Manager seine eigenen Ziele verfolgt.
Was ist der 'Crowding-Out-Effect' bei der Vergütung?
Dies beschreibt das Phänomen, dass externe finanzielle Boni die intrinsische Motivation eines Managers schwächen oder sogar ganz verdrängen können.
Warum ist die Messbarkeit von Managerleistung so schwierig?
Häufig stehen ganze Teams hinter einem Erfolg, was es schwer macht, die Leistung einer einzelnen Person für finanzielle Boni exakt zu isolieren.
Welche Rolle spielen nicht-finanzielle Anreize für Geschäftsführer?
Studien zeigen, dass Faktoren wie Entscheidungsfreiheit, Betriebsklima und Status oft eine ebenso große Rolle spielen wie das Gehalt.
- Quote paper
- Lars Rosenbaum (Author), 2012, Prinzipal-Agenten-Theorie: Anwendung auf Managergehälter möglich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232692