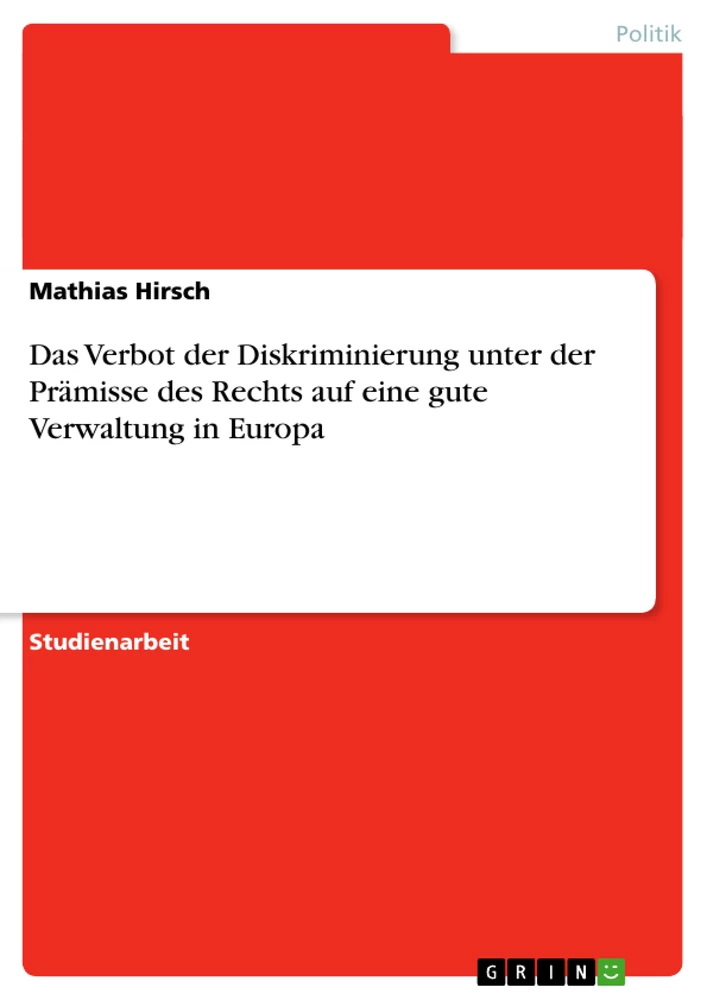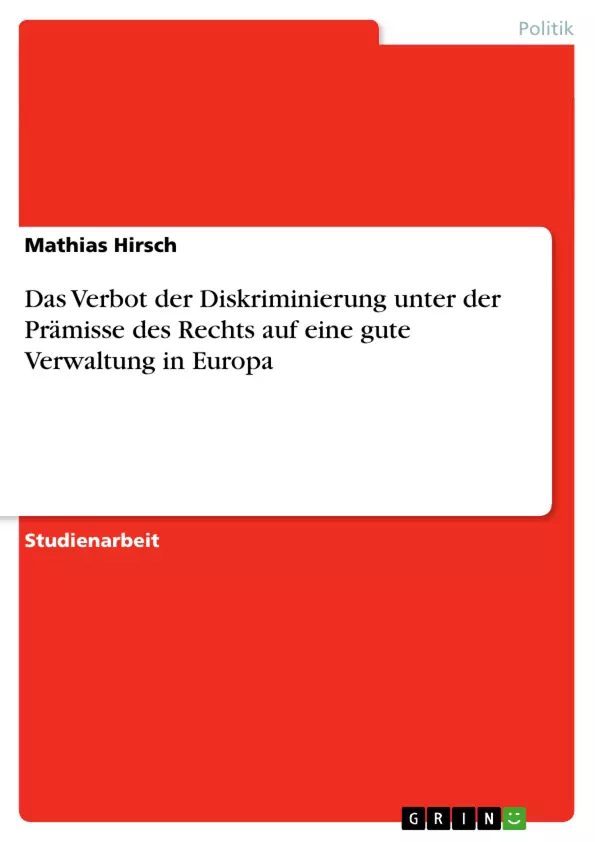Die Sozialpolitik der Europäischen Union findet mit dem Vertrag von Lissabon weitreichende normative Verankerungen. Artikel 2 des Vertrages über die europäische Union (EUV) besagt: „Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören.“ Auf diesen Werten basierend bekämpft die Union „…soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.“ Die Maßnahmen der europäischen Sozialpolitik umfassen dabei unter anderem die materiell-rechtliche Stellung der Bürger der Europäischen Union sowie strukturelle Instrumente.
Inhalt der Arbeit soll die Darstellung sein, inwieweit soziale Werte und Ziele der Europäischen Union in Bezug auf eine öffentliche Verwaltung der EU wirken können. Im Zusammenhang mit dem Recht auf eine gute Verwaltung soll das Verbot der Diskriminierung behinderter Menschen näher betrachtet werden.
Dazu erfolgt zunächst eine Kurzfassung der primären rechtlichen Grundlagen aus europarechtlicher Perspektive. Im Anschluss daran wird beispielhaft dargestellt, inwieweit dieses Recht auf eine gute Verwaltung im Fokus des Verbots der Diskriminierung behinderter Menschen gewahrt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Nichtdiskriminierung als Grundsatz guter Verwaltung
2.1 Das Recht auf eine gute Verwaltung
2.2 Das Verbot der Diskriminierung behinderter Menschen
3 Praxisbeispiel
4 Schlussbetrachtung
Quellenverzeichnis
1. Einleitung
Die Sozialpolitik der Europäischen Union[1] findet mit dem Vertrag von Lissabon weitreichende normative Verankerungen. Artikel 2 des Vertrages über die europäische Union (EUV)[2] besagt: „Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören.“ Auf diesen Werten basierend bekämpft die Union „…soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes.“[3] Die Maßnahmen der europäischen Sozialpolitik umfassen dabei unter anderem die materiell-rechtliche Stellung der Bürger der Europäischen Union sowie strukturelle Instrumente.[4]
Inhalt der Arbeit soll die Darstellung sein, inwieweit soziale Werte und Ziele der Europäischen Union in Bezug auf eine öffentliche Verwaltung der EU wirken können. Im Zusammenhang mit dem Recht auf eine gute Verwaltung soll das Verbot der Diskriminierung behinderter Menschen näher betrachtet werden.
Dazu erfolgt zunächst eine Kurzfassung der primären rechtlichen Grundlagen aus europarechtlicher Perspektive. Im Anschluss daran wird beispielhaft dargestellt, inwieweit dieses Recht auf eine gute Verwaltung im Fokus des Verbots der Diskriminierung behinderter Menschen gewahrt werden kann.
2. Nichtdiskriminierung als Grundsatz guter Verwaltungspraxis
Die EU hat sich mit Art. 3 Abs. 3 EUV zum Ziel gesetzt, die soziale Ausgrenzung und Diskriminierung zu bekämpfen, sowie die soziale Gerechtigkeit zu fördern. Eine auffallende Errungenschaft des Vertrages über die EU dürfte dabei die mit Art. 6 Abs. 1 EUV festgeschriebene Rechtsverbindlichkeit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) bilden. Entsprechendes gilt durch den in Art. 6 Abs. 2 EUV erfolgten Beitritt der EU zur Europäischen Konvention zum Schutz der Menschrechte und Grundfreiheiten (EMRK).
Mit diesem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV)[5] haben die Vertragsstaaten daneben in Art. 151 AEUV beschlossen, geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Ausgrenzung zu ergreifen. Zur Umsetzung dieser Ziele unterstützt die EU die Mitgliedsstaaten auf den in Art. 153 Abs. 1 AEUV genannten Gebieten[6]. Die EU erhält damit weitreichende sozialpolitische Kompetenzen.
Die o.g. Charta der Grundrechte bildet im Gegensatz zum deutschen Grundgesetz einen umfänglichen Grundrechte-Katalog ab. Zu diesen zählen insbesondere die Gleichheitsrechte aus den Artikeln 20 bis 26 GRC[7], welche folgende sind:
- Gleichheit vor dem Gesetz (Art. 20 GRC)
- Nichtdiskriminierung (Art. 21 GRC)
- Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen (Art. 22 GRC)
- Gleichheit von Frauen und Männern (Art. 23 GRC)
- Rechte des Kindes (Art. 24 GRC)
- Rechte älterer Menschen (Art. 25 GRC)
- Integration von Menschen mit Behinderung (Art. 26 GRC)
Daneben erscheinen auch die festgeschriebenen „Bürgerrechte“, zu denen das in Art. 41 Abs. 1 GRC beschriebene Recht auf eine gute Verwaltung zählt, beachtlich.
2.1 Das Recht auf eine gute Verwaltung
Nach Art. 41 Abs. 1 GRC hat jede Person ein Recht darauf, „dass ihre Angelegenheiten von den Organen und Einrichtungen der Union unparteiisch, gerecht und innerhalb einer angemessenen Frist behandelt werden.“
Zu diesen Rechten zählen insbesondere[8]:
- das Recht auf Anhörung vor Maßnahmenentscheidung
- das Recht auf Akteneinsicht
- die Pflicht der Verwaltung zur Begründung ihrer Entscheidung
[...]
[1] im Folgenden EU
[2] Vertrag über die Europäische Union (EUV), Amtsblatt der Europäischen Union, 30.03.2010; C 83/13 – C 83/46
[3] Vgl. Art. 3 Abs. 3 EUV
[4] Vgl. Beutler/Bieber/Pipkorn S. 448.
[5] Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), Amtsblatt der EU, 30.03.2010, C 83/47 – C 83/200
[6] z.B. „soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer“
[7] Vgl. http://www.emrk.at/grc.htm
[8] Vgl. Art. 41 Abs. 2 GRC
Häufig gestellte Fragen
Was beinhaltet das Recht auf eine gute Verwaltung in der EU?
Gemäß Art. 41 der EU-Grundrechtecharta hat jede Person das Recht, dass ihre Angelegenheiten unparteiisch, gerecht und innerhalb angemessener Frist behandelt werden.
Welche Pflichten hat die Verwaltung gegenüber dem Bürger?
Dazu gehören das Recht auf Anhörung, das Recht auf Akteneinsicht und die Pflicht der Behörde, ihre Entscheidungen zu begründen.
Wie schützt die EU behinderte Menschen vor Diskriminierung?
Art. 21 und 26 der Grundrechtecharta verbieten Diskriminierung aufgrund einer Behinderung und fordern die Integration in das soziale und wirtschaftliche Leben.
Was ist der Vertrag von Lissabon in Bezug auf Sozialpolitik?
Er verankert soziale Werte wie Menschenwürde, Gleichheit und den Schutz von Minderheiten als fundamentale Ziele der Europäischen Union.
Gilt das Diskriminierungsverbot auch für EU-Organe?
Ja, das Recht auf eine gute Verwaltung verpflichtet alle Einrichtungen und Organe der Union zur Einhaltung der Grundsätze der Nichtdiskriminierung.
- Citation du texte
- Mathias Hirsch (Auteur), 2013, Das Verbot der Diskriminierung unter der Prämisse des Rechts auf eine gute Verwaltung in Europa, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/232901