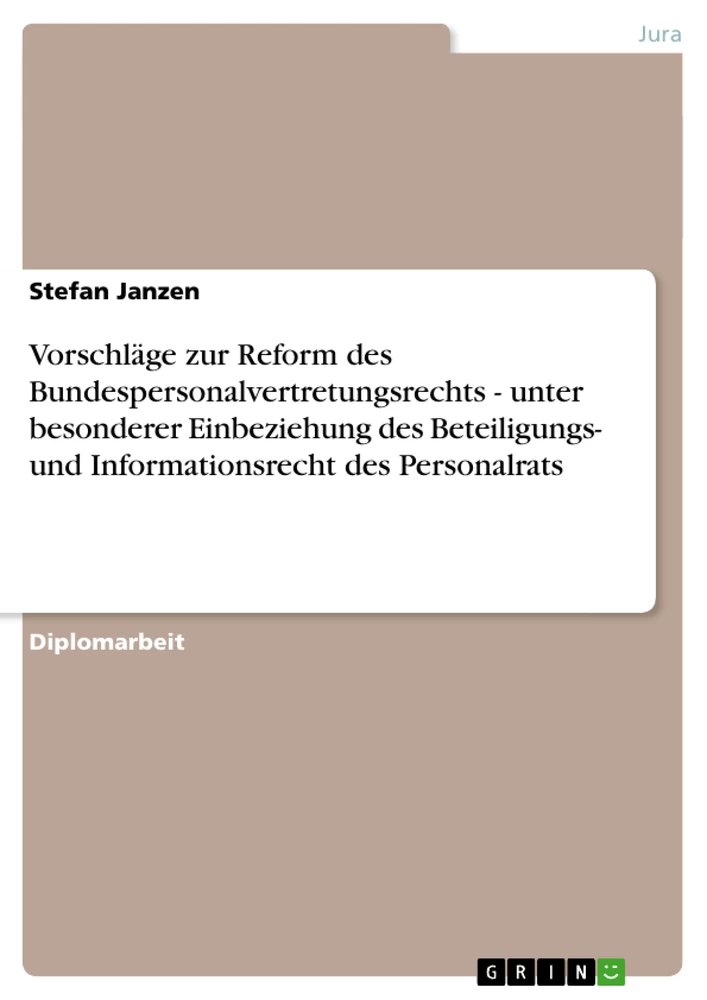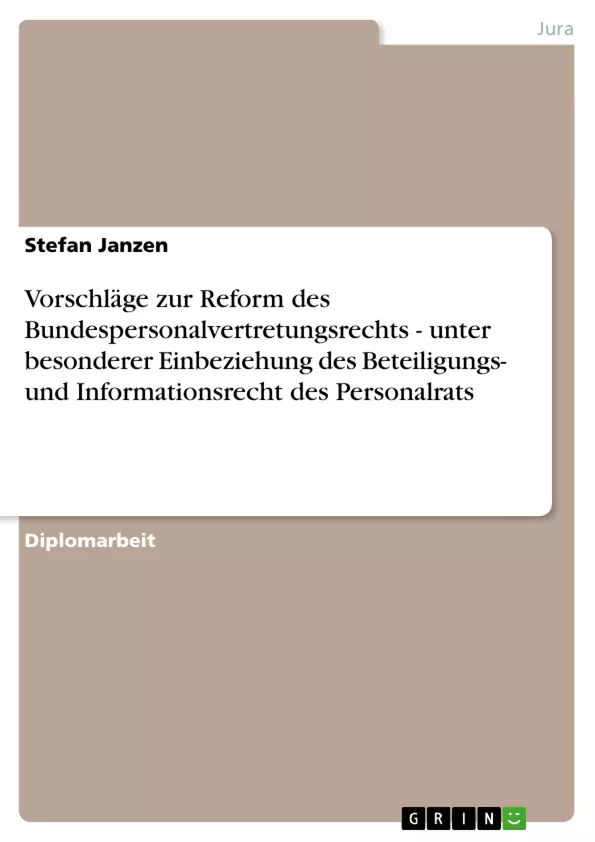Auszüge aus der Einleitung:
Die Landesregierung Schleswig-Holsteins hat im Jahr 1990 den Versuch unternommen, im Bereich der Mitbestimmung des Öffentlichen Dienstes neue Wege zu gehen. Mit Verabschiedung des Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein alter Fassung (MBG Schl.-H. a.F.) am 27.11.1990 wurde dem Gesetz nicht nur eine neue Bezeichnung gegeben sondern im Schwerpunkt dem Personalrat weitergehende Beteiligungsrechte verliehen. Es handelt sich dabei um eine Konzeption, die effektive und paritätische Beteiligung von Personalvertretungen ermöglichen soll. Geprägt von sog. Allzuständigkeit wird das Ziel verfolgt, bei allen Maßnahmen ein nahezu gleichberechtigtes Miteinander zwischen Dienststelle und Personalrat, unter Berücksichtung des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Umfeldes zu ermöglichen.
In der politischen Landschaft war dieses Gesetz nicht unumstritten und so haben 282 Abgeordnete des Deutschen Bundestages von CDU/FDP einen Normenkontrollantrag beim BVerfG gestellt.
Der Entscheid des 2. Senats des BVerfG zum MBG Schl.-H. a.F. wurde in allen Kreisen mit Spannung erwartet. Insbesondere inwieweit dem Modernisierungsgedanken Schleswig-Holsteins Rechnung getragen wird und ob ein gangbarer Weg besteht, Formen der Betriebsverfassung in den Öffentlichen Dienst zu integrieren. So war die Verwunderung besonders bei denen groß, die sich für Reformen, Modernisierungen und infolgedessen für das MBG Schl.-H. a.F. ausgesprochen haben. Denn der 2. Senat hat das Gesetz in wesentlichen Teilen als verfassungswidrig eingestuft.
Der Entscheid wurde in vielfach trefflicher Weise kommentiert und kritisiert; darum soll es in dieser Arbeit nicht gehen. Vielmehr hat mich der Titel „Grenzen der Mitbestimmung im Öffentlichen Dienst“ zu der Überlegung geführt, ob es gerade in Zeiten von Modernisierung und Umbruch richtig ist, etwas als unüberwindbar und unveränderbar zu bezeichnen und sich damit zufrieden zu geben. Der Kern dieser Arbeit besteht demnach aus der Frage, wie eine Beteiligung und Mitbestimmung des Personalrats nach dem BPersVG zukünftig aussehen kann, verfassungskonform ist und darüber hinaus einer modernen Verwaltung entspricht. Mein Ziel ist es, mit dieser Arbeit die Mitbestimmungsmöglichkeiten und -formen im Öffentlichen Dienst konkret zu definieren und, bezogen auf das BPersVG, Reformansätze für eine grundlegende Neudefnition der Beteiligung, die sich im Rahmen der Rechtsprechung des BVerfG bewegen, aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- BVerfGE 93, 37 zum MBG Schl.-H. a.F. als Grundlage einer Novellierung des BPersVG
- Intention der Antragsteller
- Allgemein festgestellte Grenzen
- Allgemeinpolitisches Mandat
- Gewerkschaftliche Mitbestimmung
- Mitbestimmung in Abhängigkeit zur Arbeitssituation, Dienstverhältnis und Amtsauftrag
- Das Demokratieprinzip als tragendes Argument des BVerfG oder Ausübung von Staatsgewalt, die demokratische Legitimation bedarf
- Legitimationsvoraussetzung
- Personell-organisatorische Legitimation
- Sachlich-inhaltliche Legitimation
- Legitimationsdefizite der Personalräten und Einigungsstellen nach dem MBG Schl.-H. a.F.
- Personalräte
- Einigungsstellen
- Aufgezeigte Grenzen
- Schutzzweckgrenze
- Verantwortungsgrenze
- Legitimationsstufen
- Fallgruppe A
- Fallgruppe B
- Fallgruppe C
- Die Allzuständigkeit der Personalvertretung
- Auftrag des BVerfG zu Reformen
- Konkreter Handlungsauftrag der Legislative in Bund und Ländern
- Bindungswirkung und Normwiederholungsverbot von Verfassungsrechtsprechung
- Inhalt und Auswirkungen der Bindungswirkung nach § 31 Abs. 1 BVerfGG
- Bindungswirkung
- Normwiederholungsverbot
- Bindende Bestandteile des BVerfGE 93, 37 für den Bundesgesetzgeber
- Tragende Gründe
- Tenor
- Legitimation als Teil der Verwaltungsinnovation und Beschäftigtenbeteiligung
- Personal als sensibles Steuerungsinstrument
- Von der Misstrauens- zur Vertrauenskultur
- Ernennungslegitimation
- Besetzung der Einigungsstelle
- Reformansatz 1
- Beteiligungs- und Informationsrechte
- Kooperative Demokratie in der öffentlichen Verwaltung als Ergänzung zur Mitbestimmung und Mitwirkung
- Modernisierungs-Verbot der Mitbestimmung
- Grundsätze der Beteiligung
- Definition der Mitbestimmung
- Allzuständigkeit
- Verfassungsrechtliche Betrachtung
- Modifizierte Allzuständigkeit in Abwägung zum Enumerativprinzip
- Reformansatz 2
- Mitbestimmung konkret
- Legitimationsstufen - Fallgruppen A - C
- Tatbestandszuordnung nach Definition des BVerfG
- Fallgruppe A
- Fallgruppe B
- Fallgruppe C
- Materielle Bestimmung der Fallgruppen
- Exkurs: Berücksichtigung der Rechtsprechung im Wandel der Zeit
- Abgrenzung, Letztentscheidung, Evokation
- Tatbestand der Mitwirkung
- Abgrenzungsdefinition Fallgruppe A
- Neudefinition der Fallgruppen
- Mitwirkungsrechte als Teil der Mitbestimmung
- Pauschaler Ausschluss der vollen Mitbestimmung den Rechtsstatus der Beschäftigten betreffend
- Grundlagen des Bundesgesetzgebers für die Abgrenzung personeller Maßnahmen
- Reformansatz 3
- Fallgruppe A- Letztentscheidungsrecht der Einigungsstelle
- Institutionelle Beteiligung
- Tatbestände
- Zuordnungsüberprüfung weiterer Tatbestände
- Zwischenergebnis: Tatbestände der Institutionellen Beteiligung
- Personelle Beteiligung
- Tatbestände
- Zwischenergebnis: Tatbestände der Personellen Beteiligung
- Reformansatz 4
- Initiativrecht
- Reformansatz 5
- Effizienzsicherung des Verwaltungshandelns
- Zustimmungs- und Aufhebungsfristen
- Beschlussfristen der Personalräte
- Beschlussfristen der Einigungsstelle
- Aufhebungsfristen für Beschlüsse
- Stufenverfahren
- Eilentscheidungen
- Unterlassungsanspruch
- Reformansatz 6
- Versagungs- und Widerspruchsrechte der Personalvertretung
- Reformansatz 7
- Weitere Auswirkungen auf das BPersVG
- Beteiligungsrechte im Lichte der Verwaltungsmodernisierung
- Vereinbarungen mit den Gewerkschaften
- Modernisierungsvereinbarungen
- Informationsrechte der Beschäftigten
- Informations-, Beteiligungs- und Qualifikationsrechte der Personalräte
- Einfluss der Novellierung des BetrVG auf das BPersVG
- Ressourcenverantwortung - Wirtschaftsausschuss
- Beschäftigtenbegriff
- Reformansatz 8
- Rahmenregelung gem. § 104 BPers VG
- Reformansatz 9
- Fazit
- Zusammenfassendes Ergebnis
- Legitimation der Personalvertretung
- Beteiligungs- und Informationsrecht des Personalrats
- Verwaltungsmodernisierung
- Effizienz des Verwaltungshandelns
- Reform des Bundespersonalvertretungsrechts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit Vorschlägen zur Reform des Bundespersonalvertretungsrechts, wobei der Fokus auf dem Beteiligungs- und Informationsrecht des Personalrats liegt. Die Arbeit analysiert die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zum Mitbestimmungsrecht und deren Implikationen für eine Neugestaltung des Bundespersonalvertretungsgesetzes (BPersVG). Ziel ist es, die Legitimation der Personalvertretung im Kontext von Verwaltungsmodernisierung und Beschäftigtenbeteiligung zu stärken und die Effizienz des Verwaltungshandelns zu gewährleisten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Analyse des BVerfGE 93, 37 zum Mitbestimmungsrecht des Personalrats im MBG Schleswig-Holstein. Es werden die Intentionen der Antragsteller, die festgestellten Grenzen des Mitbestimmungsrechts und die Legitimationsdefizite der Personalräte und Einigungsstellen beleuchtet. Anschließend wird der konkrete Handlungsauftrag des BVerfG an die Legislative in Bund und Ländern dargestellt. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung der Legitimation der Personalvertretung im Kontext von Verwaltungsmodernisierung und Beschäftigtenbeteiligung. Es wird die Notwendigkeit einer Vertrauenskultur gegenüber den Beschäftigten im öffentlichen Dienst betont. Die Arbeit erörtert die Bedeutung von Beteiligungs- und Informationsrechten im Rahmen einer kooperativen Demokratie in der öffentlichen Verwaltung. Die Allzuständigkeit der Personalvertretung wird unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Betrachtung und im Kontext der Modernisierung des BPersVG diskutiert. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Fallgruppen der Mitbestimmung, ihre Abgrenzung und die jeweiligen Handlungsmöglichkeiten der Personalvertretung. Es werden konkrete Reformansätze zur Verbesserung der Effizienz des Verwaltungshandelns und zur Stärkung der Rechte der Personalvertretung vorgeschlagen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Mitbestimmung, Informationsrecht, Beteiligung, Verwaltungsmodernisierung, Legitimation, Personalvertretung, Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG), Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Einigungsstelle, Fallgruppen, Effizienz und Reform. Die Arbeit befasst sich mit dem Spannungsfeld zwischen Mitbestimmung und Verwaltungsmodernisierung und analysiert die Rechtsprechung des BVerfG zum Mitbestimmungsrecht des Personalrats.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das BPersVG?
Das Bundespersonalvertretungsgesetz regelt die Mitbestimmung und Beteiligung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes durch Personalräte.
Warum wurde das Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein (a.F.) gekippt?
Das Bundesverfassungsgericht stufte es 1995 als teilweise verfassungswidrig ein, da es die Letztentscheidungsgewalt der demokratisch legitimierten Amtswalter durch paritätische Einigungsstellen zu stark einschränkte.
Was bedeutet das Demokratieprinzip für den Personalrat?
Jede Ausübung von Staatsgewalt muss auf das Volk zurückführbar sein. Personalräte haben eine andere Legitimation als die Dienststellenleitung, was Grenzen bei der Mitbestimmung setzt.
Was sind die vorgeschlagenen Reformansätze?
Die Arbeit schlägt unter anderem vor, Beteiligungsrechte nach Legitimationsstufen zu differenzieren, Informationsrechte zu stärken und moderne kooperative Demokratieformen zu integrieren.
Welche Rolle spielt die Einigungsstelle?
Die Einigungsstelle entscheidet bei Konflikten zwischen Dienststelle und Personalrat. Ihre Zusammensetzung und Befugnisse müssen verfassungskonform gestaltet sein, um das Verantwortungsprinzip der Verwaltung nicht zu verletzen.
- Quote paper
- Stefan Janzen (Author), 2002, Vorschläge zur Reform des Bundespersonalvertretungsrechts - unter besonderer Einbeziehung des Beteiligungs- und Informationsrecht des Personalrats, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23318