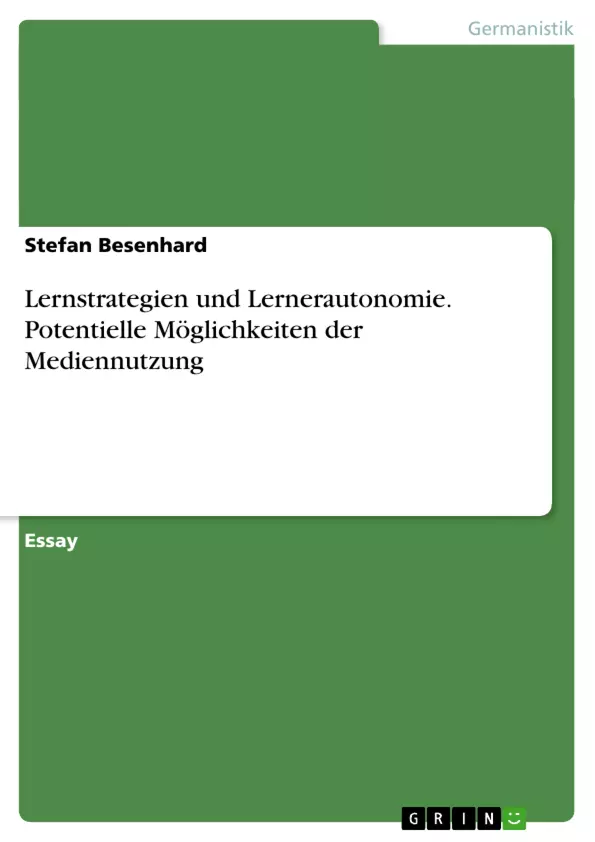Diese Arbeit beschäftigt sich im wesentlichen mit der Nutzung verschiedener Medien zum selbständigen Lernen. Dabei wird neben der DVD und der Musik vor allem auch auf das vernachlässigte Medium der Pc- und Videospiele eingegangen werden, um einen neuen Denkansatz zu liefern.
1. Einführung
Unsere Welt steht im Zeichen der Globalisierung. Diese Tatsache ist weder zu leugnen, noch wegzudiskutieren. In der Ökonomie tauchen immer wieder Begriffe wie „Global Player“ auf, oder es ist von Internationaler Arbeitsteilung die Rede. Die Welt wächst zusehends zusammen. Was vor hundert Jahren noch schier unvorstellbare Distanzen zu sein schienen, werden heute tagtäglich in wenigen Stunden überbrückt. Ähnlich verhält es sich auch mit der, zumindest so beabsichtigten, Internationalisierung der Studiengänge als Resultat des Bologna-Prozesses. Die Globalisierung schlägt in allen Bereichen und Teilgebieten des Lebens zu. Nie zuvor waren Fremdsprachenkenntnisse in Arbeit und Alltag so wichtig, wie dies heute der Fall ist. Tendenz weiter steigend. Aus Zeitmangel und vor allem wenn Fremdsprachenkenntnisse nur in bedingtem Maße erforderlich sind, greifen Lernwillige immer häufiger selbst auf Lehrbücher oder auditive bzw. audiovisuelle Medien zurück. Der Umsatz im Verkauf dieser Lernhilfen, der sich hier proklamieren lässt, spricht für sich. Doch nicht nur um sich selbst rudimentäre Kenntnisse einer Sprache anzueignen werden gewisse autodidaktische Lernmethoden herangezogen. Selbst Studenten, Schüler, Kinder, Jugendliche, Erwachsene jeden Alters, die von einer lehrenden Person betreut werden, lernen, wenn sie alleine sind, in gewissem Sinne autonom. In diesem Essay soll kurz auf verschiedene potentielle Lernstrategien eingegangen werden. Auf Grund der Kürze der Arbeit sollen sie nur überblicksweise vorgestellt werden, um den Rahmen nicht zu sprengen. Trotz allem sollen sie in sich geschlossen präsentiert werden und keinen fragmentarischen Charakter besitzen.
Lerner sollen zur Reflexion über ihr eigenes Lernverhalten angeregt werden und ihnen sollen Möglichkeiten zu ökonomischen und effektiven Lernstrategien eröffnet werden, die teilweise nicht bekannt, teilweise nicht mehr präsent im Gedächtnis verankert sind.
2. Lernstrategien: eine mögliche Definition
Eine universell gültige Definition für Fertigkeiten und Fähigkeiten, die sich unter dem Begriff Lernstrategie zusammenfassen lassen, erweist sich als problematisch. Da auch in der Wissenschaft noch keine Einigung auf eine allgemeingültige definitorische Begriffsbestimmung stattgefunden hat, wird der Begriff wie folgt an essentiellen Merkmalen bestimmt. Offensichtlich findet der Einsatz von Lernstrategien bei Lernern, die als strategisch charakterisierbar sind, ganz bewusst statt. Sie können ihre Lernhandlungen beschreiben und diese ebenso begründen. Ein bewusster Umgang mit den eigenen Vorgehensweisen und der Materie der zu lernenden Sprache erscheint als charakteristisch. Lernstrategien müssen sowohl als beobachtbares Verhalten, als auch als mentale Handlungspläne verstanden werden. Dabei kann es sich bei beobachtbaren Strategien um so etwas Pragmatisches wie soziale Interaktion handeln. In diese Kategorie lässt sich zum Beispiel die Bitte um Hilfe bei der Lösung einer Lernaufgabe oder die Bildung sogenannter Lerngruppen verordnen. Ebenso fallen affektive Strategien in dieses Spektrum des Lernverhaltens. Damit ist zum Beispiel gemeint, sich nach einem erreichten Lernerfolg angemessen für die erbrachte Leistung zu belohnen. Mentale Prozesse spiegeln dagegen eher kognitive Strategien, wie die Vorgehensweise zum Erlernen von Wortschatz oder metakognitive Strategien wie die Planung einer Lernhandlung wieder.
Im Bezug auf den Bereich der Motivation kann davon ausgegangen werden, dass durch einen verbesserten Lernerfolg durch angewandte Lernstrategien in diesem Bereich ein positives Feedback erreicht werden kann.
3. Moderne Medien – eine Chance für autonomes Lernen?
Im Folgenden sollen exemplarisch Lernstrategien herausgegriffen und in einem knappen Rahmen erläutert werden. Besonders soll hier auf visuelle Strategien beim Lehren und Lernen von Fremdsprachen eingegangen werden. Häufig werden visuelle Lernstrategien nur als Ergänzung oder einfach im Bezug auf Alteritätserfahrungen sporadisch in den Unterricht eingebunden. Dadurch finden sie auch wenig Einzug in individuelle Lernstrategien. Was in der Sportwissenschaft schon lange als gängiges Faktum gilt und sogar bei den Übungsleitern der meisten Vereine bekannt ist, wird in der Fremdsprachenlehre häufig ignoriert. Kinder und jüngere Jugendliche lernen vor allem durch Optik, also visuellen Einsatz von Medien oder schlicht und einfach durch Nachahmung, weniger verbal. Visuelle und haptische Lerntypen überwiegen also gegenüber dem Typus des akustischen Lerners. Anfängliches Lernen einer Fremdsprache in späteren Altersstufen, besonders aber Fremdsprachenlernen im Kindesalter ist ohne ausreichende Verbindung mit visuellen Wahrnehmungen ungemein erschwert. Dabei erfüllt visuelles Erleben eine Vielzahl anderer Faktoren. So können zum Beispiel DVDs vorzugsweise mit den fremdsprachlichen Untertiteln sowohl im Unterricht als auch als Mittel autonomen Lernens zu Hause herangezogen werden. Die Verbindung von gehörter Sprache und den dazugehörigen fremdsprachlichen Untertiteln erwies sich in der Praxis als besonders gut, um Wortschatz und grammatisches Wissen zu erweitern. Diese audiovisuelle Umsetzung spricht den Lerner auf mehreren Ebenen an und führt zu einer tieferen kognitiven Verankerung des Gehörten und Gelesenen, also sprich zu einem besseren Lernergebnis. Die manchmal schwer verständliche Akustik auf Grund authentischer Prosodie der Sprecher wird durch den Untertitel aufgehoben und so nicht zum Problem. Bei steigender Fertigkeit kann auf den Untertitel verzichtet werden. Zum anderen wird dem Lerner auch eine Konnektivität zwischen Sprache, Mimik und Gestik vermittelt. Unbekannte Ausdrücke und Paradigmen lassen sich teilweise durch Handlungen oder die eben aufgegriffene Mimik und Gestik erschließen. So wird kein steriles Bild der Fremdsprache vermittelt, sondern sie wird unmittelbar in ihr soziokulturelles Umfeld eingebettet und somit als lebende, aktive und praktische Sprache erkannt und vermittelt.
In diesem Zusammenhang wird das Augenmerk auf ein weiteres Medium gerichtet, dass das audiovisuelle Erleben anspricht und zugleich sehr präsent ist, im Unterricht aber strikt ignoriert wird. Diese scheinbare Antonymie bedarf einer Erklärung. Sie bezieht sich auf das Medium der Computer- und Videospiele. Wegen diversen Amokläufen stets als Sündenbock präsentiert, nahm das negative Image kurzzeitig überhand bei gleichzeitigem Mangel an objektiver Berichterstattung. Nicht die ganze Welt der Computer- und Videospiele besteht aus den so häufig zitierten „Killerspielen“. Im Folgenden wird von dieser populär-medienwirksamen Ausdrucksweise Abstand genommen und die korrekte Bezeichnung Ego-Shooter verwendet. Neben diesem Genre gibt es noch eine Vielzahl anderer Spiele, die sich in Sport-, Action-, Adventurespiele etc. diffizil unterscheiden lassen.
Im Rahmen dieser Untersuchung kann vor allem das Feld der sogenannten Rollenspiele einen wertvollen Beitrag zum Spracherwerb leisten. Oft in einem Mittelalter- oder einem Pseudomittelalter-Setting mit fantastischen Elementen angesiedelt, zeichnen sich diese Spiele durch enorme Textmengen und eine epische Geschichte aus, die so manchen derzeitigen Hollywood-Blockbuster in den Schatten stellen. Allein die Tatsache, dass Jugendliche solche enormen Textmengen mit Freude und Eifer lesen, ist bemerkenswert. Ähnlich wie bei DVDs ist es bei heutigen Spielen fast immer möglich zwischen mehreren Sprachen zu wählen, die die Figuren im Spiel sprechen. Ebenso aus der Filmwelt ist der sogenannte Untertitel übernommen worden. Also kann genauso wie bei einer DVD die Zielsprache als Sprache im Spiel gewählt werden und zusätzlich der Untertitel aktiviert werden. Die positiven Effekte sind praktisch identisch mit denen, die beim Ansehen eines Films auftreten. Doch durch die Interaktivität wird eine ganz eigene Atmosphäre geschaffen, die den Spieler in seinen Bann zieht und in höchstem Maße motivierend ist. Das zeigt sich allein dadurch, wie viel Zeit Jugendliche und Kinder in ihren virtuellen Parallelwelten verbringen. Verschiedene Antwortmöglichkeiten, die im Multiple-Choice-Stil gehalten sind, ermöglichen es dem Spieler auch selbst im kommunikativen Rahmen des Spiels aktiv zu werden. Besonders hervorzuheben sind dabei Spiele der letzten Jahre, wie „Knights of the old Republic“ oder „Mass Effect“ die multilinear gestaltet sind und somit einen ganz eigenen Reiz auf den Spieler auswirken, da die Antworten, die er in seinem virtuellen Gespräch auswählt unmittelbare Auswirkungen auf die Geschichte haben. Diese Interaktivität bringt einen Spieler förmlich dazu, aus eigenem Antrieb und völlig autark alle möglichen Antwort- und Gesprächsmöglichkeiten verstehen zu wollen. Eine unhöfliche oder der Situation inadäquate Antwort kann im schlimmsten Fall den Bildschirmtod des Protagonisten bedeuten. Dies ist ein unbestreitbarer Vorteil gegenüber Filmen, da falls eine Passage nicht verstanden wurde, nicht jedes Mal der Film angehalten und zurückgespult werden muss. Oft wird im Film-Genre die nicht verstandene Szene einfach geistig abgehakt und übergangen, da man sich ja auf die gegenwärtig stattfindenden Gespräche konzentrieren muss. Im Falle von Computer- und Videospielen richtet sich das Gesprächstempo meist nach dem Spieler, da er Gesprächsteile und die dazugehörigen Textpassagen mit einem Mausklick einleitet, beziehungsweise sie häufig auch anhalten oder sogar noch einmal anhören kann.
[...]
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Lernerautonomie?
Lernerautonomie bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft eines Lernenden, den eigenen Lernprozess selbstständig zu planen, zu steuern und zu evaluieren.
Können Videospiele beim Fremdsprachenlernen helfen?
Ja, besonders Rollenspiele mit großen Textmengen und interaktiven Dialogen fördern den Wortschatz und das Leseverständnis auf hochmotivierende Weise.
Welche Vorteile bietet die Nutzung von DVDs mit Untertiteln?
Die Kombination aus Hören und Mitlesen in der Zielsprache verankert Vokabeln und grammatikalische Strukturen tiefer im Gedächtnis und schult das Hörverstehen.
Warum sind visuelle Strategien beim Sprachenlernen so effektiv?
Viele Lerner sind visuelle Typen. Die Verbindung von Sprache mit Mimik, Gestik und Handlungen in Filmen oder Spielen hilft, unbekannte Ausdrücke aus dem Kontext zu erschließen.
Welchen Einfluss hat die Globalisierung auf das Sprachenlernen?
Durch die weltweite Vernetzung sind Fremdsprachenkenntnisse in Beruf und Alltag essenziell geworden, was den Bedarf an autonomen und flexiblen Lernmethoden erhöht hat.
- Citar trabajo
- Stefan Besenhard (Autor), 2010, Lernstrategien und Lernerautonomie. Potentielle Möglichkeiten der Mediennutzung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/233454