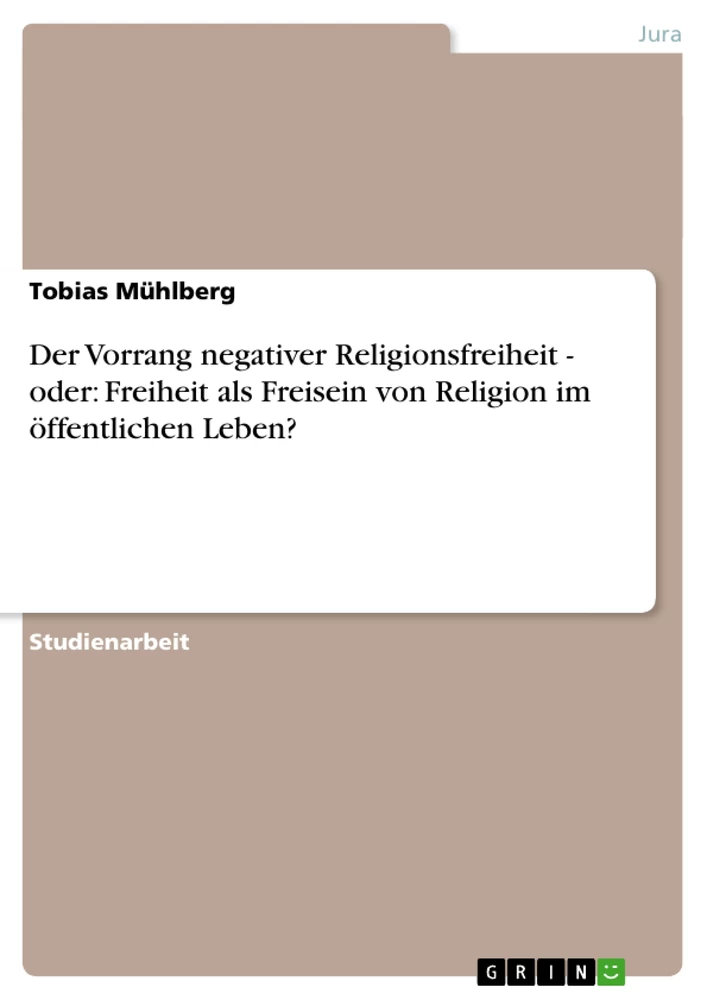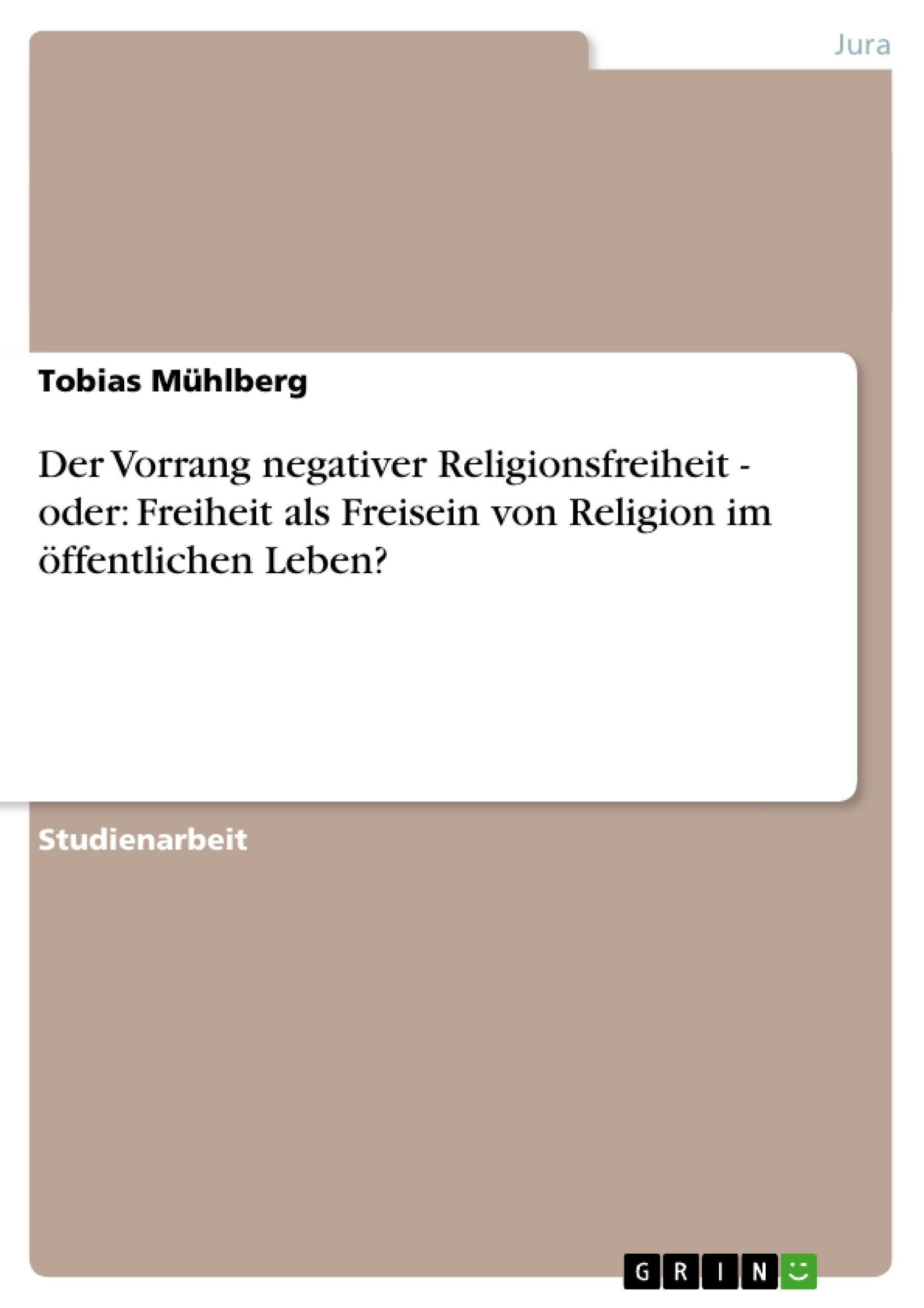Dem Grundrecht der Religionsfreiheit kommt in einem pluralistischen Staat, wie es die
Bundesrepublik Deutschland ist, eine überragend e Stellung zu. Nur indem das Recht, einen
eigenen Glauben zu haben und auch zu leben, als individuelles und als kollektives Recht1
existiert, können verschiedene Glaubensrichtungen nebeneinander bestehen und sich
entfalten. Dass sich daraus jedoch Probleme ergeben, liegt auf der Hand. Nicht nur dass die
Anhänger zwei verschiedener religiöser Gruppen mit dem Glaubensleben der jeweils anderen
religiösen Richtung konfrontiert sind, sondern auch dass der nicht an Religion interessierte
Bürger im öffentlichen Leben kontinuierlich den Folgen und Auswirkungen der ihren
Glauben lebenden Gläubigen begegnet, stellt Reibungspunkte dar. Das Glockenläuten, 2 die
Gottesdienstübertragungen im Radio, und natürlich das umstrittene Kreuz in bayerischen
Klassenzimmern sind hier als Beispiele zu nennen.
Dieser Problematik soll in der vorliegenden Hausarbeit nachgegangen werden. Es ist zu
untersuchen, ob die negative Religionsfreiheit einen Vorrang besitzt und ob sich der
nichtgläubige Bürger auf Freiheit als Freisein von Religion im öffentlichen Leben berufen
kann. Um diese Fragen zu klären, ist es notwendig, die Bedeutung der Religionsfreiheit in der
Bundesrepublik Deutschland zu erörtern und die Trennung von Staat und Kirche zu
betrachten. Mit einer Fallbetrachtung wird auf die Rechtsprechung bezüglich der negativen
Religionsfreiheit eingegangen, wobei von grundlegenden Prinzipien der Entscheidung des
BVerfG zum Schulgebet ausgehend der Schwerpunkt auf dem umstrittenen Kruzifix-
Beschluss liegen soll, denn während noch in den siebziger Jahren das BVerfG mit seinem
Urteil zur christlich geprägten Gemeinschaftsschule einem Vorrang der negativen
Religionsfreiheit eine klare Absage erteilte, weist die Kruzifix-Entscheidung eine Betonung
der negativen Religionsfreiheit auf.3 Das Gericht versucht mit mehreren Gründen den erteilten
Vorrang zu begründen. Diese Gründe sind auf ihre Stichhaltigkeit zu prüfen.
1 Campenhausen, in: HdbStR der Bundesrepublik Deutschland, Bd. VI, 1989, S. 370 ff. (370).
2 BVerwGE 68, S. 62 ff.
3 Rüfner, Staatskirchenrecht und gesellschaftlicher Wandel – Aktuelle Konfliktfelder zwischen Staat und Kirche,
KuR (1999), S. 73 ff. (73).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Trennung zwischen Staat und Kirche und die staatliche Neutralität
- 3. Die negative Seite von Freiheitsrechten
- 4. Die negative Religionsfreiheit in der Verfassung
- 4.1 Begriff und Inhalt der Religionsfreiheit
- 4.2 Begriff und Inhalt der negativen Religionsfreiheit
- 4.2.1 Die negative Glaubensfreiheit
- 4.2.2 Die negative Bekenntnisfreiheit
- 4.2.3 Die negative Religionsausübungsfreiheit
- 4.3 Grenzen des Schutzbereichs der negativen Religionsfreiheit
- 5. Die negative Religionsfreiheit in der Rechtsprechung
- 5.1 Wichtige Aussagen des BVerfG zum Schulgebet
- 5.2 Das Kreuz im Klassenzimmer
- 5.2.1 Der Schutzbereich der negativen Religionsfreiheit
- 5.2.2 Die Bedeutung des Kreuzes
- 5.2.3 Verletzung der staatlichen Neutralität?
- 5.2.4 Eingriff in den Schutzbereich?
- 5.2.5 Die Abwägung zwischen positiver und negativer Religionsfreiheit
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Vorrang der negativen Religionsfreiheit im öffentlichen Leben Deutschlands. Sie beleuchtet die Frage, ob sich nicht-gläubige Bürger auf eine "Freiheit als Freisein von Religion" berufen können. Die Arbeit analysiert die Bedeutung der Religionsfreiheit in einem pluralistischen Staat, die Trennung von Staat und Kirche, und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu diesem Thema.
- Die Bedeutung der Religionsfreiheit in einem pluralistischen Staat
- Die Trennung von Staat und Kirche und staatliche Neutralität
- Der Begriff und Inhalt der negativen Religionsfreiheit
- Die Rechtsprechung des BVerfG zur negativen Religionsfreiheit (Schulgebet und Kruzifix)
- Die Abwägung zwischen positiver und negativer Religionsfreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der negativen Religionsfreiheit ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach deren Vorrang im öffentlichen Leben. Sie hebt die Herausforderungen hervor, die aus der Koexistenz verschiedener Glaubensrichtungen und der Position nicht-religiöser Bürger entstehen. Beispiele wie das Glockenläuten und das Kreuz im Klassenzimmer illustrieren die Reibungspunkte zwischen religiöser Praxis und der säkularen Öffentlichkeit. Die Arbeit kündigt die Analyse der Bedeutung der Religionsfreiheit, der Trennung von Staat und Kirche und die Untersuchung der Rechtsprechung des BVerfG an, mit besonderem Fokus auf den Kruzifix-Beschluss und dessen Begründung eines Vorrangs der negativen Religionsfreiheit.
2. Die Trennung zwischen Staat und Kirche und die staatliche Neutralität: Dieses Kapitel untersucht das Verhältnis von Staat und Kirche in Deutschland und die damit verbundene staatliche Neutralität als Garant für die Religionsfreiheit in einem pluralistischen Staat. Es beleuchtet die historische Entwicklung, beginnend mit der Reformation und Luthers "Zwei-Reiche-Lehre", die eine strikte Trennung von religiösen und weltlichen Angelegenheiten forderte. Trotz dieser historischen Wurzeln und der formalen Trennung bestehen noch heute Verbindungen zwischen Staat und Kirche, beispielsweise durch die Kirchensteuer. Das Kapitel betont die Unterscheidung zwischen dem "Rahmen" (gesetzliche Regelungen) und dem "Inhalt" (individuelle Glaubensausübung) und argumentiert, dass die Zusammenarbeit von Staat und Kirche nur im Rahmen der Neutralität bezüglich Glaubensfragen stattfinden darf.
Schlüsselwörter
Negative Religionsfreiheit, Religionsfreiheit, Staatliche Neutralität, Trennung von Staat und Kirche, Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Schulgebet, Kruzifix, Pluralismus, Glaubensfreiheit, Bekenntnisfreiheit, Religionsausübungsfreiheit.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Negative Religionsfreiheit im öffentlichen Leben Deutschlands
Was ist der Hauptfokus dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Vorrang der negativen Religionsfreiheit im öffentlichen Leben Deutschlands. Sie beleuchtet die Frage, ob sich nicht-gläubige Bürger auf eine "Freiheit als Freisein von Religion" berufen können und analysiert die Bedeutung der Religionsfreiheit in einem pluralistischen Staat, die Trennung von Staat und Kirche, und die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) zu diesem Thema.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bedeutung der Religionsfreiheit in einem pluralistischen Staat, die Trennung von Staat und Kirche und staatliche Neutralität, den Begriff und Inhalt der negativen Religionsfreiheit, die Rechtsprechung des BVerfG zur negativen Religionsfreiheit (insbesondere Schulgebet und Kruzifix), und die Abwägung zwischen positiver und negativer Religionsfreiheit.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einleitung, die die Thematik und Forschungsfrage einführt. Es folgen Kapitel zur Trennung von Staat und Kirche, zur negativen Religionsfreiheit (inkl. Definition und Grenzen), zur Rechtsprechung des BVerfG (mit Fokus auf Schulgebet und Kreuz im Klassenzimmer) und schliesst mit einer Zusammenfassung.
Welche Rolle spielt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG)?
Die Rechtsprechung des BVerfG spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit analysiert wichtige Entscheidungen des Gerichts, insbesondere im Hinblick auf das Schulgebet und das Kruzifix im Klassenzimmer. Diese Entscheidungen werden im Kontext der Abwägung zwischen positiver und negativer Religionsfreiheit untersucht.
Was versteht man unter negativer Religionsfreiheit?
Die negative Religionsfreiheit schützt vor staatlichen Eingriffen in die religiöse Freiheit. Sie beinhaltet die Freiheit, keiner Religion angehören zu müssen und nicht an religiösen Handlungen teilnehmen zu müssen. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Aspekte dieser Freiheit, wie die negative Glaubens-, Bekenntnis- und Religionsausübungsfreiheit.
Wie wird die Abwägung zwischen positiver und negativer Religionsfreiheit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen der Abwägung zwischen positiver (Recht, seine Religion auszuüben) und negativer Religionsfreiheit. Insbesondere die Entscheidungen des BVerfG zum Kruzifix im Klassenzimmer werden in diesem Zusammenhang analysiert, um zu zeigen, wie der Staat mit Konflikten zwischen diesen beiden Aspekten umgeht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Negative Religionsfreiheit, Religionsfreiheit, Staatliche Neutralität, Trennung von Staat und Kirche, Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Schulgebet, Kruzifix, Pluralismus, Glaubensfreiheit, Bekenntnisfreiheit, Religionsausübungsfreiheit.
Welche konkreten Beispiele werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit verwendet Beispiele wie das Glockenläuten und das Kruzifix im Klassenzimmer, um die Reibungspunkte zwischen religiöser Praxis und säkularer Öffentlichkeit zu verdeutlichen. Die detaillierte Analyse des Kruzifix-Beschlusses des BVerfG ist ein zentraler Punkt der Arbeit.
- Quote paper
- Tobias Mühlberg (Author), 2002, Der Vorrang negativer Religionsfreiheit - oder: Freiheit als Freisein von Religion im öffentlichen Leben?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23364