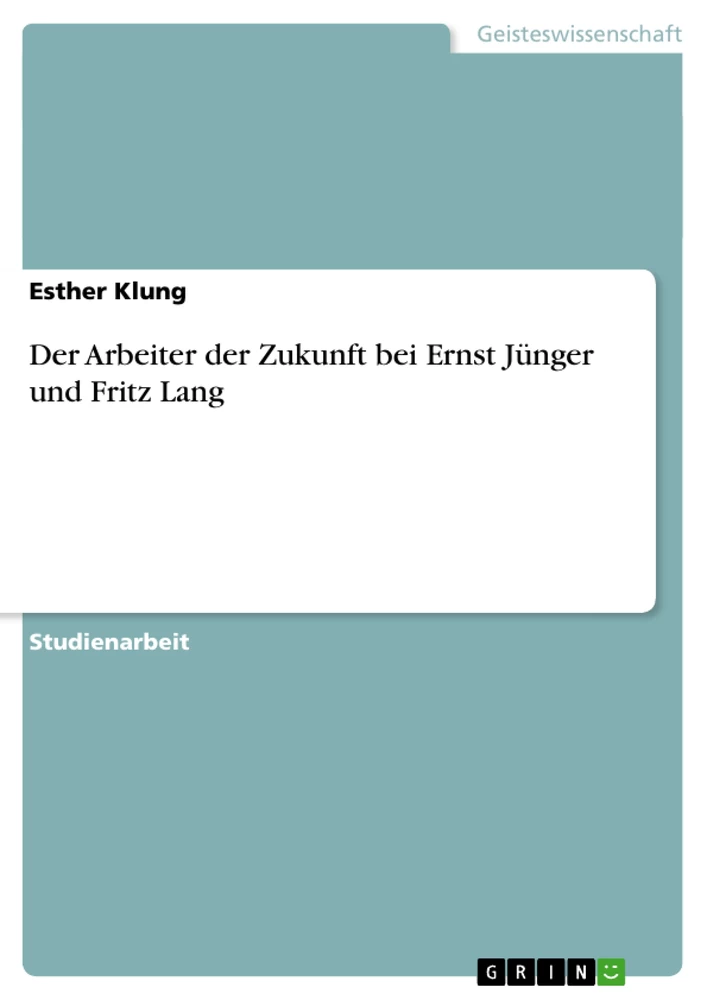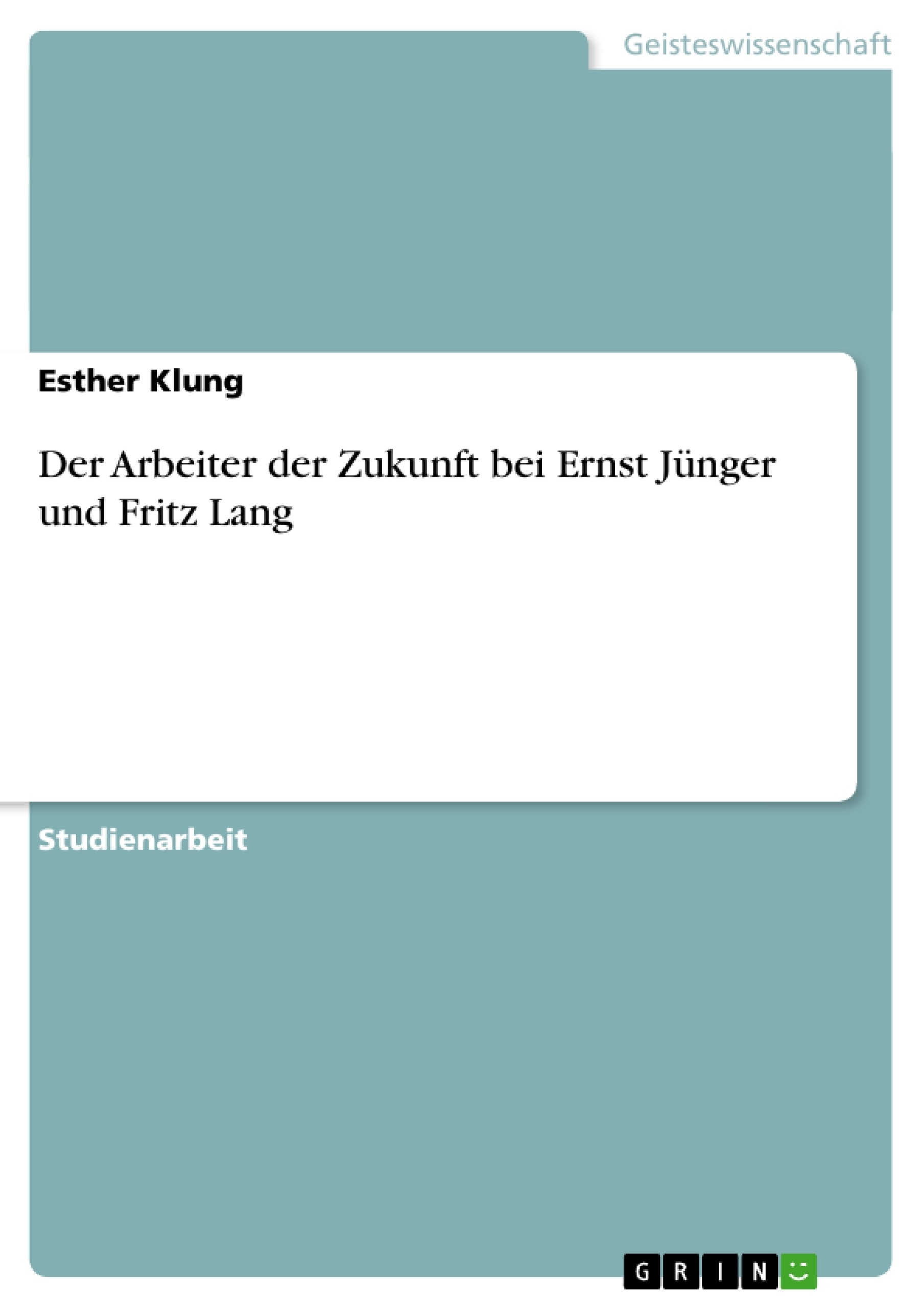Die vorliegende Arbeit versucht, einen Vergleich zwischen dem Film „Metropolis“ (1925) von Fritz Lang und dem Essay „Der Arbeiter“ (1930) von Ernst Jünger herzustellen. Nach kurzen inhaltlichen Zusammenfassungen und einigen Hintergrundinformationen zu den Personen, ihren Intentionen und der Zeit, soll dieser Vergleich anhand von Filmszenen und Zitaten angestellt werden. Dabei liegt der Schwerpunkt entsprechend des Seminarthemas bei dem Aspekt der Stellung des Arbeiters und der Erscheinungsform von Arbeit. Da sowohl Lang als auch Jünger aus ihrer Zeit heraus besonderes Interesse an der neuen Technik hatten, wird auch darauf ein Schwerpunkt liegen.
Natürlich gibt es viele weitere interessante Aspekt in Metropolis, die sich lohnen würden näher zu beleuchten, so zum Beispiel die Stellung der Frau, Religiosität und die Versöhnung von Kapital und Arbeit. Diese Punkte werde ich hier jedoch nur am Rande behandeln. Als Grundlage dieser Hausarbeit dient mir der Essay „Der Arbeiter“ von Ernst Jünger, der Film „Metropolis“ von Fritz Lang, sowie Sekundärliteratur, vor allem der englische Artikel „Machine Aesthetics and Dialektics of Modernity: On Fritz Lang`s Metropolis“. Der abschließende Vergleich unterliegt meiner eigenen Interpretation.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Metropolis
- Arbeiter
- Vergleich
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Beziehung zwischen Mensch und Maschine im Kontext des Films „Metropolis“ von Fritz Lang und dem Essay „Der Arbeiter“ von Ernst Jünger. Sie untersucht die Darstellung der Arbeiterklasse, die Rolle der Technik und die Auswirkungen des Kapitalismus auf die Gesellschaft. Dabei wird besonderer Fokus auf die Perspektive der Arbeiter und die Vision eines „Arbeiters der Zukunft“ gelegt.
- Die Darstellung der Arbeiterklasse in „Metropolis“ und „Der Arbeiter“
- Die Rolle der Technik und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft
- Der Einfluss des Kapitalismus auf die Beziehung zwischen Mensch und Maschine
- Die Vision eines „Arbeiters der Zukunft“
- Vergleich der Ansichten von Fritz Lang und Ernst Jünger
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit im Kontext des Films „Metropolis“ und des Essays „Der Arbeiter“ ein. Sie erläutert die Ziele der Arbeit und gibt einen kurzen Überblick über den Vergleichsrahmen.
Metropolis
Dieses Kapitel bietet eine kurze Inhaltsangabe des Films „Metropolis“ und beleuchtet die zentralen Themen des Films, wie die Kluft zwischen Arm und Reich, die Rolle der Technik und die Darstellung der Arbeiterklasse. Der Fokus liegt auf der technischen Seite des Films und den Ängsten, die er in der Gesellschaft von 1925 spiegelte.
Arbeiter
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Essay „Der Arbeiter“ von Ernst Jünger und erläutert den Begriff des „Arbeiters der Zukunft“ sowie Jüngers Gedanken zur Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Der Begriff des „Ausfallens“ als technischer Ausdruck für die Transformation des Menschen wird hier genauer betrachtet.
Vergleich
Dieses Kapitel vergleicht die Sichtweisen von Fritz Lang und Ernst Jünger auf die Arbeiterklasse und die Rolle der Technik in der Zukunft. Es analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Werke und untersucht die Visionen eines „Arbeiters der Zukunft“ im Kontext ihrer jeweiligen Epochen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Arbeiterklasse, Technik, Kapitalismus, Mensch-Maschine-Beziehung, „Arbeiter der Zukunft“, „Metropolis“, „Der Arbeiter“, Fritz Lang, Ernst Jünger, Ausfallen, 1925, Industrialisierung, Sozialismus, Versöhnung, Marxismus, Klassenkampf.
Häufig gestellte Fragen
Was vergleicht die Arbeit zwischen „Metropolis“ und „Der Arbeiter“?
Die Arbeit vergleicht die Visionen von Fritz Lang (Film) und Ernst Jünger (Essay) hinsichtlich der Stellung des Arbeiters und der Rolle der Technik in der Zukunft.
Wie wird die Arbeiterklasse in „Metropolis“ dargestellt?
Der Film zeigt eine tiefe Kluft zwischen der Oberschicht und den Arbeitern, die als Teil einer gewaltigen Maschinerie fungieren und fast ihre Individualität verlieren.
Was meint Ernst Jünger mit dem Begriff des „Ausfallens“?
Es beschreibt die technische Transformation des Menschen im Arbeitsprozess und die Verschmelzung von Mensch und Maschine zu einem neuen Typus.
Welche Rolle spielt die Technik in beiden Werken?
Beide Autoren zeigen eine Faszination für die neue Technik, beleuchten aber auch die Ängste vor einer Entmenschlichung und die Auswirkungen des Kapitalismus.
Wird in den Werken eine Versöhnung der Klassen angestrebt?
In „Metropolis“ wird die Versöhnung von „Herz“ (Mittler), „Hirn“ (Kapital) und „Hand“ (Arbeit) thematisiert, während Jünger eher die totale Mobilmachung des Arbeiters fokussiert.
- Citar trabajo
- Esther Klung (Autor), 2002, Der Arbeiter der Zukunft bei Ernst Jünger und Fritz Lang, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23828