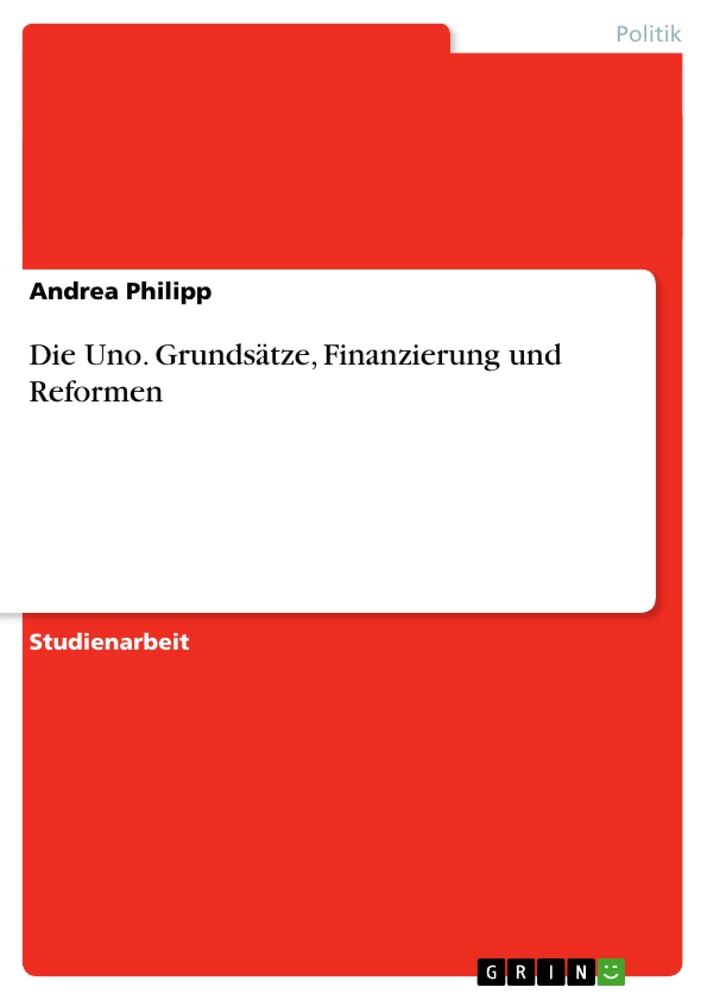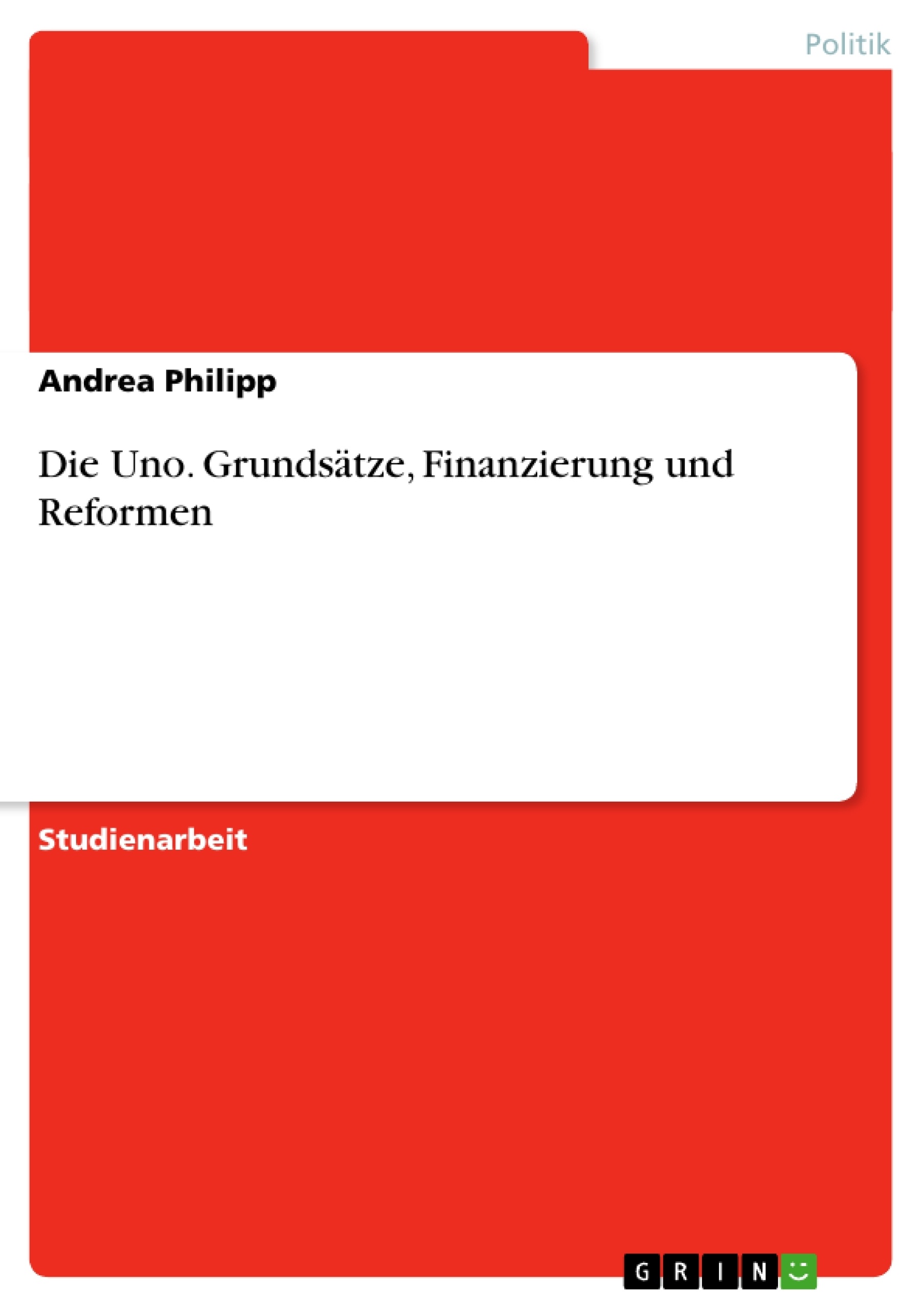Als die Vereinten Nationen (United Nations Organisation/ UNO) am 24. Oktober 1945 mit der Unterzeichnung der UN -Charta durch 51 Mitgliedstaaten offiziell in Kraft trat, wurden große Erwartungen in sie gesteckt. Vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges, den der damalige Völkerbund nicht verhindern konnte, sollte nun diese neue globale Organisation für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit Sorge tragen. Doch wie schaut die Erfolgsbilanz nach ihrem mittlerweile 56jährigen Bestehen aus? Nunerfolgreich ist sie schon in dem Sinne, dass sie noch am Leben und mit derzeit 189 Mitgliedstaaten dem Anspruch an Universalität gerecht geworden ist. Zweifellos hat sie eine Vielzahl von Erfolgen zu verzeichnen, unter anderem im Bereich der Friedenssicherung , auf den nachfolgend noch eingegangen wird.
Allerdings weisen vernichtende Urteile, welche die UNO als „wirkungslose Mammutorganisation“, als „zahnlosen Löwen“ werten, auf die Tatsache hin, dass die Liste der Misserfolge, die sie beispielsweise im Golfkrieg (1990) und in den Bürgerkriegen des ehemaligen Jugoslawien (1993) und in Somalia (1992) zu verbuchen hatte, weitaus länger ist und die Glaubwürdigkeit und Autorität der Organisation stark erschütterten.
Wo liegen die Ursachen dieses Versagens und wie könnte man die Organisation wirkungsvoller gestalten? Die Beantwortung dieser Fragen ist Gegenstand der Arbeit. Im Folgenden werden zunächst die Ziele und Prinzipen der UNO, ihre Finanzstruktur sowie der Aufbau und die Arbeitsweise ihrer Hauptorgane dargestellt, um daraus Kritikpunkte abzuleiten, an denen dann eine Diskussion um Reformen anknüpft. Den Schluss bildet ein Fazit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziele und Grundsätze
- Finanzierung
- Die Hauptorgane
- Der Sicherheitsrat
- Die Generalversammlung
- Der Wirtschafts- und Sozialrat
- Der Internationale Gerichtshof
- Das Sekretariat
- Reformen
- Reformen und internationale Beziehungen
- Machtverhältnisse in der UNO
- Prinzip der Kollektiven Sicherheit
- Zusammensetzung des Sicherheitsrates
- Vetorecht
- Aufgabenerfüllung des Sicherheitsrates
- Prävention statt Intervention
- Stärkung der Generalversammlung und des Internationalen Gerichtshofes
- Reform der Außenpolitik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Vereinten Nationen (UNO) und ihre Erfolge und Misserfolge im Hinblick auf die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Im Zentrum stehen die Frage nach den Ursachen des Versagens der Organisation sowie mögliche Reformansätze. Die Arbeit soll ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise der UNO ermöglichen und die Bedeutung von Reformen für eine effektivere Friedenspolitik beleuchten.
- Ziele und Grundsätze der UNO
- Finanzstruktur und Organisation der UNO
- Kritikpunkte an der Funktionsweise der UNO
- Mögliche Reformen der UNO
- Bedeutung der UNO für die internationale Sicherheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problematik ein und erläutert die Bedeutung der UNO für die Wahrung des Weltfriedens. Kapitel 2 beschreibt die Ziele und Grundsätze der UNO, die in der UN-Charta festgeschrieben sind. Kapitel 3 analysiert die Finanzstruktur der Organisation und zeigt die Herausforderungen auf, die mit der Finanzierung der UNO verbunden sind. Kapitel 4 stellt die Hauptorgane der UNO vor, insbesondere den Sicherheitsrat und die Generalversammlung, sowie deren Aufgaben und Funktionsweise.
Schlüsselwörter
Vereinte Nationen (UNO), Weltfrieden, Internationale Sicherheit, Friedenssicherung, UN-Charta, Sicherheitsrat, Generalversammlung, Reformen, Machtverhältnisse, Vetorecht, Finanzstruktur, Finanzierungsprobleme, Internationale Beziehungen.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die UNO gegründet?
Die Vereinten Nationen traten offiziell am 24. Oktober 1945 mit der Unterzeichnung der UN-Charta in Kraft.
Was sind die Hauptziele der Vereinten Nationen?
Die Hauptziele sind die Wahrung des Weltfriedens, die internationale Sicherheit sowie die Förderung der internationalen Zusammenarbeit.
Warum wird die UNO oft als „zahnloser Löwe“ kritisiert?
Kritiker verweisen auf Misserfolge bei der Friedenssicherung (z.B. Somalia 1992, Jugoslawien 1993) und die mangelnde Durchsetzungskraft gegenüber mächtigen Mitgliedstaaten.
Welche Reformen werden für den Sicherheitsrat diskutiert?
Diskutiert werden eine gerechtere Zusammensetzung des Rates, die Einschränkung des Vetorechts und eine stärkere Gewichtung von Prävention statt Intervention.
Wie finanziert sich die UNO?
Die Finanzierung erfolgt über Beiträge der Mitgliedstaaten, wobei die Höhe oft an der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Länder bemessen wird, was regelmäßig zu Finanzierungsproblemen führt.
- Citation du texte
- Andrea Philipp (Auteur), 2001, Die Uno. Grundsätze, Finanzierung und Reformen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/23907