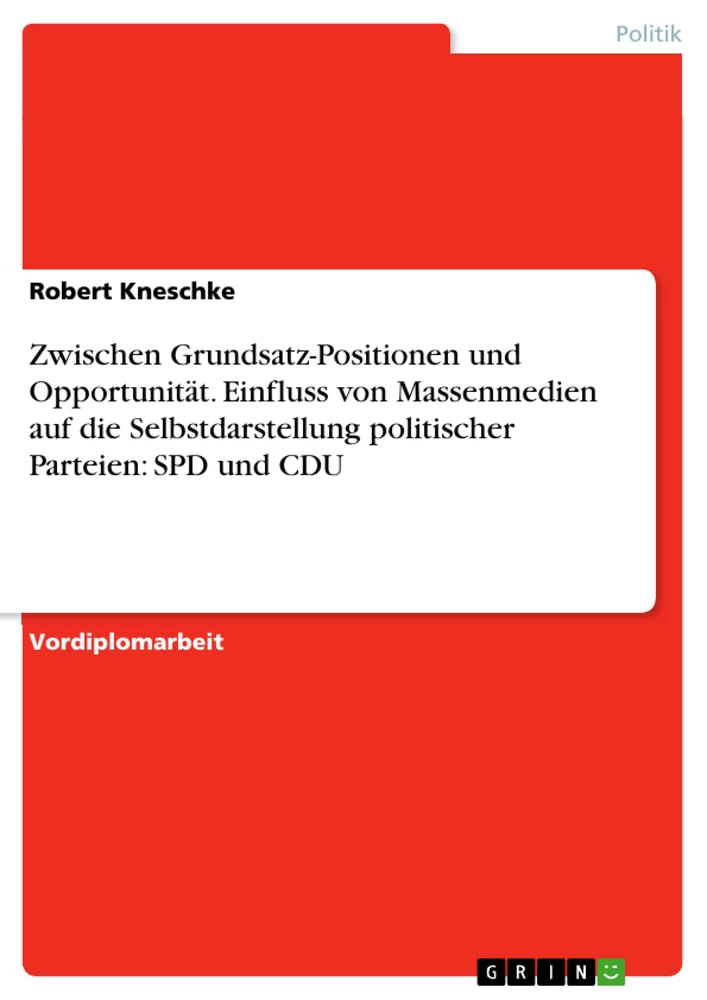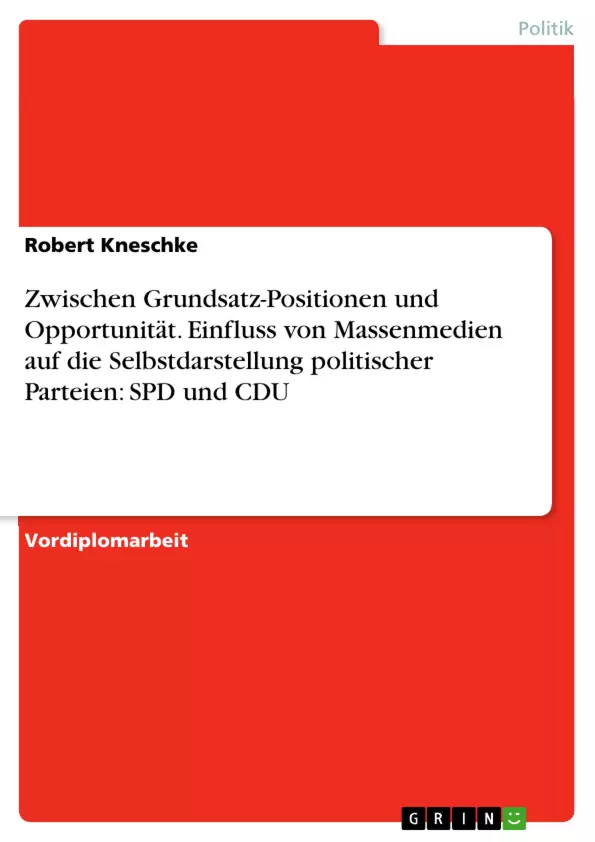Legislative, Exekutive und Judikative - das sind die drei Gewalten, die ein guter Staat nach Montesquieu strikt voneinander trennen sollte. Als sein Hauptwerk "Vom Geist der Gesetze" 1748 erschien, konnte er nicht ahnten, dass später die Medien als eine Art "vierte Macht" hinzukommen würden. Wie auch? Erst durch die Entwicklung der Technik (Rotationsmachine 1865, Setzmachine 1885) konnte sich die Presse zu einem Massenmedium entwickeln und beginnen, politische Macht zu entfalten (Meyn 1999:40).
Wegen der fehlenden empirischen Grundlage zu diesem Thema ist diese Arbeit zweigeteilt.
Im theoretischen Teil werden die verschiedenen Modell-Ansätze vorgestellt, die sich mit den Fragen "Wer bestimmt die politische Agenda?" und "In welchem Verhältnis stehen Politik und Medien zueinander?" beschäftigen und versucht, deren Aussagekraft zu bewerten. So wird ein Überblick über den bisherigen Forschungsstand geschaffen. Der praktische Teil ist der Anregung Sarcinellis folgend in die Bereiche Organisation, Eliten und Grundsätze gegliedert. Dort werden aktuelle Beispiele vorgestellt, in denen Parteien durch Medien beeinflusst worden sein könnten. Damit wird ein Schritt über den aktuellen Forschungsstand hinaus gewagt und aufgezeigt, welche Fragestellungen zukünftig berücksichtigt werden sollten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hauptteil
- 2.1 Theorieansätze zur politischen Agenda
- 2.1.1 Das Top-Down-Modell
- 2.1.2 Das Bottom-Up-Modell
- 2.1.3 Das Mediokratie-Modell
- 2.1.4 Das Biotop-Modell
- 2.2 Theorieansätze zum Verhältnis Politik/Medien
- 2.2.1 Das konstruktivistisches Modell
- 2.2.2 Das Verschmelzungs-Modell Plassers
- 2.2.3 Das Kommunikations-Modell von Jarren und Arlt
- 2.2.4 Das Konkurrenz-Modell von Soeffner und Tänzler
- 2.3 Betrachtungsebenen
- 2.3.1 Organisation der Parteien
- 2.3.2 Eliten der Parteien
- 2.3.3 Grundsätze der Parteien
- 2.1 Theorieansätze zur politischen Agenda
- 3. Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Massenmedien auf die Selbstdarstellung politischer Parteien, speziell der SPD und CDU. Sie analysiert, inwieweit Parteien ihre Grundsätze, Organisation und die Auswahl ihrer Spitzenkandidaten an die Medienlogik anpassen. Der Fokus liegt auf der Erforschung des Spannungsverhältnisses zwischen der Notwendigkeit, grundsätzliche Positionen zu vertreten, und dem opportunistischen Verhalten, um eine positive Medienpräsenz zu erreichen.
- Theorieansätze zur politischen Agenda und deren Bewertung
- Theorieansätze zum Verhältnis Politik und Medien
- Analyse der Betrachtungsebenen: Parteiorganisation, Parteielite, Parteigrundsätze
- Beispiele zur Medienbeeinflussung von Parteien
- Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Medien als "vierte Gewalt" ein und beleuchtet den Forschungsstand zum Einfluss der Massenmedien auf die politische Selbstdarstellung von Parteien. Sie hebt die Forschungslücke bezüglich des Einflusses auf die Parteigrundsätze, -organisation und -eliten hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich aus theoretischen Überlegungen und Fallbeispielen zusammensetzt. Die Arbeit basiert auf der Annahme, dass die Medien einen erheblichen Einfluss auf die Politik haben, dieser Einfluss aber noch unzureichend erforscht ist, insbesondere im Hinblick auf die Anpassung von Parteigrundsätzen an die Medienlogik.
2. Hauptteil: Der Hauptteil der Arbeit gliedert sich in drei Abschnitte: Zuerst werden verschiedene Modellansätze zur politischen Agenda (Top-Down, Bottom-Up, Mediokratie, Biotop) vorgestellt und kritisch bewertet. Es wird der Einfluss der Medien auf die politische Agenda diskutiert, wobei die Stärken und Schwächen der verschiedenen Modelle im Hinblick auf die Einseitigkeit des Informationsflusses zwischen Politik, Medien und Bevölkerung beleuchtet werden. Der zweite Abschnitt befasst sich mit dem Verhältnis von Politik und Medien, wobei verschiedene Modelle (konstruktivistisch, Verschmelzungsmodell Plassers, Kommunikationsmodell Jarren/Arlt, Konkurrenzmodell Soeffner/Tänzler) analysiert und verglichen werden. Schließlich werden die Betrachtungsebenen Parteiorganisation, Parteielite und Parteigrundsätze eingeführt und anhand von Beispielen (EU-Diätenreform, Sozialhilfegesetz) konkretisiert. Dieser Abschnitt stellt einen innovativen Beitrag dar, indem er über die bisherige Forschung hinausgeht und die verschiedenen Ebenen der Medienbeeinflussung systematisch untersucht.
Schlüsselwörter
Massenmedien, politische Parteien, Selbstdarstellung, Medienpräsenz, politische Agenda, Parteiorganisation, Parteielite, Parteigrundsätze, Mediokratie, Mediendemokratie, Opportunität, Forschungsstand, SPD, CDU, Agenda-Setting.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Einfluss der Massenmedien auf die Selbstdarstellung politischer Parteien
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Massenmedien auf die Selbstdarstellung politischer Parteien, insbesondere der SPD und CDU. Im Fokus steht die Anpassung von Parteigrundsätzen, Organisation und der Auswahl von Spitzenkandidaten an die Medienlogik und das Spannungsverhältnis zwischen der Notwendigkeit, grundsätzliche Positionen zu vertreten, und opportunistischem Verhalten für positive Medienpräsenz.
Welche Theorieansätze werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Theorieansätze zur politischen Agenda (Top-Down, Bottom-Up, Mediokratie, Biotop) und zum Verhältnis Politik/Medien (konstruktivistisch, Verschmelzungsmodell Plassers, Kommunikationsmodell Jarren/Arlt, Konkurrenzmodell Soeffner/Tänzler). Diese werden kritisch bewertet und verglichen.
Welche Betrachtungsebenen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert den Einfluss der Medien auf drei Betrachtungsebenen: die Parteiorganisation, die Parteielite und die Parteigrundsätze. Konkrete Beispiele illustrieren die Auswirkungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit drei Abschnitten (Theorieansätze zur politischen Agenda, Theorieansätze zum Verhältnis Politik/Medien, Betrachtungsebenen) und eine Zusammenfassung/Fazit. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt den Forschungsstand. Der Hauptteil präsentiert und analysiert die verschiedenen Modelle und Betrachtungsebenen. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Massenmedien, politische Parteien, Selbstdarstellung, Medienpräsenz, politische Agenda, Parteiorganisation, Parteielite, Parteigrundsätze, Mediokratie, Mediendemokratie, Opportunität, Forschungsstand, SPD, CDU, Agenda-Setting.
Welche Forschungslücke schließt die Arbeit?
Die Arbeit schließt die Forschungslücke bezüglich des Einflusses der Medien auf die Anpassung von Parteigrundsätzen, -organisation und -eliten an die Medienlogik. Bisherige Forschung hat diesen Aspekt unzureichend behandelt.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine qualitative Forschungsmethode, die auf der Analyse bestehender Theorieansätze und der Interpretation von Beispielen beruht. Die genaue Methode ist nicht explizit benannt, aber der Fokus liegt auf der theoretischen Analyse und dem Vergleich verschiedener Modelle.
Welche konkreten Beispiele werden genannt?
Konkrete Beispiele werden im Hauptteil genannt, um die Betrachtungsebenen zu illustrieren (z.B. EU-Diätenreform, Sozialhilfegesetz). Die genauen Details der Beispiele sind im vorliegenden Auszug nicht enthalten.
Gibt es einen Ausblick auf zukünftige Forschung?
Ja, die Arbeit enthält einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen, der jedoch im vorliegenden Auszug nicht detailliert beschrieben ist.
- Quote paper
- Dipl. pol. Robert Kneschke (Author), 2004, Zwischen Grundsatz-Positionen und Opportunität. Einfluss von Massenmedien auf die Selbstdarstellung politischer Parteien: SPD und CDU, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24344