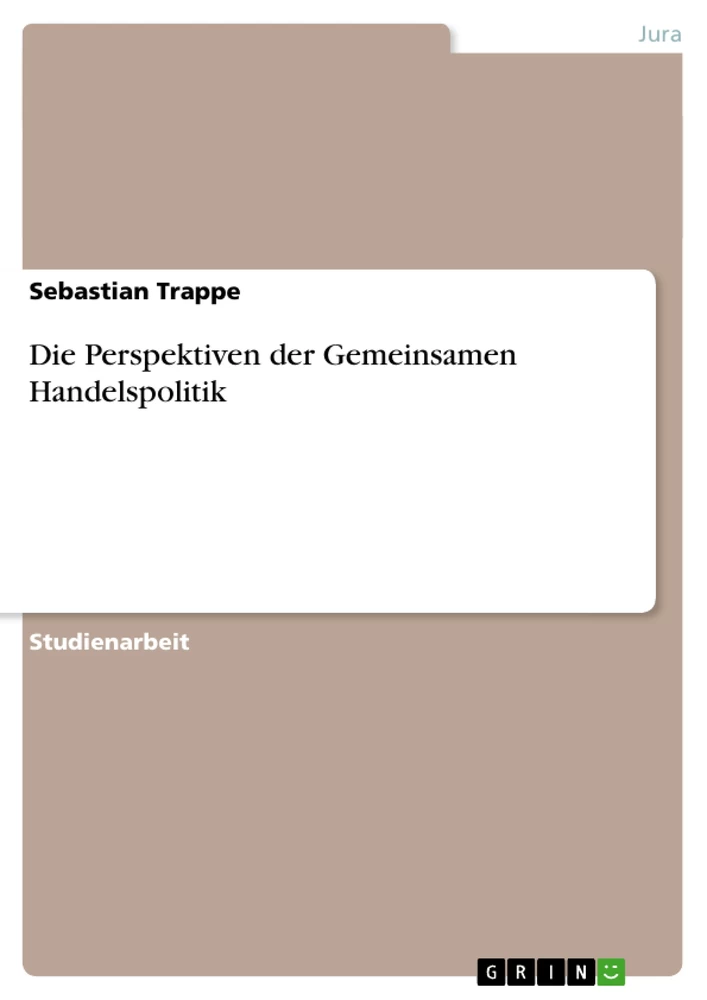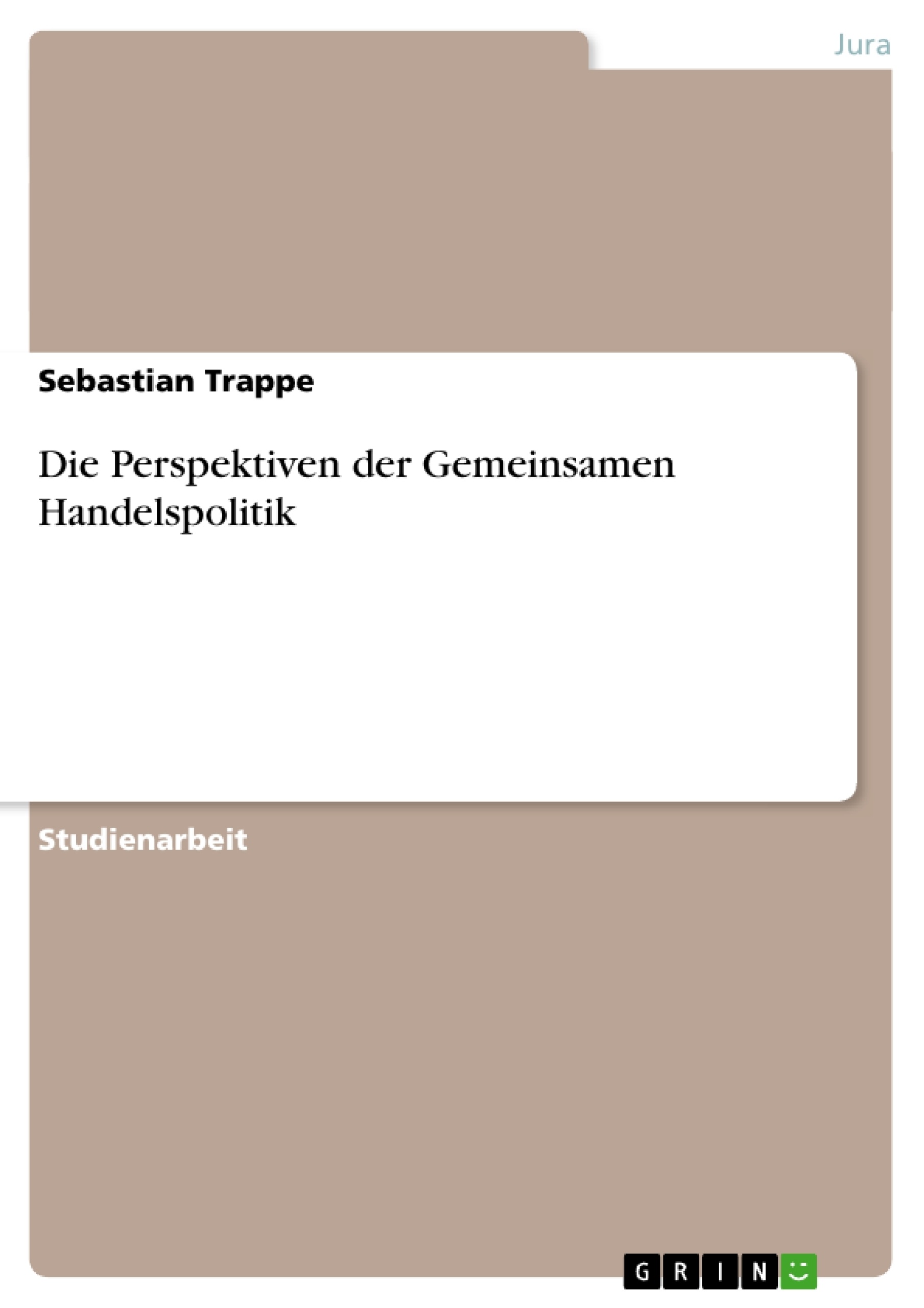Die ersten Schritte zu einer gemeinsamen Handelspolitik wurden 1958 mit dem EWG-Vertrag
unternommen. Mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft setzten sich die
Gründungsmitglieder (Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, Niederlande
und Luxemburg ) gemäß Artikel 2 EWGV das Ziel, einen gemeinsamen Markt zu schaffen.
Das Fundament, auf dem dieser gemeinsame Markt errichtet werden sollte, bildete die
Verwirklichung einer Zollunion. Gemäß Art. 9 EWGV (Art. 23 EGV n. F.) verpflichteten sich
die Mitglieder der Gemeinschaft Ein- und Ausfuhrzölle, sowie Abgaben gleicher Wirkung
beim Warenverkehr innerhalb der Gemeinschaft abzuschaffen.
Gleichzeitig sollte gegenüber Drittstaaten ein gemeinsamer Zolltarif festgesetzt werden.
Dieser gemeinsame Zolltarif machte den Unterschied zu einer gewöhnlichen Freihandelszone
aus.
Nachdem die Innenzölle schrittweise abgebaut wurden war 1968 die Zollunion für die 6
Gründungsmitglieder vollendet.2
Im Rahmen ihrer Entwicklung ist die GHP als notwendige Folge der Verwirklichung des
gemeinsamen Marktes anzusehen:
Der gemeinsame Markt erforderte eine gemeinsame Handelspolitik, um ihn gegenüber
Drittstaaten außenwirtschaftlich abzusichern. 3
1 Im folgenden als GHP abgekürzt.
2 Mit den Erweiterungen der Gemeinschaft musste dieser Prozess für die neuen Mitglieder wiederholt werden.
3 Woyke, Handwörterbuch Internationale Politik, S. 111.
Inhaltsverzeichnis
- A. Die Entwicklung der Gemeinsamen Handelspolitik
- I. Die GHP im E(W)G-Vertrag
- 1. Gründung der EWG
- 2. Die GHP als ausschließliche Gemeinschaftskompetenz
- II. Umfang der GHP
- 1. Die finale Theorie
- 2. Die instrumentale Theorie
- a) Sichtweise der Kommission
- b) Sichtweise des Ministerrates
- 3. Die Rechtsprechung des EuGH
- III. Die Instrumente der GHP
- 1. Die autonome Handelspolitik
- 2. Vertragliche Handelspolitik
- 3. Das WTO-Gutachten 1/94
- a) Fragestellung des Gutachtens
- b) Ergebnis der Rechtsprechung
- 4. Die GHP im Vertrag von Amsterdam
- a) Hinzufügung des Absatz 5
- b) Erweiterung der Außenkompetenz?
- 5. Der Vertrag von Nizza
- a) Hinzufügung der Absätze 5-7
- b) Inhalte
- c) Folgen
- 6. Verfahrensregelungen der GHP im Falle autonomer Maßnahmen gem. Abs. 1
- 7. Verfahren bei internationalen Abkommen
- B. Die Rolle Völkerrechtlicher Prinzipien bei der GHP
- I. Globalisierung ohne Grenzen?
- 1. Grundsatz der Unmittelbare Wirkung
- a) Definition
- b) Entwicklung
- 2. unmittelbare Wirkung des WTO-Rechts?
- 3. Positionen der Teilnehmer
- II. Portugal gegen Rat
- 1. Ergebnis der Rechtsprechung
- a) Vorgreifen der Rechtsprechung
- b) Prinzip der Gegenseitigkeit
- 2. Kritik des Urteils
- III. Zusammenfassung
- C. Die gemeinsame Handelspolitik im Konventsentwurf
- I. Kompetenzzuweisung
- II. Kompetenzumfang
- 1. Erweiterung des Kompetenzumfangs
- 2. Ausnahmebestimmungen
- III. Verfahrensregelungen
- IV. Perspektiven der gemeinsamen Handelspolitik
- 1. Vorteile der Kompetenzerweiterung
- 2. Demokratisierung der Handelspolitik
- 3. Reduzierung der Ausnahmebestimmungen
- Entwicklung der GHP im EWG-Vertrag und den Folgeverträgen
- Die Rolle völkerrechtlicher Prinzipien bei der GHP
- Die GHP im Konventsentwurf und die Perspektiven für die Zukunft
- Kompetenzverteilung zwischen EU und Mitgliedstaaten im Bereich der Handelspolitik
- Die Instrumente der GHP und ihre Anwendung in der Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Entwicklung und den Perspektiven der Gemeinsamen Handelspolitik (GHP) der Europäischen Union. Ziel ist es, die historische Entwicklung der GHP im Kontext des europäischen Integrationsprozesses zu beleuchten, den aktuellen Stand der GHP zu analysieren und die zukünftige Entwicklung im Lichte des Konventsentwurfs zu diskutieren.
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit beleuchtet die historische Entwicklung der GHP, beginnend mit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Es werden die Anfänge der GHP im EWG-Vertrag, die Entwicklung der GHP als ausschließliche Gemeinschaftskompetenz und der Umfang der GHP im Sinne des Art. 133 EGV diskutiert. Dabei wird auch auf die verschiedenen Theorien zur Auslegung des Umfangs der GHP und die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) eingegangen. Des Weiteren werden die Instrumente der GHP, wie die autonome und die vertragliche Handelspolitik, sowie die Entwicklung der GHP im Rahmen der Verträge von Amsterdam und Nizza behandelt. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der Rolle völkerrechtlicher Prinzipien bei der GHP. Hier wird insbesondere der Grundsatz der unmittelbaren Wirkung des WTO-Rechts und der Fall Portugal gegen Rat beleuchtet. Der dritte Teil widmet sich der GHP im Konventsentwurf, wobei die Kompetenzverteilung zwischen EU und Mitgliedstaaten im Bereich der Handelspolitik im Vordergrund steht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen der Europäischen Handelspolitik, darunter die Gemeinschaftskompetenz, die Instrumente der GHP, die Rolle des EuGH, die Rechtsprechung im Bereich der GHP, die Beziehung zur WTO und die völkerrechtlichen Prinzipien der unmittelbaren Wirkung und Gegenseitigkeit. Darüber hinaus werden die Perspektiven der GHP im Lichte des Konventsentwurfs und die Frage der Demokratisierung der Handelspolitik beleuchtet.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde die Gemeinsame Handelspolitik (GHP) begründet?
Die ersten Schritte wurden 1958 mit dem EWG-Vertrag unternommen, mit dem Ziel, einen gemeinsamen Markt und eine Zollunion zu schaffen.
Was unterscheidet die GHP von einer gewöhnlichen Freihandelszone?
Im Gegensatz zu einer Freihandelszone legt eine Zollunion wie die GHP einen gemeinsamen Zolltarif gegenüber Drittstaaten fest.
Welche Rolle spielt der Europäische Gerichtshof (EuGH) für die GHP?
Der EuGH hat durch seine Rechtsprechung maßgeblich zur Auslegung des Umfangs der GHP-Kompetenzen beigetragen, insbesondere im Hinblick auf internationale Abkommen.
Was änderte der Vertrag von Nizza an der Handelspolitik?
Der Vertrag von Nizza erweiterte die Bestimmungen der GHP, unter anderem durch neue Regelungen für Dienstleistungen und geistiges Eigentum.
Was bedeutet "Demokratisierung der Handelspolitik"?
Es bezeichnet das Bestreben, die Entscheidungsprozesse in der GHP transparenter zu gestalten und die parlamentarische Kontrolle zu stärken.
- Citation du texte
- Sebastian Trappe (Auteur), 2004, Die Perspektiven der Gemeinsamen Handelspolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24731