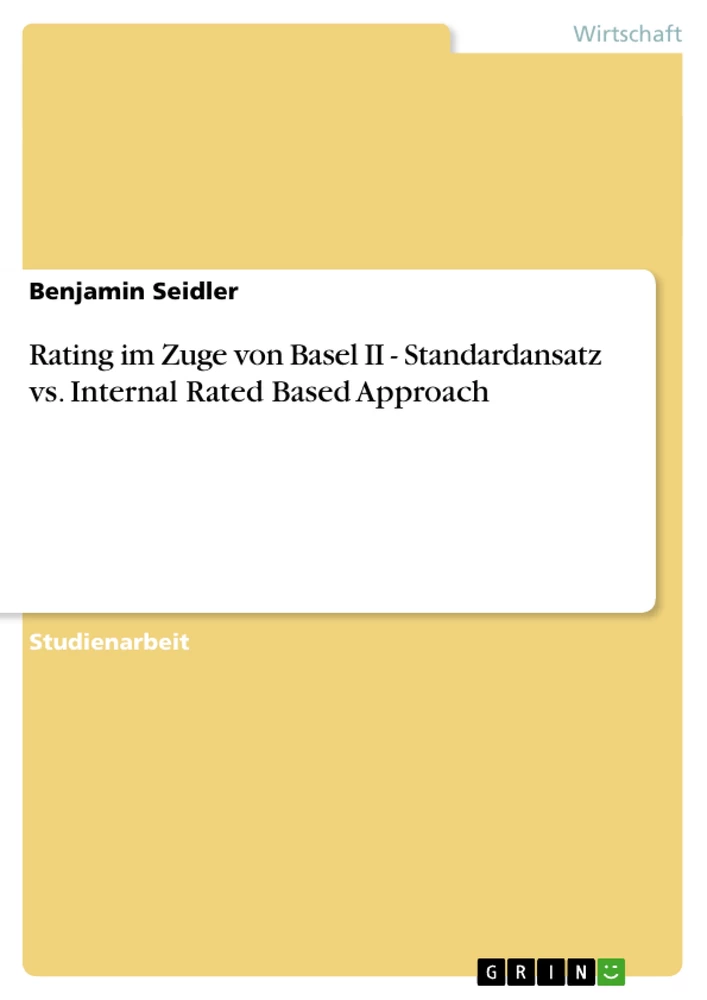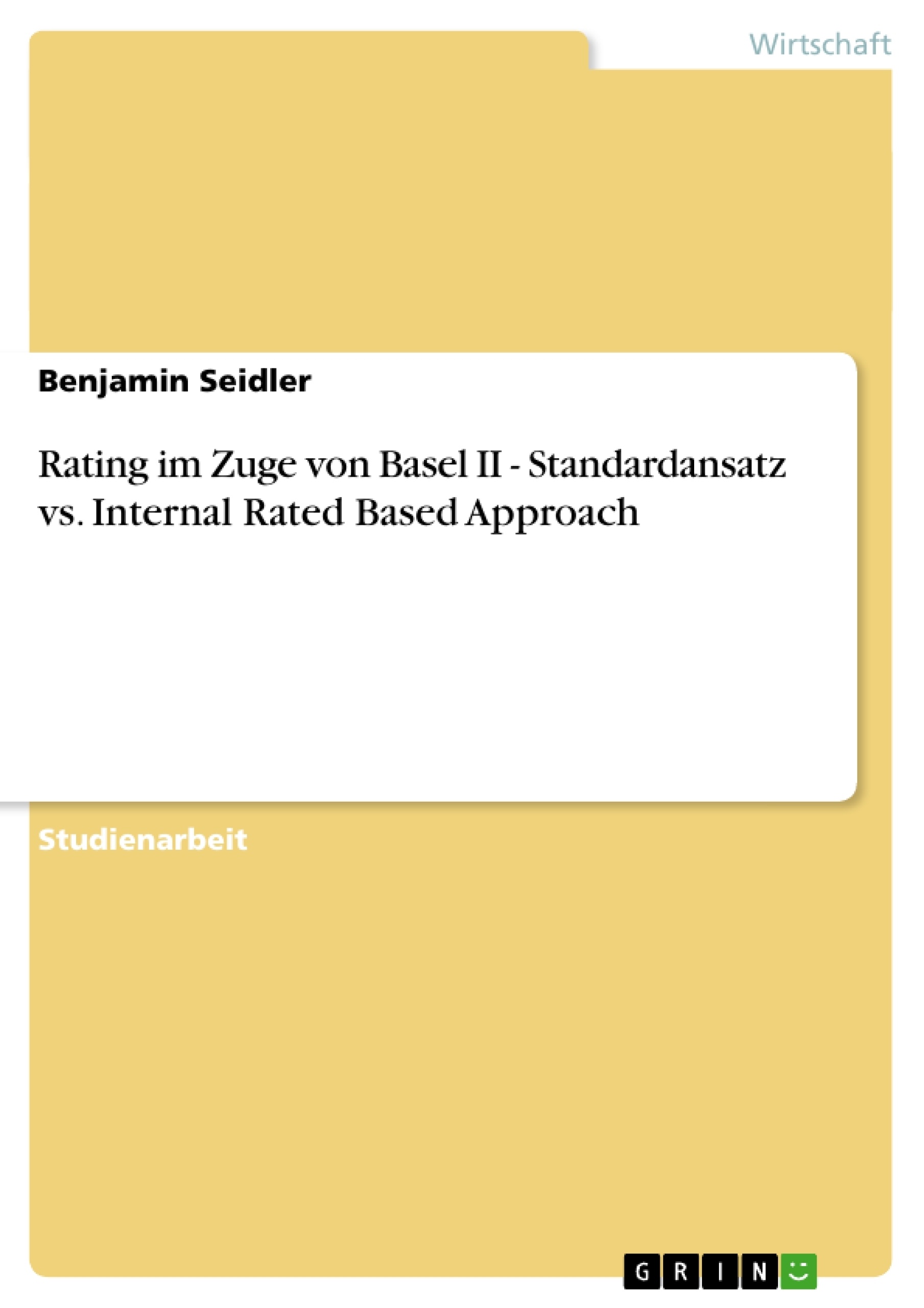[...]
Kaum ein anderes Thema bewegt die Wirtschaft, die Politik, die Presse und vor allem die
Banken derzeit in solchen Maßen: 1
Basel II bezeichnet die neue Eigenkapitalvereinbarung des Basler Ausschuss für
Bankenaufsicht, die ab 2007 Anwendung finden soll.2 Oberstes Ziel ist die Stabilisierung
der internationalen Finanzmärkte3, die durch Globalisierung, steigende Kreditrisiken und
zunehmende Unternehmensinsolvenzen mehr und mehr unter Druck geraten4.
Eingegangene Risiken bei der Kreditvergabe sind in Zukunft einerseits ausschlaggebend
für die Höhe der Kreditzinsen, die ein Schuldner aufzubringen hat, und somit
Ertragskomponente für die Banken. Andererseits sind sie Grundlage für die Berechnung
des für Kreditrisiken zu unterlegenden Eigenkapitals und aus diesem Grunde Begrenzung
des Kreditgeschäftsvolumen der Kreditinstitute.5
Wichtiger Bestandteil des neuen Basler Akkords sind Ratingansätze für die Kreditinstitute
zur Ermittlung des Kreditausfallrisikos eines Schuldners und daraus resultierend eine
angemessene Eigenkapitalunterlegung. Den Banken wird es in Zukunft selbst überlassen,
ob sie das Kreditrisiko bzw. die Bonität eines Kreditnehmers intern über ein eigenes
Ratingsystem ermitteln oder durch externe Ratingagenturen ermitteln lassen.6
In der folgenden Arbeit wird zunächst auf die neuen Eigenkapitalvereinbarungen in
Form der mittlerweile drei Konsultationspapiere eingegangen. Hierbei werden die
Probleme der bisherigen Vorschriften und die Verbesserungen, die Basel II bringen soll,
aufgezeigt.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt nachfolgend auf der näheren Betrachtung der beiden von
Basel II bestimmten Ratingansätze: der Standardansatz unter Mithilfe von externen Ratingagenturen und der auf internen Ratings basierende (IRB) Ansatz. Ziel der Arbeit ist
es außerdem, Vor- und Nachteile beider Ansätze herauszuarbeiten, Auswirkungen von
Basel II auf die Bankenlandschaft aufzuzeigen und einen Ausblick in die nähere Zukunft
zu geben.
1Vgl. Rathmann Christina, Risiko – Wie viel setzen Sie?, Börsenzeitung Ausgabe 85, 06.05.2003
2Vgl. Darstellung Zeitplan von Basel II im Anhang 1 S.23
3Vgl. Wolf Jakob, Basel II – Kreditrating als Chance, S.12
4Vgl. www.creditreform.de - Unternehmensinsolvenzen sowie Obertreis Rolf, Vor allem über dem
Mittelstand kreist der Pleitegeier, Badische Zeitung, 05.12.2003, Vgl. Anhang 2 S.24
5Vgl. Rathmann Christina, Risiko – Wie viel setzen Sie?, Börsenzeitung Ausgabe 85, 06.05.2003
6Vgl. M.Müller / J.Kesting / Dr. J. Rau, Rating, S.15
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in das Thema und Aufbau der Arbeit
- 2. Basel II: die neue Eigenkapitalregelung für Kreditinstitute
- 2.1. Schwächen von Basel I
- 2.2. Die neue Basler Eigenkapitalverordnung
- 2.3. Das Rating
- 2.4. Berechnung der Mindesteigenkapitalanforderung nach Basel II
- 3. Der Standardansatz
- 3.1. Die Behandlung einzelner Forderungen im Standardansatz
- 3.1.1. Forderungen an Unternehmen
- 3.1.2. Forderungen an Staaten
- 3.1.3. Forderungen an Banken
- 3.1.4. Forderungen an Privatpersonen und Kleinunternehmen
- 3.1.5. Sonstige Forderungen
- 3.2. Kreditrisikominderungsmöglichkeiten im Standardansatz
- 3.2.1. Sicherheiten
- 3.2.2. Nettingvereinbarungen mit dem Kreditschuldner
- 3.2.3. Garantien und Kreditderivate
- 3.1. Die Behandlung einzelner Forderungen im Standardansatz
- 4. Die auf internen Ratings basierenden IRB-Ansätze
- 4.1. Die Behandlung einzelner Forderungen im IRB-Ansatz
- 4.1.1. Forderungen an Unternehmen
- 4.1.1.1. Risikoparameter bei Forderungen an UN
- 4.1.2. Forderungen an Privatkunden (Retailkredite)
- 4.1.1. Forderungen an Unternehmen
- 4.2. Interpretation der Risikogewichtungsfunktion
- 4.1. Die Behandlung einzelner Forderungen im IRB-Ansatz
- 5. Diskussion der beiden Ratingansätze
- 5.1. Kosten-Nutzen-Analyse
- 5.2. Bisherige Erkenntnisse (Die dritte Auswirkungsstudie)
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der neuen Eigenkapitalregelung für Kreditinstitute im Rahmen von Basel II. Sie beleuchtet die Unterschiede zwischen dem Standardansatz und den auf internen Ratings basierenden IRB-Ansätzen und analysiert die Vor- und Nachteile beider Methoden.
- Die Schwächen von Basel I und die Notwendigkeit einer neuen Eigenkapitalregelung
- Die verschiedenen Ansätze zur Berechnung der Mindesteigenkapitalanforderungen nach Basel II
- Die Rolle des Ratings im Rahmen von Basel II
- Die Auswirkungen der neuen Eigenkapitalregelung auf die Kreditinstitute
- Die Bedeutung der internen Ratingmodelle und ihre Anwendung im IRB-Ansatz
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema ein und erläutert den Aufbau der Arbeit. Im zweiten Kapitel werden die Schwächen von Basel I und die neue Basler Eigenkapitalverordnung vorgestellt. Außerdem wird die Bedeutung des Ratings im Rahmen von Basel II erläutert. Das dritte Kapitel behandelt den Standardansatz, wobei die Behandlung einzelner Forderungen und die Kreditrisikominderungsmöglichkeiten im Fokus stehen. Das vierte Kapitel befasst sich mit den IRB-Ansätzen, die auf internen Ratings basieren. Hier werden die Risikoparameter bei Forderungen an Unternehmen und Privatkunden sowie die Interpretation der Risikogewichtungsfunktion behandelt. Im fünften Kapitel werden die beiden Ratingansätze diskutiert, wobei die Kosten-Nutzen-Analyse und bisherige Erkenntnisse im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Basel II, Eigenkapitalregelung, Kreditinstitute, Standardansatz, IRB-Ansätze, internes Rating, Risikogewichtungsfunktion, Kreditrisikominderung, Kosten-Nutzen-Analyse, Auswirkungsstudie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen dem Standardansatz und dem IRB-Ansatz bei Basel II?
Im Standardansatz nutzen Banken externe Ratings zur Risikobewertung, während im Internal Rated Based (IRB) Ansatz interne Ratingsysteme der Banken zur Ermittlung des Kreditausfallrisikos verwendet werden.
Welche Ziele verfolgt die Basel II Vereinbarung?
Hauptziel ist die Stabilisierung der internationalen Finanzmärkte durch eine risikogerechtere Eigenkapitalunterlegung der Banken, insbesondere angesichts steigender Kreditrisiken und Unternehmensinsolvenzen.
Was waren die Schwächen von Basel I?
Basel I galt als zu pauschal, da es die tatsächliche Bonität eines Schuldners bei der Eigenkapitalunterlegung kaum berücksichtigte. Basel II führt hierfür differenziertere Ratingansätze ein.
Wie beeinflusst das Rating die Kreditzinsen?
Nach Basel II sind eingegangene Risiken ausschlaggebend für die Höhe der Kreditzinsen. Ein schlechteres Rating führt in der Regel zu höheren Zinsen, da die Bank mehr Eigenkapital zur Absicherung vorhalten muss.
Welche Risikoparameter sind im IRB-Ansatz wichtig?
Zu den zentralen Parametern gehören die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD), die Verlustquote bei Ausfall (LGD) und die Forderungshöhe bei Ausfall (EAD), die zur Berechnung des Risikogewichts herangezogen werden.
- Citation du texte
- Benjamin Seidler (Auteur), 2004, Rating im Zuge von Basel II - Standardansatz vs. Internal Rated Based Approach, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/24937