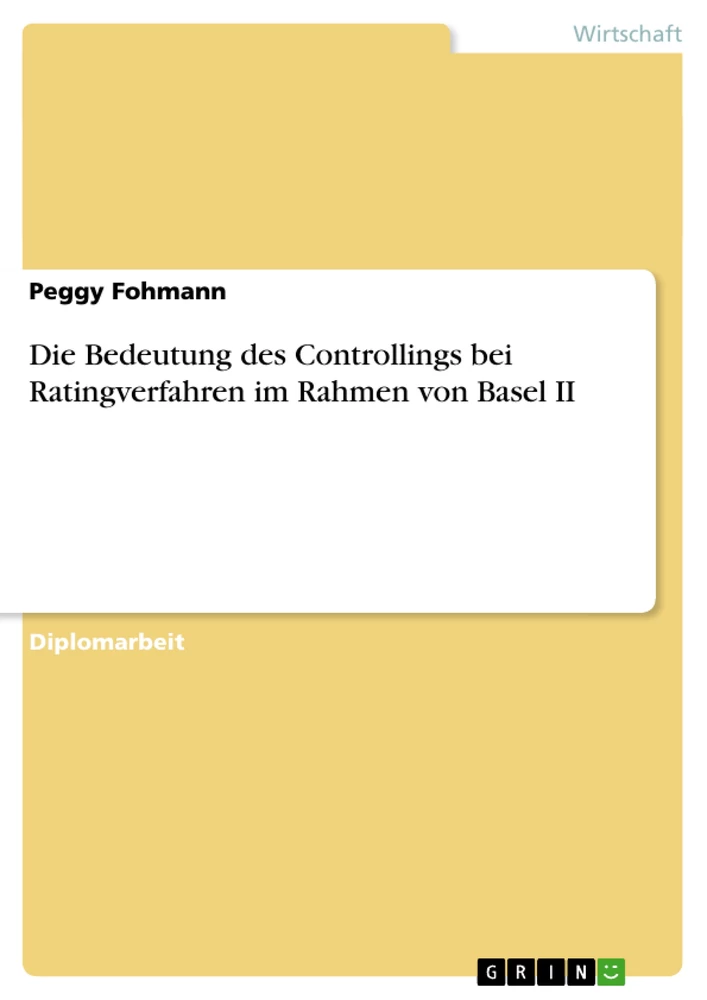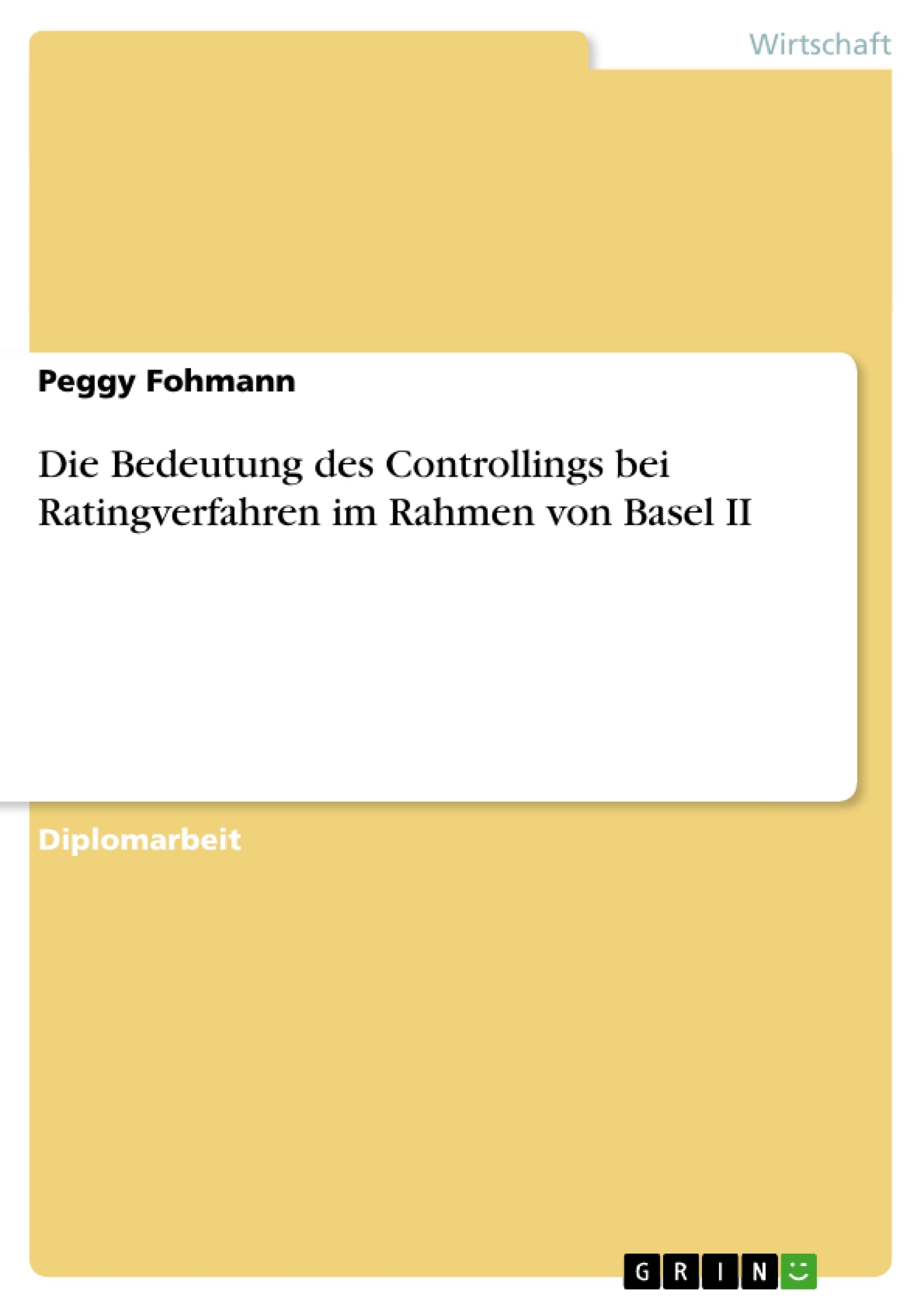Zahlreiche in den vergangenen Jahren existierende internationale Bankkrisen sind auf plötzliche Kreditausfälle zurückzuführen. Sie zeigen auf, dass Kreditausfälle grundsätzlich die Sicherheit der Einlagen und die Existenz der Banken gefährden. Der Hauptgrund dafür lag in der geringen Eigenkapitalausstattung der Banken. Aus diesem Grund wurde im Jahr 1988 die erste Baseler Eigenkapitalvereinbarung durch den Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht veröffentlicht. „Die Hauptziele dieser Eigenkapitalvereinbarung waren die Sicherung einer angemessenen Eigenkapitalausstattung im internationalen Bankwesen und die Schaffung einheitlicher Wettbewerbsbedingungen“ (Everling 2002, S. 28). Im Hinblick auf das Kreditausfallrisiko wurde, in der ersten und heute gültigen Eigenkapitalvereinbarung von 1988, die Höhe der Kreditvergabe durch die Koppelung an das Eigenkapital der Banken begrenzt. Der so genannte Baseler Akkord oder Basel I hatte zum Ergebnis, dass Banken mindestens 8% an Eigenkapital im Verhältnis zu ihrem Aktiva-Portfolio halten müssen. Ein häufiger Kritikpunkt an Basel I war die pauschalisierte Eigenkapitalunterlegung der Kredite in Höhe des Achtprozentfaktors. Folglich wurde jedem Kredit das gleiche Ausfallrisiko unterstellt. Die Bonität eines Kreditnehmers und die eventuell damit verbundene Wahrscheinlichkeit des Kreditausfalls fanden ebenfalls keine Berücksichtigung (vgl. Ehlers 2003, S. 7; Everling 2002, S. 28 ff.; Schneck/Morgenthaler/Yesilhark 2003, S. 13 ff.).
Im Juni 1999 legte der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht einen Neuentwurf der Regelungen zur Eigenkapitalvereinbarung vor. Da die bisherige Eigenkapitalvereinbarung die bestehende Risikosituation der Banken nur unzureichend darstellte, soll anhand der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II) die Eigenkapitalunterlegung risikonäher gestaltet werden (vgl. Everling 2002, S. 29).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Aufgabenstellung
- Vorgehensweise
- Begriffs- und Inhaltsabgrenzung
- Die Baseler Eigenkapitalvereinbarung
- Basler Ausschuss für Bankenaufsicht
- Die geltende Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel I)
- Die neue Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel II)
- Ziele der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung
- Bestandteile der neuen Baseler Eigenkapitalvereinbarung
- Die Säule 1 - Mindestkapitalanforderungen
- Die Säule 2 – Bankaufsichtlicher Überprüfungs-prozess
- Die Säule 3 - Marktdisziplin
- Basel II als Auslöser für die Ratingdiskussion
- Einführung in das Rating
- Bedeutung des Ratings
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung des Ratings zu anderen Bewertungsmethoden
- Ratingarten
- Internes versus externes Rating
- Unternehmensrating
- Branchenrating
- Solicited und Unsolicited Rating
- Auskunftsrating von Wirtschaftsauskunftsdiensten
- Externes Rating durch Ratingagenturen
- Das externe Rating innerhalb des Standardansatzes
- Ratingagenturen
- Internes Rating durch Banken
- Traditionelle Kreditwürdigkeitsprüfung
- Das interne Rating innerhalb des IRB-Ansatzes
- Ratingskalierung der Banken
- Ratingskalierung der Volks- und Raiffeisenbanken
- Ratingskalierung und Ratingprozess der Sparkassen
- Ratingskalierung der Großbanken
- Ratingkriterien
- Die Hard- und Soft Facts innerhalb des Ratings
- Hard Facts
- Soft Facts
- Branche
- Marktpotenzial
- Führungspotenzial
- Produktionspotenzial
- Die Bedeutung des Controllings innerhalb der Ratingverfahren
- Begriffsbestimmung und Aufgabenbereich des Controllings
- Anforderungen an das Controlling
- Rechnungswesen
- Rechtzeitige Verfügbarkeit der Informationen
- Qualität und Aussagefähigkeit der Informationen
- Unternehmensplanung
- Frühwarnsysteme
- Informationssysteme
- Resümee
- Praxisnaher Ablauf eines bankinternen Ratings anhand eines Musterfalls
- Allgemeine Grundlagen
- Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Bedeutung des Controllings bei Ratingverfahren im Kontext der Baseler Eigenkapitalvereinbarung II (Basel II). Sie untersucht die Rolle des Controllings im Rahmen der neuen regulatorischen Vorgaben, insbesondere hinsichtlich der Ratingverfahren von Banken.
- Analyse der Baseler Eigenkapitalvereinbarung II (Basel II) und ihrer Auswirkungen auf Ratingverfahren
- Untersuchung der verschiedenen Ratingarten und deren Bedeutung für Banken
- Bedeutung und Funktionsweise des internen und externen Ratings
- Relevanz von Ratingkriterien und ihre Einbindung in das Controlling
- Praxisnahe Darstellung des Ablaufs eines bankinternen Ratings
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Stellt die Problemstellung und Aufgabenstellung der Diplomarbeit dar.
- Beschreibt die Vorgehensweise und die Begriffs- und Inhaltsabgrenzung.
- Kapitel 2: Die Baseler Eigenkapitalvereinbarung
- Erklärt die Entstehung und die Ziele der Baseler Eigenkapitalvereinbarung (Basel I und Basel II).
- Beschreibt die drei Säulen von Basel II: Mindestkapitalanforderungen, bankaufsichtlicher Überprüfungs-prozess und Marktdisziplin.
- Beleuchtet die Bedeutung von Basel II als Auslöser für die Ratingdiskussion.
- Kapitel 3: Einführung in das Rating
- Erörtert die Bedeutung des Ratings für Banken und andere Institutionen.
- Definiert den Begriff des Ratings und grenzt ihn von anderen Bewertungsmethoden ab.
- Stellt verschiedene Ratingarten vor, darunter internes und externes Rating, Unternehmens- und Branchenrating sowie Solicited und Unsolicited Rating.
- Kapitel 4: Externes Rating durch Ratingagenturen
- Beschreibt das externe Rating im Standardansatz von Basel II.
- Stellt die Rolle von Ratingagenturen bei der Kreditwürdigkeitseinschätzung vor.
- Kapitel 5: Internes Rating durch Banken
- Beschreibt die traditionelle Kreditwürdigkeitsprüfung und das interne Rating im IRB-Ansatz von Basel II.
- Stellt die Ratingskalierung verschiedener Bankengruppen (Volks- und Raiffeisenbanken, Sparkassen, Großbanken) vor.
- Kapitel 6: Ratingkriterien
- Unterscheidet zwischen Hard Facts und Soft Facts, die als Ratingkriterien dienen.
- Diskutiert die Bedeutung von Kriterien wie Branche, Marktpotenzial, Führungspotenzial und Produktionspotenzial.
- Kapitel 7: Die Bedeutung des Controllings innerhalb der Ratingverfahren
- Definiert den Begriff des Controllings und beschreibt seinen Aufgabenbereich.
- Beleuchtet die Anforderungen an das Controlling im Kontext von Ratingverfahren.
- Diskutiert die Bedeutung von Rechnungswesen, Unternehmensplanung, Frühwarnsystemen und Informationssystemen für das Controlling.
- Kapitel 8: Praxisnaher Ablauf eines bankinternen Ratings anhand eines Musterfalls
- Beschreibt die allgemeinen Grundlagen und die notwendigen Angaben zu einem Unternehmen, die für ein bankinternes Rating relevant sind.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit behandelt zentrale Themen wie die Baseler Eigenkapitalvereinbarung II (Basel II), Ratingverfahren, internes und externes Rating, Ratingkriterien, Controlling, Frühwarnsysteme und Informationssysteme. Sie untersucht die Bedeutung des Controllings bei der Bewertung von Kreditrisiken und beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus den neuen regulatorischen Vorgaben ergeben.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Basel I und Basel II?
Basel I gab eine pauschale Eigenkapitalunterlegung von 8% vor, während Basel II die Unterlegung risikonäher durch Ratings gestaltet.
Welche Rolle spielt das Controlling beim Rating?
Controlling stellt die Qualität und rechtzeitige Verfügbarkeit von Informationen sicher, die für eine positive Bonitätsbewertung (Rating) entscheidend sind.
Was sind „Hard Facts“ und „Soft Facts“ im Ratingprozess?
Hard Facts sind messbare Bilanzzahlen; Soft Facts umfassen qualitative Kriterien wie Marktpotenzial, Branche und Führungskompetenz.
Was ist der IRB-Ansatz bei Basel II?
Der Internal Ratings-Based (IRB) Ansatz erlaubt es Banken, ihre eigenen internen Schätzungen für Kreditrisikoparameter zu verwenden.
Was sind die drei Säulen von Basel II?
Säule 1: Mindestkapitalanforderungen; Säule 2: Bankaufsichtlicher Überprüfungsprozess; Säule 3: Marktdisziplin/Offenlegung.
- Citar trabajo
- Peggy Fohmann (Autor), 2004, Die Bedeutung des Controllings bei Ratingverfahren im Rahmen von Basel II, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25426