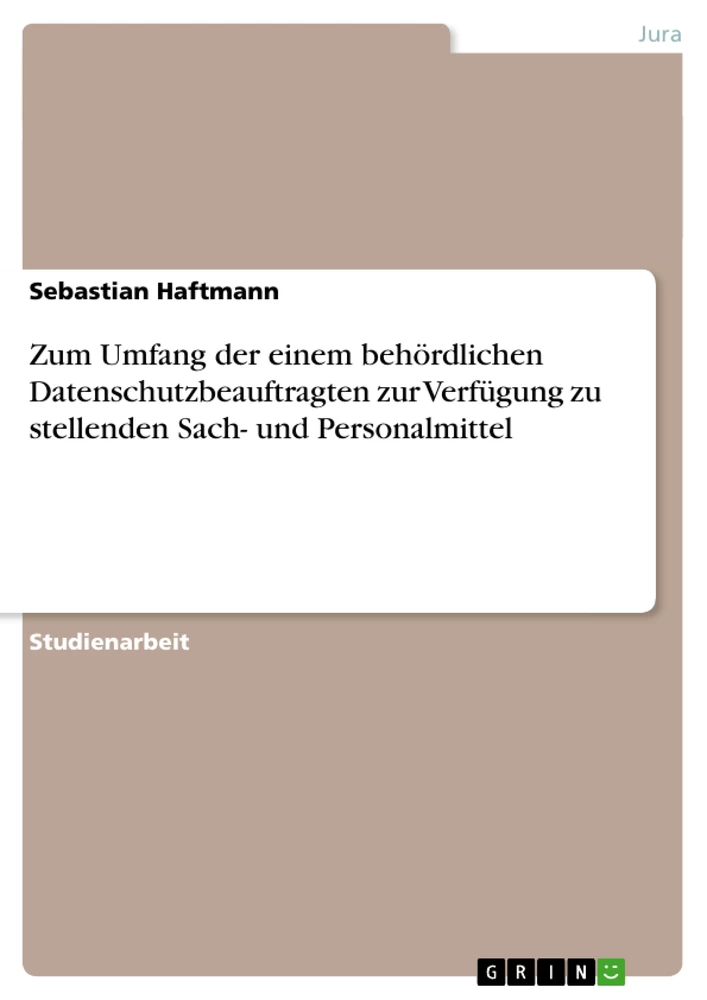Initiiert durch die Europäische Datenschutzrichtlinie (DSRL)1 sind nach der
Novellierung des BDSG im Mai 2001 alle öffentlichen Stellen des Bundes
verpflichtet einen sog. behördlichen Datenschutzbeauftragten zu bestellen.
Neu ist diese Art der internen, dezentralen Datenschutzkontrolle im öffentlichen
Bereich nicht. So wurde sie seit 1986 durch das HDSG auf Landesebene
bereits mit gesetzlicher Basis betrieben.2 Auch die Erkenntnis, dass die zentrale
Datenschutzgewährleistung in öffentlichen Stellen durch den Bundes- und die
Landesbeauftragten unbefriedigende Ergebnisse zur Folge hatte, führte Anfang
der 90er Jahre dazu, dass viele Behörden, allerdings ohne gesetzliche
Motivation, interne Datenschutzbeauftragte ernannten.3
Im nicht-öffentlichen Sektor kennt man den betrieblichen
Datenschutzbeauftragten schon seit längerem zumindest aus den §§ 36 und 37
BDSG a.F.
Mit der Umsetzung der DSRL durch die Neufassung des BDSG und die
gleichzeitige jedoch nicht einheitliche4 Anpassung der LDSG haben die
Gesetzgeber nun versucht dem behördlichen Datenschutzbeauftragten Profil zu
verleihen.
Sinn und Zweck vorliegender Arbeit ist es, dieses kodifizierte Profil darzustellen,
wobei auf die Ausstattung des behördlichen Datenschutzbeauftragten mit
tätigkeitsbezogenen Mitteln besonders eingegangen werden soll.
1 Richtlinie 95/46/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L281/32 vom 23.11.1995.
2 nämlich in Hessen; dazu Gola, DuD 1999, 342; ebenso Ordemann/Schomerus, BDSG, 5. Aufl.
1992, § 36 Anm. 8.
3 Abel, MMR 2002, 289.
4 Gemeint sind unterschiedliche Regelungen in den verschiedenen LDSG bzgl. Bestellung,
Vertretung, Rechten, Pflichten etc. des DSB; im Einzelnen Abel, MMR 2002, 289-294.
Inhaltsverzeichnis
- Hintergrund
- Bestellung & Abberufung
- Anforderungen
- Aufgaben
- Rechte, Pflichten und Befugnisse
- Sachliche und personelle Unterstützung
- Hilfspersonal
- Räumlichkeiten
- Einrichtungen & Geräte
- (Finanzielle) Mittel
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Text analysiert das Profil des behördlichen Datenschutzbeauftragten, das durch die Neufassung des BDSG im Zuge der Umsetzung der europäischen Datenschutzrichtlinie geschaffen wurde. Im Fokus steht die Ausstattung des Datenschutzbeauftragten mit den notwendigen Mitteln zur Erfüllung seiner Aufgaben.
- Bestellung und Abberufung des behördlichen Datenschutzbeauftragten
- Anforderungen an die Fachkunde und Zuverlässigkeit des Datenschutzbeauftragten
- Rechte, Pflichten und Befugnisse des Datenschutzbeauftragten
- Sachliche und personelle Unterstützung des Datenschutzbeauftragten
- Finanzielle Mittel für den Datenschutzbeauftragten
Zusammenfassung der Kapitel
Hintergrund
Die Europäische Datenschutzrichtlinie hat die Bestellung eines behördlichen Datenschutzbeauftragten für alle öffentlichen Stellen des Bundes verpflichtend gemacht. Diese neue Form der dezentralen Datenschutzkontrolle baut auf Erfahrungen mit internen Datenschutzbeauftragten in der Vergangenheit auf. Die Neufassung des BDSG und die Anpassung der Landesdatenschutzgesetze haben dem behördlichen Datenschutzbeauftragten ein definiertes Profil verliehen.
Bestellung & Abberufung
§ 4 f Abs. 1 BDSG verpflichtet alle öffentlichen Stellen zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, wobei sowohl interne als auch externe Personen in Frage kommen. Die Abberufung des Datenschutzbeauftragten ist nach § 4 f Abs. 3 BDSG unter analoger Anwendung des § 626 BGB möglich, wobei ein wichtiger Grund vorliegen muss.
Anforderungen
Das BDSG verlangt von Datenschutzbeauftragten Fachkunde und Zuverlässigkeit. Die Fachkunde umfasst datenschutzrechtliche Kenntnisse, technisches Verständnis und organisatorische Kenntnisse der Behörde. Darüber hinaus werden pädagogisch-didaktische Fähigkeiten, psychologische Durchsetzungsfähigkeit und Verhandlungsgeschick erwartet.
Rechte, Pflichten und Befugnisse
(Die Zusammenfassung des Abschnitts "Rechte, Pflichten und Befugnisse" wird hier ausgelassen, da es sich um einen wichtigen Teil des Textes handelt, der im Preview nicht vollständig behandelt werden sollte, um dem Leser den Reiz des Originaltextes zu erhalten.)
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen des Textes sind behördlicher Datenschutzbeauftragter, Datenschutzrichtlinie, BDSG, Landesdatenschutzgesetze, Fachkunde, Zuverlässigkeit, Rechte, Pflichten, Befugnisse, Sachliche und personelle Unterstützung, Finanzielle Mittel.
Häufig gestellte Fragen
Wer muss einen behördlichen Datenschutzbeauftragten bestellen?
Nach der Novellierung des BDSG im Jahr 2001 sind alle öffentlichen Stellen des Bundes verpflichtet, einen behördlichen Datenschutzbeauftragten (bDSB) zu ernennen.
Welche fachlichen Anforderungen werden an einen bDSB gestellt?
Der bDSB muss über juristische Kenntnisse im Datenschutzrecht, technisches Verständnis der IT-Systeme sowie organisatorisches Wissen über die Behördenabläufe verfügen.
Welche Sachmittel müssen dem Datenschutzbeauftragten bereitgestellt werden?
Dazu gehören geeignete Räumlichkeiten, moderne IT-Ausstattung, Zugriff auf Fachliteratur sowie die notwendigen finanziellen Mittel für Fortbildungen.
Hat der bDSB Anspruch auf Hilfspersonal?
Ja, je nach Größe der Behörde und Umfang der Datenverarbeitung muss die Behördenleitung dem Datenschutzbeauftragten ausreichend Personal zur Unterstützung zur Verfügung stellen.
Unter welchen Bedingungen kann ein bDSB abberufen werden?
Eine Abberufung ist nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes möglich, analog zu den strengen Anforderungen des Kündigungsschutzes (§ 626 BGB), um die Unabhängigkeit zu wahren.
Was war der Auslöser für die gesetzliche Neuregelung des bDSB?
Die primäre Ursache war die Umsetzung der Europäischen Datenschutzrichtlinie (DSRL 95/46/EG) in nationales Recht durch die Neufassung des Bundesdatenschutzgesetzes.
- Citar trabajo
- Sebastian Haftmann (Autor), 2002, Zum Umfang der einem behördlichen Datenschutzbeauftragten zur Verfügung zu stellenden Sach- und Personalmittel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/25664