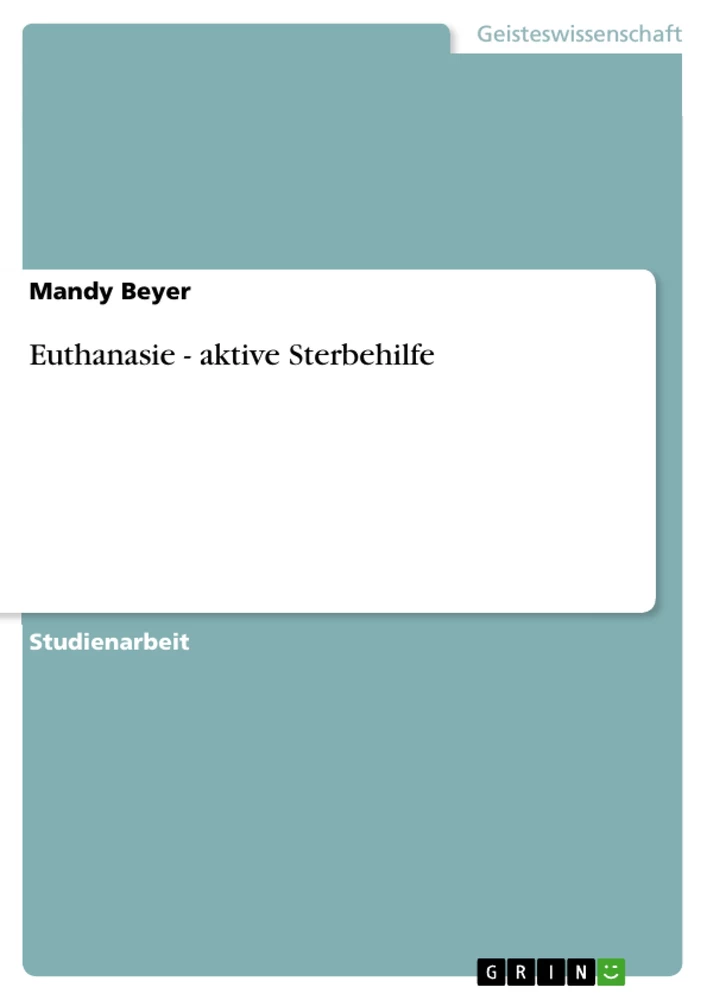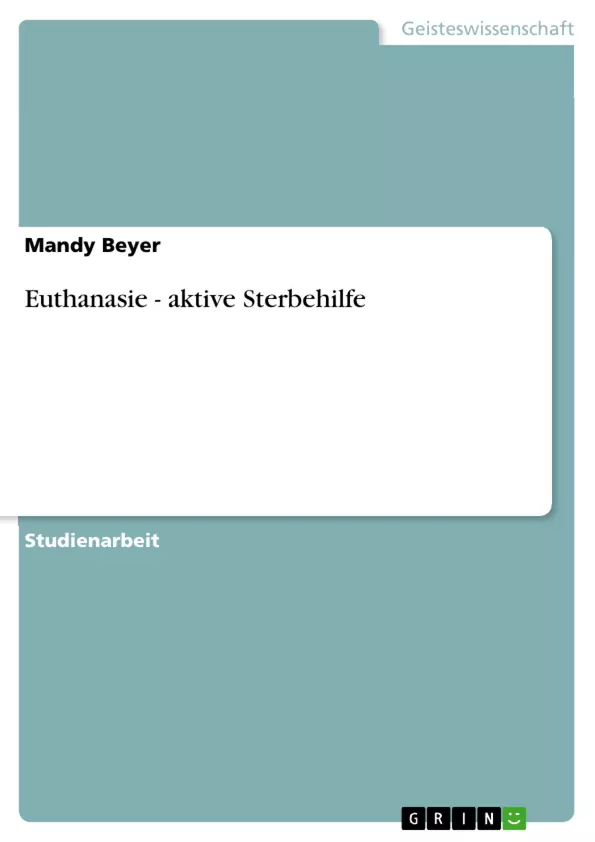Der Begriff Euthanasie ist aus dem griechischen hergeleitet und bedeutet soviel wie: "einen leichten, schönen Tod haben". Euthanasie ist das aktive, bewußte ärztliche Eingreifen zur Beendigung des Lebens auf ausdrücklichen Wunsch des Patienten. Ziel der Handlung ist es, den schnellen Tod des Patienten herbeizuführen - zu töten. Geht man in der Geschichte zurück, so stellt man fest, das der Begriff Euthanasie eine andere Bedeutung hat als aktive Sterbehilfe. Der Begriff Euthanasie könnte ein Synonym sein für das Anliegen der Hospizbewegung.
Hierbei wird von den Mitgliedern dieser Bewegung immer wieder betont, daß sie Sterbehilfe grundsätzlich ablehnen und in ihrer eigenen Aktivität eine Alternative zur aktiven Sterbehilfe sehen. In Deutschland wird besonders heftig über das Thema aktive Sterbehilfe diskutiert. Vielmals liegt es daran, daß viele Menschen vor und während des letzten Krieges von deutschen Ärzten umgebracht wurden - ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe, einer Diagnose wegen oder weil sie physisch oder psychisch behindert waren.
Obwohl die Niederlande als sehr humanitär gelten, haben sie die Sterbehilfe in den letzten Jahren zunehmend legalisiert. Sie gilt zwar immer noch als verboten, wird aber von der Justiz unter bestimmten Voraussetzungen geduldet.
In der Auseinandersetzung um Sterbehilfe und Euthanasie wird von den Befürwortern dieser Maßnahmen mit dem Mitleid argumentiert, das man gegenüber todkranken und schwer leidenden Menschen haben müsse. Das Schicksal solcher Menschen, die auch selbst diese Hilfe zum Sterben begehrten, weil Sie ihre Schmerzen und ihre Abhängigkeit von anderen nicht mehr ertragen könnten, müsse so erleichtert werden. Eine Variante dieser Haltung stellt beispielsweise die Forderung nach der Tötung von schwerstbehinderten Neugeborenen nach der Geburt dar. Beide Haltungen werden damit begründet, daß Sterbende, Todkranke und Behinderte den Kriterien für ein würdiges, gesundes und selbstbestimmendes Leben nicht genügen. Es ist jedoch eine strikte Trennung vorzunehmen zwischen der verständlichen und nachvollziehbaren individuellen Angst vor Krankheit sowie Behinderung und der Macht, die "Gesunde", "Normale", Nichtbehinderte und Experten haben, festzulegen welches Leben gesund, selbstbestimmt und würdig ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fallbeispiel „Der Wunsch(?), getötet zu werden”
- Die Überlegungen des Mitarbeiters
- Argumente, die für aktive Sterbehilfe sprechen können
- Das Recht des Patienten auf Autonomie
- Unerträgliche und ungelinderte Schmerzen und andere physische und psychische Probleme
- Die Aufgabe der Ärzte ist es, das „Beste” für ihre Patienten zu tun
- Die Ärzte haben längst angefangen, Leben und Tod zu manipulieren
- Argumente, die gegen aktive Sterbehilfe sprechen
- Aktive Sterbehilfe ist verboten und strafbar
- Berufsethische Aspekte
- Menschen werden vorzeitig sterben
- Menschen können es als ihre Pflicht ansehen, aus dem Leben zu scheiden
- Schmerzen, andere Symptome, Angst und Not können durch gute Palliativmedizin gelindert werden
- Wir zeigen durch Euthanasie diesen Patienten, daß sie für uns nichts mehr wert sind
- Argumente, die für aktive Sterbehilfe sprechen können
- Die Verbindung zwischen aktiver Sterbehilfe und dem Utilitarismus
- Die Verbindung zwischen aktiver Sterbehilfe und der Verantwortungsethik
- Schluß
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der ethischen Problematik der aktiven Sterbehilfe, insbesondere im Kontext des Fallbeispiels einer Patientin mit einem Hirntumor. Die Autorin analysiert die Argumente für und gegen die aktive Sterbehilfe und setzt diese in Bezug zu ethischen Theorien wie dem Utilitarismus und der Verantwortungsethik.
- Recht auf Autonomie des Patienten im Angesicht unheilbarer Krankheiten
- Abwägung von Lebensqualität und Lebenserhaltung bei unheilbaren Krankheiten
- Ethische Aspekte der ärztlichen Entscheidungsfindung im Kontext der Sterbehilfe
- Verbindung von ethischen Theorien und der Praxis der aktiven Sterbehilfe
- Die Rolle des Patientenwunsches und die ethischen Grenzen der ärztlichen Handlungsfreiheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in die Problematik der aktiven Sterbehilfe ein und beleuchtet die historischen und gesellschaftlichen Hintergründe des Themas. Im zweiten Kapitel wird ein Fallbeispiel vorgestellt, in dem eine Patientin mit einem Hirntumor den Wunsch äußert, ihr Leben zu beenden. Kapitel 3 analysiert die Argumente für und gegen die aktive Sterbehilfe, indem die Autorin verschiedene ethische Aspekte beleuchtet. Die Kapitel 4 und 5 befassen sich mit der Verbindung zwischen aktiver Sterbehilfe und dem Utilitarismus sowie der Verantwortungsethik.
Schlüsselwörter
Aktive Sterbehilfe, Euthanasie, Patientenautonomie, Lebensqualität, Leid, Ethik, Utilitarismus, Verantwortungsethik, Arzt-Patienten-Beziehung, Fallbeispiel, Recht auf Selbstbestimmung, Sterbebegleitung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Begriff Euthanasie ursprünglich?
Abgeleitet aus dem Griechischen bedeutet es "einen leichten, schönen Tod haben", wird heute jedoch meist als aktive Sterbehilfe verstanden.
Welche Argumente sprechen für aktive Sterbehilfe?
Dazu gehören das Recht des Patienten auf Autonomie sowie die Linderung unerträglicher und unheilbarer Schmerzen.
Was sind die Hauptargumente gegen aktive Sterbehilfe?
Gegner führen berufsethische Aspekte an, warnen vor Missbrauch, weisen auf die Möglichkeiten der Palliativmedizin hin und betonen das gesetzliche Verbot.
Was ist der Unterschied zwischen Euthanasie und Hospizbewegung?
Die Hospizbewegung lehnt aktive Sterbehilfe ab und bietet stattdessen eine umfassende Sterbebegleitung und Schmerzlinderung als Alternative an.
Wie wird Sterbehilfe in den Niederlanden gehandhabt?
Obwohl sie dort legalisiert wurde, unterliegt sie strengen Voraussetzungen und wird von der Justiz unter bestimmten Bedingungen geduldet.
Welche Rolle spielt die Verantwortungsethik in diesem Kontext?
Sie fordert dazu auf, die langfristigen Folgen einer Legalisierung für die Gesellschaft und das Arzt-Patienten-Verhältnis abzuwägen.
- Quote paper
- Mandy Beyer (Author), 2001, Euthanasie - aktive Sterbehilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/2608