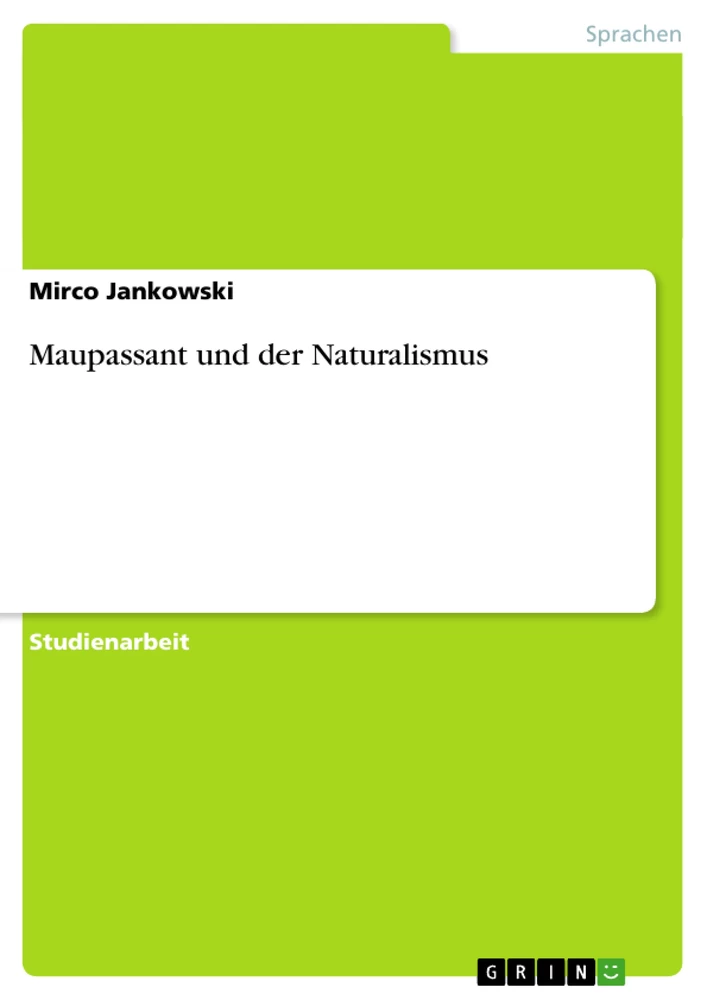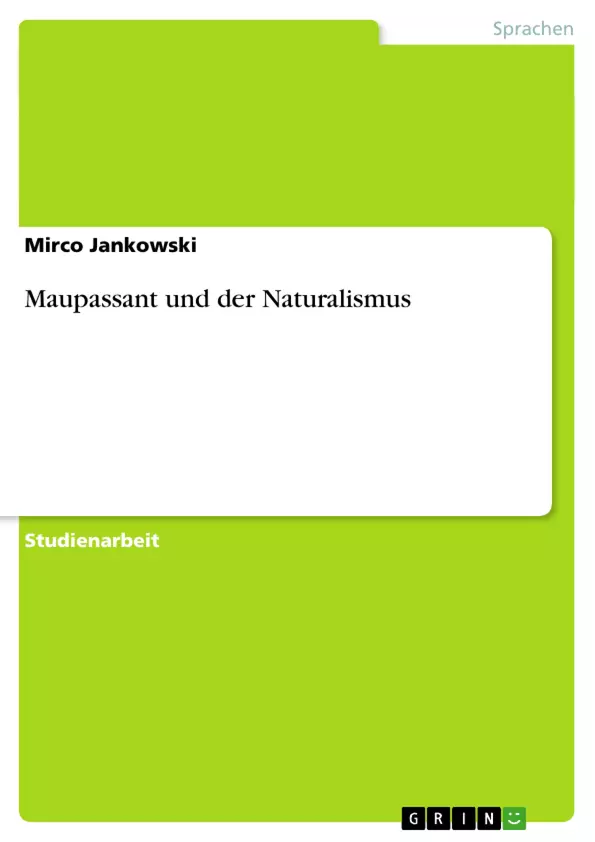Ohne jeden Zweifel ist Guy de Maupassant (1850-1893) mit seinen sechs Romanen und über 300 Novellen zu den bedeutenden französischen Autoren des 19. Jahrhunderts zu zählen und auch heute noch hat die Besprechung seiner Novellen einen festen Platz im Literaturkanon deutscher Gymnasien. Typischerweise wird das Werk Maupassants hierbei, wie auch in der fachwissenschaftlichen Literatur, stets in einen Kontext mit der
literarischen Schule des Naturalismus gestellt. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zunächst fällt die Schaffensperiode des Novellen- und Romanautors in die Blütezeit des sich ab etwa 1864 formierenden Naturalismus. Des Weiteren kann der enge Kontakt, den Maupassant mit Emile Zola (1840-1902), dem nach allgemeinem Konsens die Rolle des Hauptvertreters naturalistischer Literatur zukommt, pflegte, nicht übergangen werden.
Diese Arbeit setzt sich mit der Fragestellung auseinander, inwiefern Maupassant und seine Veröffentlichungen dem Naturalismus nahe stehen. In einem ersten Schritt soll der wirtschaftliche, gesellschaftliche und geschichtliche Hintergrund aus dem sich die Motive und Ideen des Naturalismus nährten, beleuchtet werden. Gefragt werden wird ebenfalls, ob sich naturalismustypische Motive auch in den Novellen Maupassants wieder
finden lassen. Anschließend wendet sich die Arbeit einer Analyse der Naturalismustheorie Zolas zu. Da es die Vertreter des literarischen Naturalismus versäumt hatten ein Manifest und damit eine klare allgemeingültige Definition ihrer literarischen Schule herauszugeben, soll die Theorie Zolas als Maßstab angesetzt werden, um Rückschlüsse
über die Stellung Maupassants zum Naturalismus ziehen zu können. Eine Untersuchung über Unterschiede in den Literaturtheorien Maupassants und Zolas schließt sich an.
Weiteren Aufschluss über die zentrale Fragestellung dieser Arbeit soll ein Blick auf die Rezeptionsgeschichte der Werke Maupassants und die autobiographischen Selbstzeugnisse des Autors liefern.
Ein kurzes Fazit soll diese Hausarbeit abschließen.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Der Naturalismus und sein geschichtlicher Hintergrund
3 Emile Zolas Theorie des Naturalismus
3.1 Grundlagen der Zolaschen Naturalismustheorie
4 Die Literaturtheorien Zolas und Maupassants - ein Vergleich
4.1 Determinismen in den Romanen Zolas und den Novellen Maupassants
4.2 Weitere Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Literaturtheorien Maupassants und Zolas
5 Maupassant aus der Perspektive seiner zeitgenössischen Kritiker
6 Maupassants Selbstdefinition
7 Fazit
Bibliographie
1 Einleitung
Ohne jeden Zweifel ist Guy de Maupassant (1850-1893) mit seinen sechs Romanen und über 300 Novellen zu den bedeutenden französischen Autoren des 19. Jahrhunderts zu zählen und auch heute noch hat die Besprechung seiner Novellen einen festen Platz im Literaturkanon deutscher Gymnasien. Typischerweise wird das Werk Maupassants hierbei, wie auch in der fachwissenschaftlichen Literatur, stets in einen Kontext mit der literarischen Schule des Naturalismus gestellt. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zu- nächst fällt die Schaffensperiode des Novellen- und Romanautors in die Blütezeit des sich ab etwa 1864 formierenden Naturalismus. Des Weiteren kann der enge Kontakt, den Maupassant mit Emile Zola (1840-1902), dem nach allgemeinem Konsens die Rol- le des Hauptvertreters naturalistischer Literatur zukommt, pflegte, nicht übergangen werden.
Diese Arbeit setzt sich mit der Fragestellung auseinander, inwiefern Maupassant und seine Veröffentlichungen dem Naturalismus nahe stehen. In einem ersten Schritt soll der wirtschaftliche, gesellschaftliche und geschichtliche Hintergrund aus dem sich die Motive und Ideen des Naturalismus nährten, beleuchtet werden. Gefragt werden wird ebenfalls, ob sich naturalismustypische Motive auch in den Novellen Maupassants wie- der finden lassen. Anschließend wendet sich die Arbeit einer Analyse der Naturalis- mustheorie Zolas zu. Da es die Vertreter des literarischen Naturalismus versäumt hatten ein Manifest und damit eine klare allgemeingültige Definition ihrer literarischen Schule herauszugeben, soll die Theorie Zolas als Maßstab angesetzt werden, um Rückschlüsse über die Stellung Maupassants zum Naturalismus ziehen zu können. Eine Untersu- chung über Unterschiede in den Literaturtheorien Maupassants und Zolas schließt sich an.
Weiteren Aufschluss über die zentrale Fragestellung dieser Arbeit soll ein Blick auf die Rezeptionsgeschichte der Werke Maupassants und die autobiographischen Selbstzeugnisse des Autors liefern.
Ein kurzes Fazit soll diese Hausarbeit abschließen.
2 Der Naturalismus und sein geschichtlicher Hintergrund
Die Begriffe Naturalismus und Naturalist finden heute ihre primäre Bedeutung in der Bezeichnung der künstlerischen Epoche. Anhand des Bedeutungswandels, den beide Wörter im Verlauf der Jahrhunderte durchlebt haben, lassen sich erste Rückschlüsse auf die programmatischen Inhalte des Naturalismus ziehen. Nachdem zunächst Naturwis- senschaftler und Biologen als Naturalisten bezeichnet wurden, wurde im 18. Jahrhun- dert ein philosophisches Moment in die Definition integriert. Einem Eintrag im Dic- tionnaire de Furetière aus dem Jahre 1727 zufolge ist derjenige Naturalist, „[qui expi- que; M.J.] les phénomènes par les lois du mécanisme et sans recourir à des causes sur- naturelles“1. Die Ablehnung metaphysischer Erklärungsmodelle ist somit als zentraler Bestandteil der naturalistischen Forschung jener Zeit zu begreifen. Im 19. Jahrhundert wurden die Begriffe durch den Kunstkritiker Castagnary 1863 erstmals in einen Zu- sammenhang mit der Kunst gesetzt. Zeitgenössische Malerei, die sich um eine abbil- dende Darstellung der Realität bemüht, wurde von ihm als Produkt einer naturalisti- schen Schule betitelt.2 Anlässlich des Salons von 1863 erläutert Castagnary sein Vers- tändnis von Naturalismus in der Malerei: „L’école naturaliste affirme que l’art est l’expression de la vie sous tous ses modes et à tous ses dégrés […] et son but unique est de reproduire la nature en l’amenant à son maximum de puissance et d’intensité. C’est la vérité s’équilibrant avec la science“3. Naturalistische Malerei schaffe also eine Wahrheit, die in ihrem Wert der Wissenschaft in nichts nachstehe.
Im Jahr 1865 war es Emile Zola (1840-1902), der den Begriff Naturalismus in die Lite- ratur transferierte4 und später zum bekanntesten und wichtigsten französischen Vertre- ter naturalistischer Literaturproduktion avancieren sollte. Zola verstand den Naturalis- mus als „mouvement […] de l’intelligence du siècle“5 und war der Überzeugung, „[que; M.J] l’évolution naturaliste […] emporte le siècle“6. Dieser Stellungnahme lässt sich entnehmen, dass Zola im Naturalismus die zentrale Kunstströmung des Jahrhun- derts sah. Des Weiteren weisen die genannten Anmerkungen Zolas auf einen Glauben hin, demzufolge sich die Literatur parallel zu den Veränderungen der Lebensumstände entwickele. Um nun zu erkennen aus welchen Quellen naturalistisches Gedankengut schöpft und damit den Hintergrund der Strömung zu erfassen, scheint eine genauere Betrachtung der wirtschaftlichen, sozialen und technischen Neuerungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts angebracht.
Das 19. Jahrhundert ist das Jahrhundert der industriellen Revolution in Westeuropa, deren Auswirkungen sich sowohl in einem Wandel der individuellen Lebensbedingun- gen der Menschen als auch in der Literatur jener Zeit manifestieren. Yves Chevrel ur- teilt, „que la révolution industrielle du XIXe siècle modifie très sensiblement les moda- lités du fonctionnement de la littérature dans un monde en pleine expansion“7. Auch in den Novellen Maupassants finden sich die Erfahrungen und Eindrücke, die die Indust- rialisierung dem Individuum aufzwingt, verarbeitet. So lässt Maupassant in der Novelle Une partie de campagne seinen Erzähler die Randgebiete Paris wie folgt beschreiben:
De loin en loin, poussaient dans le sol stérile de longues cheminées de fabrique, seul végétation de ces champs putrides où la brise du printemps promenait un parfum de pétrole et de schiste mêlé à une autre odeur moins agréable encore.8
Es wird hier das Bild einer degenerierten Natur entworfen, deren charakteristisches Merkmal eine Verquickung mit den Erscheinungsformen industrieller Großproduktion ist. So gedeihen in der beschriebenen Umgebung keineswegs Bäume oder Sträucher - es sind Fabrikschornsteine, die ihre Funktion übernehmen und die einzige Vegetation auf dem ansonsten unfruchtbaren Boden darstellen. Ebenfalls wird der Leser durch die unerwartete Nennung von Öl und Schiefer als Düfte des Frühlings überrascht.
Der Titel der Novelle verweist indes indirekt auf die Distanz, die zwischen urbanem und ländlichem Leben entstanden ist. Die Protagonisten der Novelle, die Pariser Fami- lie Dufour, brechen zu einer Ausfahrt ins Umland der Stadt auf, was für sie keinesfalls eine Alltäglichkeit ist. Da dem Ausflug fünf Monate Planung vorausgingen und auch der Wagen, der die Familie in die ‚Natur’ bringen sollte, sorgsam präpariert wurde, um aus dem Inneren den Blick auf die Umgebung zu ermöglichen9, lässt sich darauf schlie- ßen, dass die Fahrt eine Besonderheit im Leben der Familie darstellt. Schließlich zeigt sich die Ehefrau beim Erreichen der Pariser Stadtgrenze sofort von der Natur gerührt.10 Es scheint daher, als habe eine Entfremdung der Protagonisten von der Natur stattge- funden. Wenngleich Großstadtbewohner zu jeder Zeit tendenziell Gefahr laufen, auf- grund ihrer räumlichen Distanz zur ländlichen Umgebung, den Bezug zur Natur zu ver- lieren oder gar nicht erst aufzubauen, erhielt diese Problematik in der Zeit der Industria- lisierung, die durch einen teilweise rasanten Bevölkerungswachstum in den Städten gekennzeichnet war, besondere Brisanz. Maupassant hat somit in Une partie de cam- pagne eine typische Folge der Industrialisierung dargestellt.
Yves Chevrel nennt weitere Veränderungen der Lebensumstände in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Einfluss auf die Literatur genommen haben. Zu nennen seien nach Chevrel die Entdeckung neuer Naturgesetze und deren praktische Anwendung in der Wissenschaft, die Aufteilung der Welt im Zuge der Kolonisierung sowie das Zu- sammenwachsen der Welt durch den Aufbau des Eisenbahnnetzes. Mit Hilfe der Eisen- bahn sei es möglich geworden, literarische Werke oder wissenschaftliche Forschungs- ergebnisse deutlich schneller über den Kontinent zu schicken. Weitere Entwicklungen im Bereich der Kommunikationstechnologien hätten schließlich Künstlern und Schrift- stellern ermöglicht ihre Werke ebenso schnell im Ausland wie im Inland zu veröffentli- chen.11 Dies alles bewegt Chevrel zu urteilen, dass „[t]oute la vie littéraire de la se- conde moitié du XIXe siècle se déroule sur un fond d’histoire économique, sociale, mentale [et ; M.J.] politique“12.
Nachdem in diesem Kapitel die geschichtlichen Hintergründe des Naturalismus benannt wurden, soll im Folgenden der Blick auf die naturalistische Theorie Zolas, der gleich- sam als Begründer und Hauptvertreter des literarischen Naturalismus gilt, gelenkt wer- den.
3 Emile Zolas Theorie des Naturalismus
Das literarische Werk Emile Zolas lässt sich in drei verschiedene Schaffensphasen un- tergliedern. Während sich Zola in einer ersten Phase insbesondere mit seiner theoreti- schen Schrift Mes haines (1860) gegen die literarische Produktion der Romantik wand- te und für den Realismus und den Empirismus plädierte, erarbeitete der Autor in einer zweiten Phase eine naturalistische Theorie, die er in seiner dritten Schaffensphase, ab 1871, insbesondere in seinem 20bändigen Romanzyklus der Rougon-Macquart, litera- risch umsetzte.
Zola publizierte seinen ersten Entwurf einer naturalistischen Theorie im Vorwort der zweiten Auflage seines Romans Thérèse Raquin im Jahr 1868. Die Ideen, die diesen Entwurf prägen, waren jedoch keinesfalls neu. Vielmehr wird Zola unterstellt, sich auf die Brüder Goncourt und ihr Hauptwerk, den Roman Germinie Lacerteux (1864), der als erstes Werk einer naturalismusnahen Schule in Frankreich gilt, zu beziehen. „[I]l [Zola; M.J.] partage leur goût de l’observation directe et du document, leur souhait d’ouvrir le roman à toutes les classes sociales et de peindre les personnages d’après nature, déterminés par leur milieu“13, urteilt Jacques Vassevière. Chevrel glaubt: „La courte préface de Germinie Lacerteux, datée d’octobre 1864 rassemble l’essentiel des idées que Zola populisera et appliquera“14. Ein Blick in das genannte Vorwort offenbart die Intentionen, die die Brüder Goncourt mit ihrem Roman verfolgten. Ausgehend von der Überzeugung, dass in einer Zeit der Demokratisierung und Liberalisierung der Ro- man auch die Menschen der unteren Klassen ein Recht darauf hätten, ihre typische Le- benssituation im Roman verarbeitet zu sehen, haben Edmond und Jules Goncourt sich um Darstellung der sozialen und menschlichen Probleme einer Protagonistin, die der untersten Gesellschaftsschicht angehört, bemüht.15 Sie können daher betonen, „[que; M.J.] ce livre vient de la rue“16. Bezüglich der Aufgaben und Freiheiten des Romans äußern sich die Brüder Goncourt wie folgt:
„Aujourd’hui que le Roman s’élargit et grandit, qu’il commence à être la grande forme sérieuse, passionnée, vivante de l’étude littéraire et de l’enquête sociale, qu’il devient par l’analyse et par la recherche psychologique, l’Histoire morale contemporaine, aujourd’hui que le Roman s’est imposé les études et les devoirs de la Science, il peut en revendiquer les libertés et les franchi- ses.“17
Im Sinne der Brüder Goncourt dürfe sich der Roman also aufgrund seiner Entwicklung zu einer ernstzunehmenden Literaturform gewisse Freiheiten erlauben, die sich im Falle von Germinie Lacerteux nicht zuletzt durch die Wahl einer Protagonistin aus der un- tersten Gesellschaftsschicht zeigen. Des Weiteren wird dem Roman im Konzept der Goncourts eine soziologische Relevanz zugeschrieben: Er ist lebendiger Teil einer en- quête sociale. Schließlich heben die Brüder Goncourt hervor, dass der Roman Aufga- ben der Wissenschaft übernehme, zumal in ihm psychologische Analysen und For- schungen nicht ausgespart werden würden. Spätestens hier werden die Berührungs- punkte mit dem Naturalismuskonzept Zolas deutlich. Auch Zola bekräftigte im Vorwort von Thérèse Raquin, bei der Erarbeitung des Romans streng wissenschaftlich vorge- gangen zu sein:
„Dans Thérèse Raquin, j’ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. […] J’ai choi- si des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbi- tre, entrainés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. Thérèse et Laurent sont des brutes humaines, rien de plus. J’ai cherché à suivre pas à pas dans ces brutes le travail sourd des passions, les poussées de l’instinct, les détraquements cérébraux survenus à la suite d’une crise nerveuse. […] On commence, j’espère, à comprendre que mon but a été un but scientifique avant tout. […] J’ai simplement fait sur deux corps vivants le travail analytique que les chirurgiens font sur des cadavres. […] [Mon point de départ est; M.J.] l’étude du tempérament et des modifications de l’organisme sous la pression des milieux et des circonstances.“18
Zola vergleicht die psychologische Untersuchung, die er an seinen Charakteren durchführt mit der analytischen Arbeit, die ein Chirurg an Kadavern verübt. Zu erwarten ist daher eine emotionslose, von wissenschaftlichem Interesse getragene brutale oder gar rücksichtslose Untersuchung. Während ein Chirurg es sich nur bei einer Obduktion erlauben kann, auch die lebenswichtigen Organe einer genauen Betrachtung zu unterziehen, ohne dem Patienten zu schaden, beabsichtigt Zola eben eine solche Untersuchung an der Psyche der Charaktere seines Romans zu unternehmen.
Die von Zola gewählten Charaktere agieren vollkommen instinktgeleitet, sie sind dominés par leurs nerfs et leur sang und entrainés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair. In ihrem Verhalten unterscheiden sich die Charaktere somit nicht deutlich von Tieren. Schließlich baut Zola seinen Roman auf der These auf, dass der Mensch durch den Druck seines Milieus fremdbestimmt sei. Nach Zola komme es durch den Druck des Milieus zu tief greifenden Veränderungen des Organismus.
[...]
1 Dictionnaire de Furetière 1727, Zit. n. Becker, Colette: Lire le réalisme et le naturalisme. Paris 2000, S. 74.
2 vgl. Becker (2000), S. 74f.
3 Salons 1863, Zit. n. Carlier, Christophe: Le roman naturaliste: Zola, Maupassant. Paris 1999, S. 41.
4 Becker (2000), S. 75.
5 Zola, Emile: Le Roman expérimental. Paris 2006, S. 80.
6 Zola (2006), S. 47.
7 Chevrel, Yves: Le naturalisme. Paris 1982, S. 33.
8 Maupassant, Guy de: „Une partie de campagne“. In: Ders.: Contes et nouvelles. Band I. Paris 1974a, S. 245.
9 vgl. Maupassant (1974a), S. 244.
10 vgl. ebd..
11 vgl. Chevrel (1982), S. 34.
12 Chevrel (1982), S. 33.
13 Vassevière, Jacques: „Zola, Maupassant et le naturalisme. Le naturalisme de Zola.“ In: L’école des lettres 19 (1999), S. 47.
14 Chevrel, S. 40.
15 vgl. Goncourt, Edmond et Jules de: Germinie Lacerteux. Paris 1979, S. 23f. (Vorwort der Autoren)
16 Goncourt (1979), S. 23.
17 ebd. S. 24.
18 Zola, Emile: Thérèse Raquin. Paris 1970, S. 59f. (Vorwort des Autors)
Gilt Guy de Maupassant als Vertreter des Naturalismus?
Ja, Maupassant wird traditionell dem Naturalismus zugeordnet, da seine Schaffenszeit in die Blütephase dieser Epoche fiel und er engen Kontakt zu Emile Zola pflegte. Dennoch gibt es Unterschiede in ihren Literaturtheorien.
Was sind die Kernmerkmale von Zolas Naturalismus-Theorie?
Zola sah die Literatur als eine Art Wissenschaft. Er lehnte metaphysische Erklärungen ab und betonte den Determinismus, also die Vorbestimmtheit des Menschen durch Vererbung und Milieu.
Wie verarbeitet Maupassant die industrielle Revolution in seinen Werken?
In Novellen wie "Une partie de campagne" beschreibt Maupassant die Entfremdung des Menschen von der Natur und zeigt die degenerierte Natur in den Randgebieten von Paris, die durch Fabrikschornsteine und Industriegerüche geprägt ist.
Worin unterscheiden sich Maupassant und Zola am deutlichsten?
Während Zola oft einen fast wissenschaftlich-dokumentarischen Anspruch verfolgte, lag Maupassants Fokus stärker auf der psychologischen Wirkung und einer künstlerisch verdichteten Darstellung der Realität, ohne sich immer strikt an Zolas "Manifeste" zu binden.
Welche Rolle spielt der Begriff "Naturalist" historisch?
Ursprünglich bezeichnete der Begriff Naturwissenschaftler und Biologen. Im 18. Jahrhundert wurde er philosophisch für die Erklärung von Phänomenen ohne übernatürliche Ursachen genutzt, bevor er im 19. Jahrhundert auf Kunst und Literatur übertragen wurde.