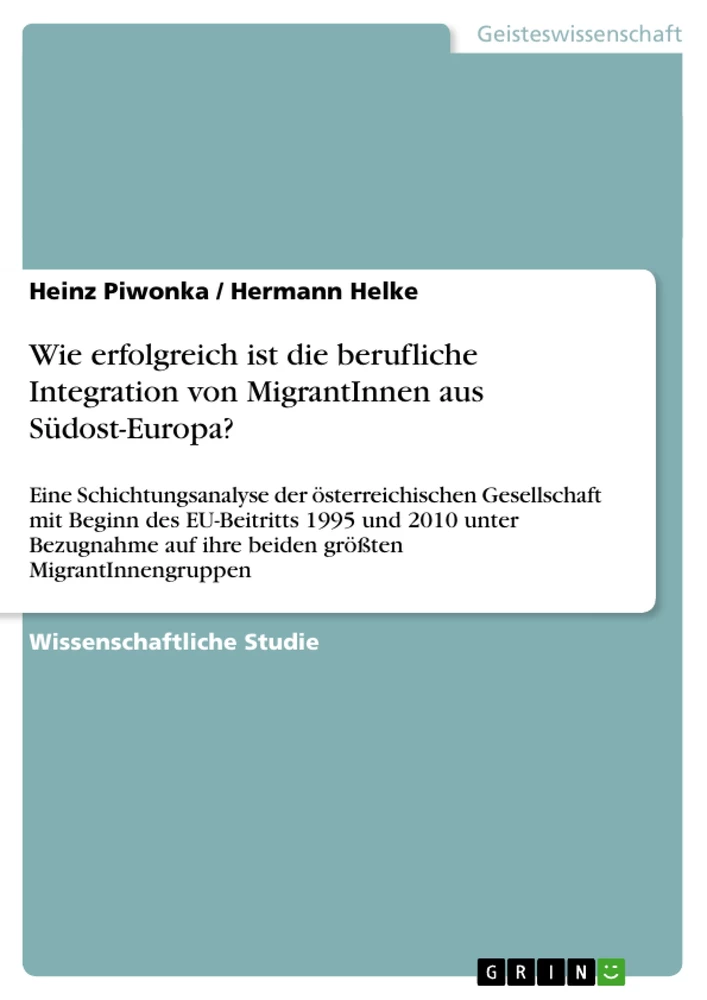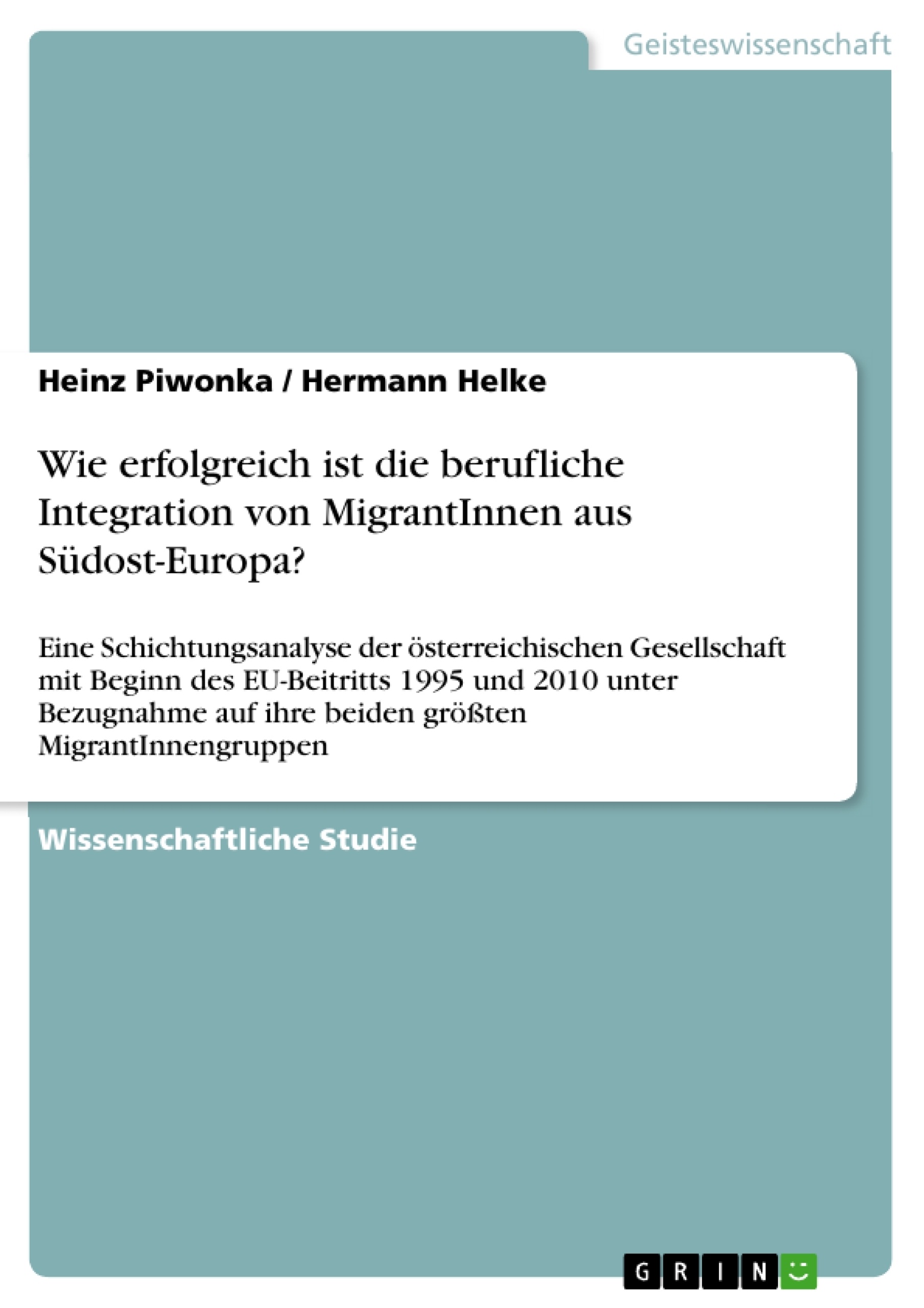Im Fokus der vorliegenden Forschungsarbeit stehen die ZuwanderInnen aus Südost-Europa. Anhand eines Vergleichs mit der österreichischen Aufnahmegesellschaft soll gezeigt werden, in wie weit es diesem Personenkreis gelingt im Laufe der Aufenthaltsjahre zwischen 1995 (dem Beitritt Österreichs zur EU und damit der Anerkennung der Niederlassungsfreiheit) bis 2010 sich in diese zu integrieren bzw. welche Dynamiken sich hieraus ergeben. Dieses nicht nur im Vergleich zur Aufnahmegesellschaft geschehen, sondern auch im Vergleich zwischen den beiden größten MigrantInnengruppen, den StaatsbürgerInnen aus den ehemali-gen Jugoslawischen Staaten und denen der Türkei. Eigene Voruntersuchungen zeigten bereits, dass im Bereich des Top-Managements nicht unbedingt zu erwartende Änderungen zu bemerken sind, auf welche in einem abschließenden Modell auch in qualitativer Hinsicht genauer eingegangen werden wird.
Die empirisch-quantitative Fundierung dieser Arbeit basiert auf den Daten des von der Statistik Austria erhobenen österreichischen Mikrozensus aus den Jahren 1995, 2000, `05 und `10. Als Indikatoren werden zunächst neben der Staatsbürgerschaft, wobei diese in diesem Zusammenhang als durchaus kritisch betrachtet werden darf, auch noch die sogenannten ISCO-Berufsgruppen herangezogen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung – Die Integration von MigrantInnen aus Südost-Europa an Hand einer Schichtanalyse
- 2. Zentrale Begriffe, Fragen und Hypothesen
- 2.1. Basale Konzepte zur Strukturierung der Überlegungen
- 2.2. Untersuchungsleitende Fragestellungen und Hypothesen
- 3. Datenbasis, Dimensionen und Auswertemethoden
- 3.1 Operationalisierung im Mikrozensus, Variablen
- 4. Ergebnisse
- 4.1. Das „Aufnahmeland“ Österreich - Vorüberlegungen zu einer geeigneten Darstellungen
- 4.2. Der Vergleich der zwei größten MigrantInnengruppen mit Österreich als Referenzgruppe
- 4.3. Das Erklärungsmodell im Einzelnen, verwendete Analysedimensionen und ihre Relevanz
- 5. Schlussbetrachtung, Zusammenfassung und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Forschungsarbeit analysiert die berufliche Integration von MigrantInnen aus Südost-Europa in Österreich. Ziel ist es, anhand eines Vergleichs mit der österreichischen Aufnahmegesellschaft aufzuzeigen, inwiefern es diesen Personenkreisen gelingt, sich in die österreichische Gesellschaft zu integrieren und welche Dynamiken sich daraus ergeben. Die Untersuchung umfasst den Zeitraum zwischen 1995, dem Beitritt Österreichs zur EU und damit der Anerkennung der Niederlassungsfreiheit, bis 2010. Dabei werden zwei größte MigrantInnengruppen, die StaatsbürgerInnen aus den ehemaligen Jugoslawischen Staaten und denen der Türkei, miteinander verglichen.
- Berufliche Integration von MigrantInnen aus Südost-Europa in Österreich
- Vergleich mit der österreichischen Aufnahmegesellschaft
- Schichtungsanalyse der österreichischen Gesellschaft
- Dynamiken der Integration von MigrantInnen
- Vergleich zwischen den beiden größten MigrantInnengruppen (Ex-Jugoslawien und Türkei)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung – Die Integration von MigrantInnen aus Südost-Europa an Hand einer Schichtanalyse
Die Einleitung stellt den Kontext der Forschungsarbeit dar und erläutert die Relevanz der Thematik. Sie bezieht sich auf die aktuelle politische Diskussion um die Revision der österreichischen Einbürgerungsgesetze und stellt die Problematik der Integration von MigrantInnen in den Mittelpunkt. Dabei werden die Herausforderungen der Unterschichtung und die Bedeutung des finanziellen Beitrags von MigrantInnen zur Aufnahmegesellschaft thematisiert.
2. Zentrale Begriffe, Fragen und Hypothesen
In diesem Kapitel werden die grundlegenden Begriffe, die in der Forschungsarbeit verwendet werden, definiert. Es werden zentrale Fragen und Hypothesen zur Analyse der beruflichen Integration von MigrantInnen aus Südost-Europa in Österreich aufgestellt.
2.1. Basale Konzepte zur Strukturierung der Überlegungen
Dieser Abschnitt definiert die Konzepte von Schichtung und Klassen, untersucht die funktionalistische Schichtungstheorie und beleuchtet den Forschungsstand. Es wird die Bedeutung von Produktions- und Eigentumsverhältnissen für die Strukturierung einer Gesellschaft sowie die Rolle von Macht und Prestige bei der Differenzierung von Gesellschaftsschichten beleuchtet. Der Abschnitt behandelt die ökonomischen Anreize zur Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schicht und die Bedeutung von Bildung und Lebenschancen.
3. Datenbasis, Dimensionen und Auswertemethoden
Kapitel 3 beschreibt die Datenbasis der Forschungsarbeit, die auf dem Mikrozensus der Statistik Austria basiert. Es werden die verwendeten Dimensionen und Auswertemethoden vorgestellt, einschließlich der Operationalisierung von Variablen und der Anwendung von ISCO-Berufsgruppen zur Definition eines „vorläufigen“ Schichtenmodells.
4. Ergebnisse
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung und analysiert die berufliche Integration von MigrantInnen aus Südost-Europa in Österreich. Es wird ein Vergleich mit der österreichischen Aufnahmegesellschaft und den beiden größten MigrantInnengruppen (Ex-Jugoslawien und Türkei) durchgeführt. Darüber hinaus wird ein Erklärungsmodell vorgestellt, das die verwendeten Analysedimensionen und ihre Relevanz beleuchtet.
Schlüsselwörter
Schichtungsanalyse, berufliche Integration, MigrantInnen, Südost-Europa, Österreich, Aufnahmegesellschaft, Vergleichsgruppen, Ex-Jugoslawien, Türkei, ISCO-Berufsgruppen, Mikrozensus, Einbürgerungsgesetze, soziale Ungleichheit, Bildung, Lebenschancen, ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, symbolisches Kapital.
- Citation du texte
- Heinz Piwonka (Auteur), Hermann Helke (Auteur), 2013, Wie erfolgreich ist die berufliche Integration von MigrantInnen aus Südost-Europa?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262367