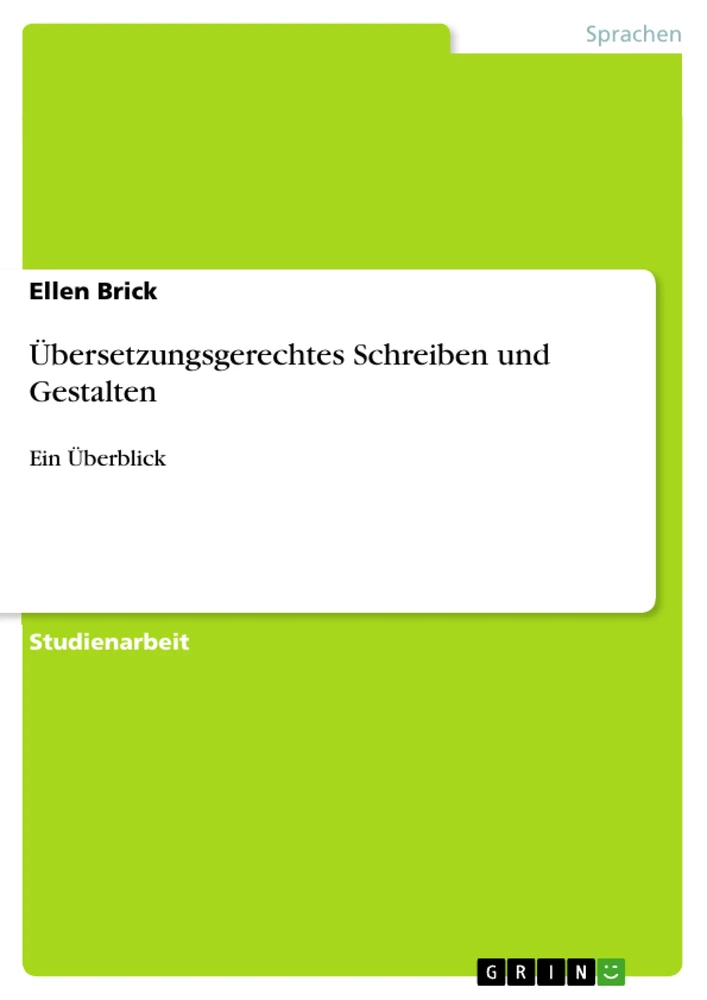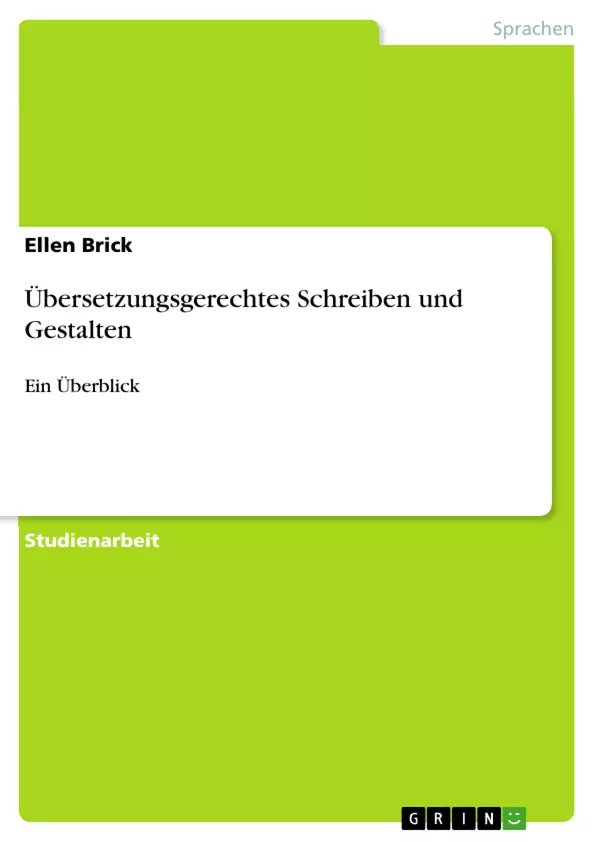Eine technische Dokumentation muss sowohl in ihrer Ausgangs- wie auch in ihrer Zielsprache hohen Qualitätsansprüchen genügen. Ist dies nicht der Fall so besteht die Möglichkeit, eine geringere Akzeptanz des Produkts am jeweiligen Zielmarkt zu erlangen wie auch eine Etablierung des Produkts zu erschweren. Die Komplexität ein jeden Übersetzungsvorgangs nimmt stetig zu, da bei der Lokalisierung nicht nur rein sprachliches sondern juristisches, technisches und kulturelles Wissen von Bedeutung ist.
Um das Übersetzungsvolumen reduzieren zu können, gilt es Zeit und Kosten zu sparen. Hierbei kommt der Aspekt des übersetzungsgerechten Schreibens und Gestaltens ins Spiel. Das Übersetzungsgerechte Schreiben und Gestalten bietet ein erhöhtes Einsparpotential bei einem steigenden Qualitätsgewinn. Die Internationalisierung und anschließende Lokalisierung wird so vereinfacht und effizienter gestaltet.
Inhaltsverzeichnis
- Warum Übersetzungsgerecht schreiben?
- Wie Übersetzungsgerecht schreiben?
- Verständliche Texte
- Beispiele nicht übersetzungsgerechte Texte - Verständlichkeit
- Prüfungsmöglichkeiten
- Konsistenz
- Beispiel nicht übersetzungsgerechte Texte - Wortebene
- Beispiel nicht übersetzungsgerechte Texte - Satzebene
- Vermeiden von Kulturspezifika
- Symbole
- Abbildungen
- Leserichtung
- Farben
- Lauflängen
- Hilfsmittel zur Erstellung übersetzungsgerechter Dokumentation
- Redaktionsleitfaden/Style Guide
- Praxisbeispiel - World Bank Translation Style Guide
- Einleitung
- Dokument Formatierung
- Gross- und Kleinschreibung
- Zeichensetzung
- Überschriften
- Akronyme und Abkürzungen
- Zusammensetzung von Wörtern
- Zahlen und Messwerte
- Namen
- Zusammenfassung Welt Bank Style Guide
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung des Textes ist es, die Prinzipien des übersetzungsgerechten Schreibens und Gestaltens technischer Dokumentationen zu erläutern und somit die Effizienz und Qualität von Übersetzungsprozessen zu verbessern. Der Text konzentriert sich auf die Reduktion des Übersetzungsaufwands durch optimierte Ausgangstextgestaltung.
- Verständlichkeit von Texten für Übersetzer und Endanwender
- Konsistenz in Formulierung und Layout
- Vermeidung kulturspezifischer Elemente
- Einsatz von Hilfsmitteln wie Redaktionsleitfäden
- Prüfung der Textverständlichkeit mittels maschineller und menschlicher Lektorate
Zusammenfassung der Kapitel
Warum Übersetzungsgerecht schreiben?: Der Text argumentiert, dass übersetzungsgerechtes Schreiben und Gestalten von technischer Dokumentation entscheidend für die Akzeptanz und den Markterfolg eines Produkts ist. Eine unzureichende Qualität der Ausgangs- und Zielsprache kann zu negativen Folgen führen. Die Komplexität der Lokalisierung, die über rein sprachliche Aspekte hinausgeht, wird hervorgehoben. Übersetzungsgerechtes Schreiben senkt das Übersetzungsvolumen und spart Zeit und Kosten, während gleichzeitig die Qualität steigt, was die Internationalisierung und Lokalisierung vereinfacht und effizienter gestaltet.
Wie Übersetzungsgerecht schreiben?: Dieses Kapitel beschreibt die Grundlagen des übersetzungsgerechten Schreibens und Gestaltens. Es betont die Wichtigkeit von einfach verständlichen, konsistenten Texten (in Formulierung und Layout) und die Vermeidung kulturspezifischer Elemente in der Ausgangssprache. Die Lokalisierung wird dadurch vereinfacht.
Verständliche Texte: Verständlichkeit ist die Grundvoraussetzung für die Übersetzbarkeit eines Textes. Ein unverständlicher Text kann vom Übersetzer nicht korrekt übersetzt werden. Der Text verweist auf die Wichtigkeit von Redaktionsleitfäden oder Style Guides, die Richtlinien für verständnisförderndes Schreiben festlegen und unverständliche Formulierungen vermeiden.
Beispiele nicht übersetzungsgerechte Texte - Verständlichkeit: Anhand von Beispielen wie Doppeldeutigkeit, Ellipsen, unklaren Bezügen und Attributanhäufungen werden typische Probleme bei der Übersetzung erläutert, die auf mangelnde Verständlichkeit des Ausgangstextes zurückzuführen sind. Diese Beispiele verdeutlichen die Bedeutung präziser und eindeutiger Formulierungen.
Prüfungsmöglichkeiten: Dieses Kapitel stellt zwei Methoden zur Prüfung der Textverständlichkeit vor: das maschinelle Lektorat mithilfe von Controlled Language Checkern (CLC) und das menschliche Lektorat. Während CLCs auf Rechtschreibung, Grammatik und stilistische Regeln prüfen, bietet das menschliche Lektorat zusätzliche Vorteile in Bezug auf Objektivität, Sprachbewusstsein und zeitliche Effizienz. Es werden sowohl Vor- als auch Nachteile beider Methoden diskutiert.
Schlüsselwörter
Übersetzungsgerechtes Schreiben, Technische Dokumentation, Lokalisierung, Verständlichkeit, Konsistenz, Kulturspezifika, Redaktionsleitfaden, Style Guide, Maschinelles Lektorat, Menschliches Lektorat, Controlled Language Checker (CLC), Übersetzungsqualität, Kostenoptimierung.
FAQ: Übersetzungsgerechtes Schreiben Technischer Dokumentationen
Was ist das Ziel des Textes "Übersetzungsgerechtes Schreiben Technischer Dokumentationen"?
Der Text erläutert die Prinzipien des übersetzungsgerechten Schreibens und Gestaltens technischer Dokumentationen, um die Effizienz und Qualität von Übersetzungsprozessen zu verbessern und den Übersetzungsaufwand durch optimierte Ausgangstextgestaltung zu reduzieren.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Schwerpunkte liegen auf der Verständlichkeit von Texten für Übersetzer und Endanwender, der Konsistenz in Formulierung und Layout, der Vermeidung kulturspezifischer Elemente, dem Einsatz von Hilfsmitteln wie Redaktionsleitfäden und der Prüfung der Textverständlichkeit mittels maschineller und menschlicher Lektorate.
Warum ist übersetzungsgerechtes Schreiben wichtig?
Übersetzungsgerechtes Schreiben ist entscheidend für die Akzeptanz und den Markterfolg eines Produkts. Eine unzureichende Qualität der Ausgangs- und Zielsprache kann zu negativen Folgen führen. Es senkt das Übersetzungsvolumen und spart Zeit und Kosten, während gleichzeitig die Qualität steigt und die Internationalisierung/Lokalisierung vereinfacht und effizienter gestaltet wird.
Wie schreibt man übersetzungsgerecht?
Übersetzungsgerechtes Schreiben beinhaltet das Erstellen von einfach verständlichen, konsistenten Texten (in Formulierung und Layout) und die Vermeidung kulturspezifischer Elemente in der Ausgangssprache. Die Lokalisierung wird dadurch vereinfacht. Es erfordert die Verwendung von klaren, eindeutigen Formulierungen und die Vermeidung von Doppeldeutigkeiten, Ellipsen und unklaren Bezügen.
Welche Rolle spielt die Verständlichkeit?
Verständlichkeit ist die Grundvoraussetzung für die Übersetzbarkeit eines Textes. Ein unverständlicher Text kann vom Übersetzer nicht korrekt übersetzt werden. Redaktionsleitfäden oder Style Guides unterstützen verständnisförderndes Schreiben und vermeiden unverständliche Formulierungen.
Wie kann man die Textverständlichkeit prüfen?
Die Prüfung der Textverständlichkeit erfolgt durch maschinelles Lektorat (mit Controlled Language Checkern - CLC) und menschliches Lektorat. CLCs prüfen Rechtschreibung, Grammatik und Stil, während das menschliche Lektorat Objektivität, Sprachbewusstsein und Effizienz bietet. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile.
Welche Hilfsmittel werden empfohlen?
Hilfsmittel wie Redaktionsleitfäden/Style Guides (z.B. der World Bank Translation Style Guide) unterstützen das übersetzungsgerechte Schreiben, indem sie Richtlinien für verständnisförderndes Schreiben und konsistente Formatierung liefern.
Welche Aspekte der Textgestaltung sind relevant?
Relevante Aspekte der Textgestaltung sind Dokumentformatierung, Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung, Überschriften, Akronyme und Abkürzungen, Wortzusammensetzung, Zahlen und Messwerte, Namen und die Berücksichtigung der Leserichtung und Farbgebung.
Welche kulturellen Aspekte sind zu beachten?
Kulturspezifische Elemente sollten vermieden werden, um die Übersetzung zu vereinfachen und eine einheitliche Botschaft in verschiedenen Kulturen zu gewährleisten. Symbole, Abbildungen und Farben müssen auf ihre kulturelle Bedeutung geprüft werden.
Welche Schlüsselwörter sind mit dem Thema verbunden?
Schlüsselwörter sind: Übersetzungsgerechtes Schreiben, Technische Dokumentation, Lokalisierung, Verständlichkeit, Konsistenz, Kulturspezifika, Redaktionsleitfaden, Style Guide, Maschinelles Lektorat, Menschliches Lektorat, Controlled Language Checker (CLC), Übersetzungsqualität, Kostenoptimierung.
- Quote paper
- Bachelor of Science Ellen Brick (Author), 2013, Übersetzungsgerechtes Schreiben und Gestalten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262375