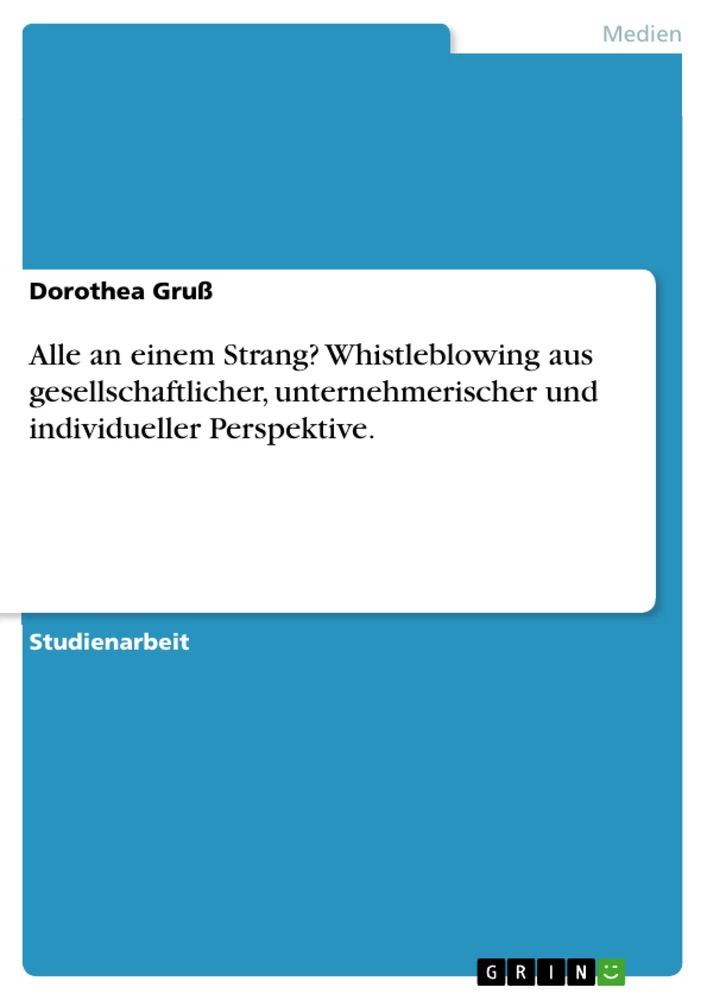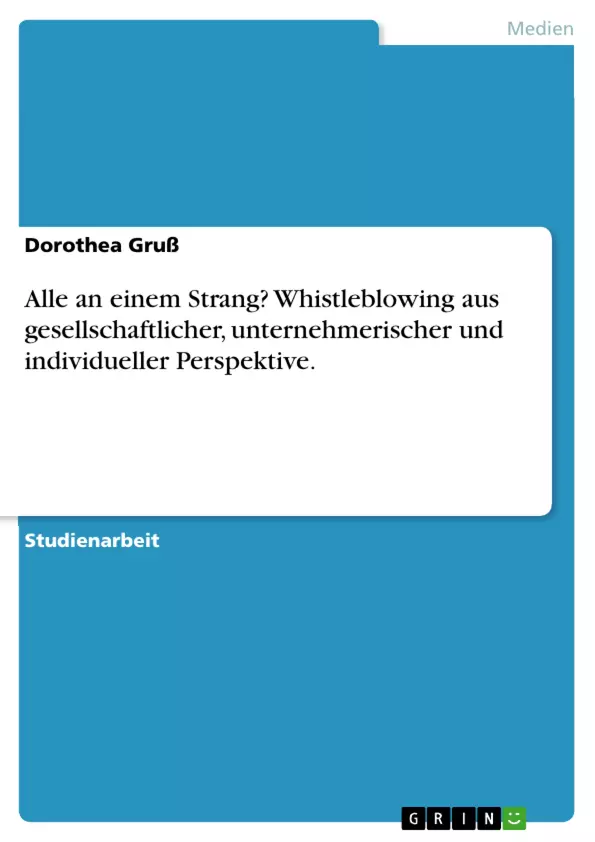Brisante Informationen enthüllen, selbstlosen Motiven folgen, Alarm schlagen, um auf Missstände in ihren Organisationen hinzuweisen, und dabei ihre (berufliche) Existenz aufs Spiel setzen. Die drei folgenden Personen taten genau dies: Daniel Ellsberg gab 1971 die geheimen Pentagon-Papiere an die Presse weiter und informierte so die Öffentlichkeit über die wahren Beweggründe der US-Regierung zum Vietnamkrieg (vgl. Whistleblowers.dk 2005: 1). Per-Yngve Monsen, Siemens-Mitarbeiter in Norwegen, wurde 2003 entlassen, weil er intern auf einen Korruptionsskandal hingewiesen hatte: Sein Arbeitgeber hatte dem norwegischen Militär überhöhte Rechnungen ausgestellt und Beamte bestochen (vgl. Herrmann 2006: 21). Brigitte Heinisch machte 2004 die mangelhafte Betreuung in einem Berliner Altenpflegeheim öffentlich – auch sie verlor ihren Arbeitsplatz (vgl. Whistleblower Netzwerk e. V. 2008: 1f.). Kürzlich erklärte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, dass diese Kündigung gegen das Recht auf Meinungsfreiheit verstößt (vgl. Whistleblower Netzwerk e. V. 2011b: 1). Ein später Trost für Brigitte Heinisch? Ein hoffnungsvolles Zeichen für all diejenigen, die angesichts illegalen oder unmoralischen Verhaltens in ihren Organisationen nicht einfach wie die drei Affen „nichts hören, nichts sehen, nichts sagen“, sondern zivilcouragiert die Stimme erheben wollen?
Werfen wir einen Blick in die Geschichte, so finden sich zahlreiche weitere, „große“ Beispiele für Zivilcourage, allen voran in der Politik: die deutsche Widerstandsbewegung im Dritten Reich, Gandhis friedlicher Weg zur indischen Unabhängigkeit, der 17. Juni 1953 in der DDR bis hin zu den aktuellen Protesten gegen die politischen Führungen in der arabischen Welt, in Chile oder in Indien. Nicht anders in der Wirtschaft: In den letzten Jahrzehnten kamen immer wieder Unternehmensskandale ans Licht, die für Diskussionen und schwindendes Vertrauen sorgten, scheint doch in der heutigen Gesellschaft eine verstärkte Suche nach alten und neuen Werten stattzufinden. Ferner kann eine „Exit-Strategie“, also dem Arbeitgeber resigniert den Rücken zu kehren, in Zeiten angespannter Jobmärkte für Mitarbeiter oft keine Alternative mehr sein. Nicht zuletzt dies mag sie dazu veranlassen, sich immer öfter zu Wort zu melden: Sie werden zu Whistleblowern.
...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretische Grundlagen
- Einführung in Konzepte und Begriffe
- Zivilcourage
- Whistleblowing
- Zusammenhang von Whistleblowing und Zivilcourage
- Corporate Governance: Compliance und Risikokommunikation
- Einführung in Konzepte und Begriffe
- Wirkungsebenen von Whistleblowing
- Staatliche/gesellschaftliche Perspektive
- Organisationale/unternehmerische Perspektive
- Spannungsfeld wirtschaftlicher Erfolg und ethische Prinzipien
- Institutionalisierung von Whistleblowing im Unternehmen
- Individuelle Perspektive
- Eigenschaften und Motive von Whistleblowern
- Chancen für Organisationen
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des Whistleblowing aus gesellschaftlicher, unternehmerischer und individueller Perspektive. Sie untersucht die verschiedenen Ebenen, auf denen sich Whistleblowing äußert, und analysiert, wie diese miteinander verschränkt sind. Die Arbeit beleuchtet die Motive von Whistleblowern, die Herausforderungen, denen sie gegenüberstehen, und die Chancen, die Whistleblowing für Organisationen bietet. Darüber hinaus werden die rechtlichen und ethischen Aspekte des Whistleblowing sowie die Rolle des Staates und der Medien in diesem Kontext untersucht.
- Zivilcourage und Whistleblowing als Formen des moralischen Handelns
- Die Herausforderungen des Whistleblowing in Unternehmen und die Bedeutung von Compliance und Risikokommunikation
- Die Bedeutung des Whistleblowing für die Gesellschaft und die Rolle des Staates beim Schutz von Whistleblowern
- Die Chancen, die Whistleblowing für Unternehmen bietet, und die Notwendigkeit einer Kultur der Verantwortlichkeit
- Die rechtlichen und ethischen Aspekte des Whistleblowing und die Frage nach dem Schutz von Hinweisgebern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die Relevanz des Themas Whistleblowing. Sie beleuchtet die Geschichte des Whistleblowing und führt einige Beispiele für Whistleblower und ihre Erfahrungen an. Kapitel 2 bietet eine theoretische Grundlage für die Analyse des Phänomens. Es werden die Konzepte von Zivilcourage und Whistleblowing definiert, die zentralen Begriffe erläutert und die Bedeutung von Corporate Governance, Compliance und Risikokommunikation in diesem Kontext herausgestellt. Kapitel 3 untersucht die Wirkungsebenen von Whistleblowing. Es analysiert die staatliche/gesellschaftliche Perspektive, die organisationale/unternehmerische Perspektive und die individuelle Perspektive. Kapitel 4 widmet sich den Chancen, die Whistleblowing für Organisationen bietet. Es verdeutlicht, wie Whistleblowing als Frühwarnsystem genutzt werden kann und wie Unternehmen eine Kultur der Verantwortlichkeit fördern können. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und wagt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen im Bereich des Whistleblowing.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Whistleblowing, Zivilcourage, Unternehmensethik, Compliance, Risikokommunikation, Corporate Governance, Hinweisgeber, Schutz von Whistleblowern, staatliche und gesellschaftliche Verantwortung, Medien und Öffentlichkeit. Die Arbeit beleuchtet die verschiedenen Ebenen, auf denen sich Whistleblowing äußert, und analysiert die Herausforderungen und Chancen, die mit diesem Phänomen verbunden sind.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Whistleblowing?
Whistleblowing bezeichnet das Enthüllen von Missständen, illegalem Handeln oder unethischem Verhalten innerhalb einer Organisation durch Insider (Hinweisgeber).
Wie hängen Zivilcourage und Whistleblowing zusammen?
Whistleblowing wird oft als Form der Zivilcourage im beruflichen Kontext gesehen, da der Hinweisgeber persönliche Risiken eingeht, um Schaden von der Gesellschaft oder dem Unternehmen abzuwenden.
Welche Perspektiven auf Whistleblowing werden untersucht?
Die Arbeit analysiert das Thema aus staatlich/gesellschaftlicher, organisationaler/unternehmerischer und individueller Sicht.
Warum ist Compliance für Unternehmen in diesem Kontext wichtig?
Compliance-Systeme bieten formale Kanäle für Whistleblowing, helfen Risiken frühzeitig zu erkennen und fördern eine ethische Unternehmenskultur.
Welche Chancen bietet Whistleblowing für Organisationen?
Es fungiert als Frühwarnsystem für Korruption oder Sicherheitsmängel und kann langfristig das Vertrauen der Öffentlichkeit und die Integrität des Unternehmens stärken.
- Quote paper
- Dorothea Gruß (Author), 2011, Alle an einem Strang? Whistleblowing aus gesellschaftlicher, unternehmerischer und individueller Perspektive., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262678