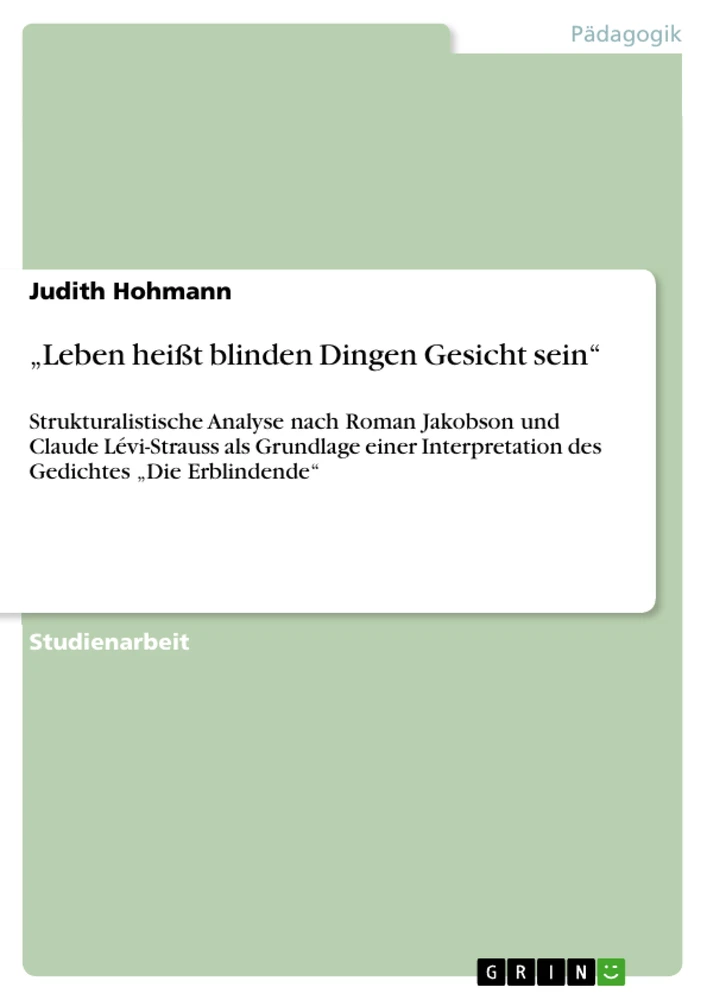Dem Thema „Blindheit“ widmet Rainer Maria Rilke insgesamt sechs Gedichte, jedoch ist der Prozess des Erblindens nur in einem 1906 verfassten Gedicht im Fokus.
Die folgende Arbeit widmet sich dem Gedicht „Die Erblindende“, welchem in der bisherigen Rilkeforschung nahezu keine Beachtung geschenkt worden ist.
In der Arbeit soll besagtes Gedicht, anhand Roman Jakobson und Claude Lévi-Strauss strukturalistischem Vorgehen an einem Gedicht von Baudelairs „Le Chat“, analysiert und interpretiert werden. Spannend dabei ist die Frage, ob Rilke in dem Gedicht eine Poetik/Grammatik des Erblindens entwickelt und inwiefern sich die Aussage des Gedichtes in seinem Aufbau wiederspiegelt.
Die aus der Analyse resultierenden Erkenntnisse werden mit der wissenschaftlichen Forschungslage zum Thema verglichen, um letztlich das strukturalistische Prinzip anhand eines Beispiels in seiner Methodik zu stärken oder aber Mängel aufzudecken.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gedichtanalyse „Die Erblindende“
- 2.1. Exkurs: Strukturalismus
- 2.2. Aufbau & Inhalt
- 2.3. Analyse
- 3. Rilkes Grammatik der Blindheit
- 4. Fazit
- 5. Literaturverzeichnis
- 5.1. Quellentexte
- 5.2. Forschungsliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert und interpretiert Rainer Maria Rilkes Gedicht „Die Erblindende“, einem in der Rilke-Forschung bisher vernachlässigten Werk. Die Analyse basiert auf dem strukturalistischen Ansatz von Roman Jakobson und Claude Lévi-Strauss, angewendet auf Baudelairs „Le Chat“. Ziel ist es, zu untersuchen, ob Rilke im Gedicht eine Poetik des Erblindens entwickelt und inwiefern sich die Aussage des Gedichts in seinem Aufbau widerspiegelt. Die Ergebnisse werden mit der bestehenden Forschungsliteratur verglichen, um die Methodik des strukturalistischen Prinzips zu evaluieren.
- Strukturalistische Gedichtanalyse nach Jakobson und Lévi-Strauss
- Rilkes Poetik der Blindheit in „Die Erblindende“
- Analyse von Aufbau und Inhalt des Gedichts
- Vergleich der Analyseergebnisse mit der Forschungsliteratur
- Evaluation der Methodik des strukturalistischen Ansatzes
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt Rilkes Zitat „Leben heißt blinden Dingen Gesicht sein“ als Ausgangspunkt vor. Sie betont die Bedeutung des Motivs der Blindheit in Rilkes Werk und hebt die bisherige Forschungslücke bezüglich des Gedichts „Die Erblindende“ hervor. Die Arbeit kündigt die geplante strukturalistische Analyse an, basierend auf dem methodischen Vorgehen von Jakobson und Lévi-Strauss, und benennt das Ziel, die Methodik des Strukturalismus anhand der Analyse zu überprüfen. Die Einleitung positioniert die Arbeit klar innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses und definiert die Forschungsfrage.
2. Gedichtanalyse „Die Erblindende“: Dieses Kapitel beginnt mit einer Erläuterung der methodischen Herangehensweise, der strukturalistischen Analyse nach Jakobson und Lévi-Strauss. Es folgt eine Zusammenfassung des Inhalts des Gedichts, bevor eine detaillierte Analyse auf phonologischer, syntaktischer und semantischer Ebene erfolgt. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Struktur des Gedichts und der Beziehung zwischen Form und Inhalt, um die möglichen Bedeutungen und die Aussagekraft des Textes zu ergründen. Die Analyse zielt darauf ab, die von Rilke möglicherweise entwickelte Poetik des Erblindens herauszuarbeiten und zu interpretieren.
Schlüsselwörter
Rainer Maria Rilke, „Die Erblindende“, Strukturalismus, Roman Jakobson, Claude Lévi-Strauss, Gedichtanalyse, Blindheit, Poetik, Grammatik, Form und Inhalt, Semantik, Syntax, Phonologie, Forschungsliteratur.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Rilkes "Die Erblindende"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert und interpretiert Rainer Maria Rilkes Gedicht "Die Erblindende", ein in der Rilke-Forschung bisher wenig beachtetes Werk. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der Poetik des Erblindens im Gedicht und der Beziehung zwischen Aufbau und Aussage.
Welche Methode wird angewendet?
Die Analyse basiert auf dem strukturalistischen Ansatz von Roman Jakobson und Claude Lévi-Strauss, angewendet ähnlich wie bei Baudelairs "Le Chat". Ziel ist es, die Methodik des Strukturalismus anhand der Gedichtanalyse zu evaluieren.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: strukturalistische Gedichtanalyse nach Jakobson und Lévi-Strauss; Rilkes Poetik der Blindheit in "Die Erblindende"; Analyse von Aufbau und Inhalt des Gedichts; Vergleich der Analyseergebnisse mit der Forschungsliteratur; Evaluation der Methodik des strukturalistischen Ansatzes.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Gedichtanalyse ("Die Erblindende"), ein Kapitel zu Rilkes Grammatik der Blindheit, ein Fazit und ein Literaturverzeichnis. Die Gedichtanalyse umfasst Exkurse zum Strukturalismus, Aufbau und Inhalt sowie eine detaillierte Analyse auf phonologischer, syntaktischer und semantischer Ebene.
Was sind die zentralen Ergebnisse der Analyse?
Die Arbeit zielt darauf ab, Rilkes mögliche Poetik des Erblindens herauszuarbeiten und zu interpretieren. Die Ergebnisse werden mit der bestehenden Forschungsliteratur verglichen, um die Anwendbarkeit und Aussagekraft des gewählten strukturalistischen Ansatzes zu beurteilen. Konkrete Ergebnisse werden im Hauptteil der Arbeit dargelegt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rainer Maria Rilke, "Die Erblindende", Strukturalismus, Roman Jakobson, Claude Lévi-Strauss, Gedichtanalyse, Blindheit, Poetik, Grammatik, Form und Inhalt, Semantik, Syntax, Phonologie, Forschungsliteratur.
Wo finde ich das vollständige Literaturverzeichnis?
Das vollständige Literaturverzeichnis mit Quelltexten und Forschungsliteratur befindet sich im letzten Kapitel der Arbeit.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage ist, ob Rilke im Gedicht "Die Erblindende" eine Poetik des Erblindens entwickelt und inwiefern sich die Aussage des Gedichts in seinem Aufbau widerspiegelt, sowie die Überprüfung der Methodik des Strukturalismus anhand dieser Analyse.
- Citation du texte
- Judith Hohmann (Auteur), 2011, „Leben heißt blinden Dingen Gesicht sein“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262797