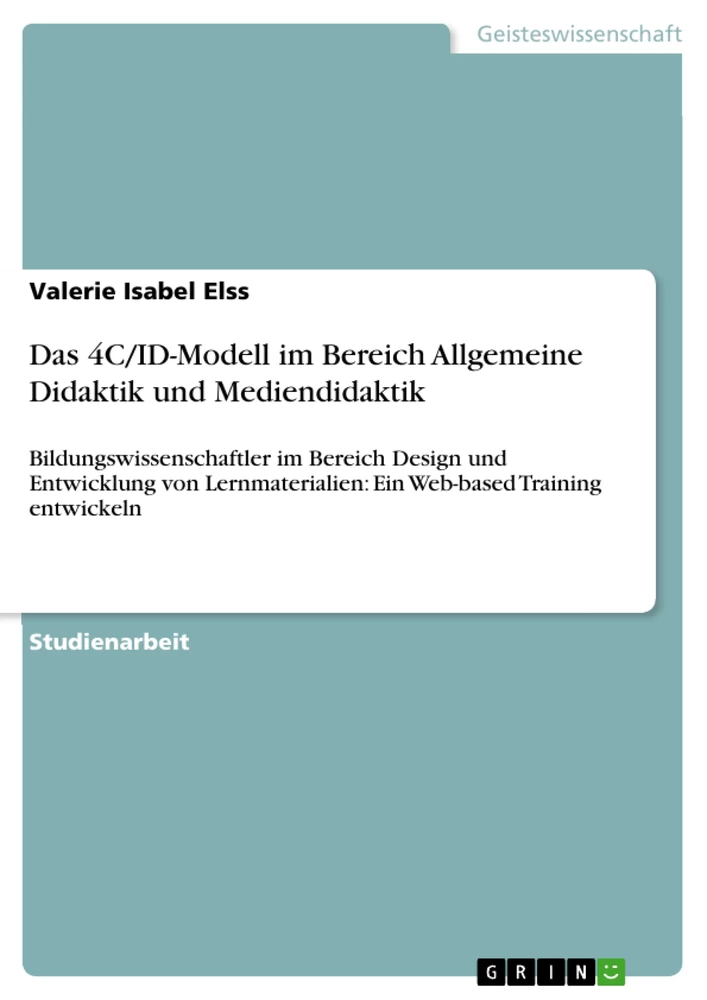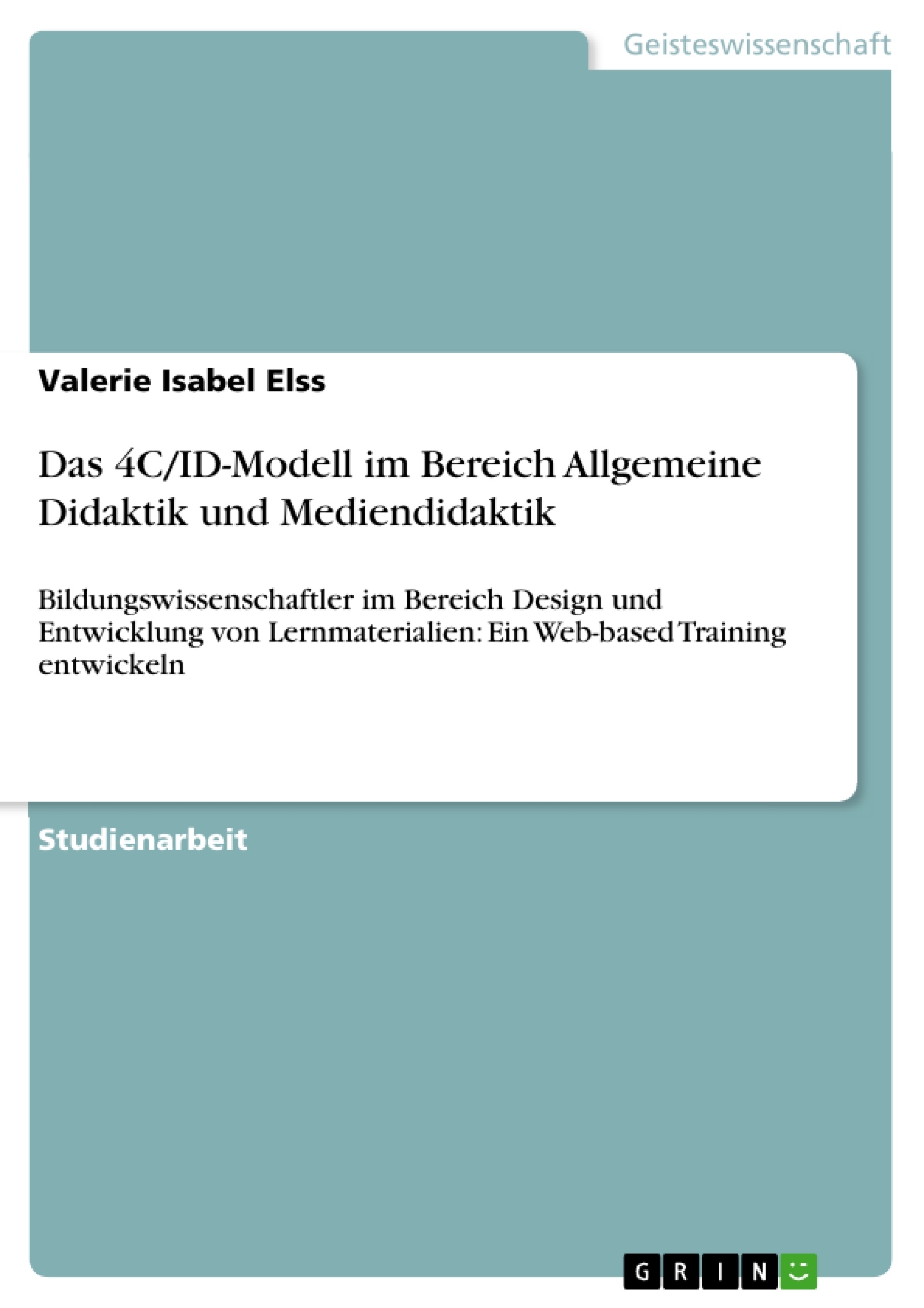Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, für einen Bildungswissenschaftler, der im Bereich Design
und Entwicklung von Lernmaterialen bei der Entwicklung eines WBTs tätig werden soll, einen
Lehrplanentwurf (sogenannter Blueprint) zu erstellen. Hierbei werden die wichtigsten
Design- und Analyseschritte des 4C/ID- Modells aufgezeigt.
Der erste Teil der Arbeit umfasst den Lernplanentwurf anhand des 4C/ID-Modells.
Im zweiten Teil werden lerntheoretische Aspekte, Gesichtspunkte des situierten Lernens und
didaktische Szenarien sowie Medien zur Unterstützung des Blueprints behandelt.
Abschließend erfolgen eine kurze Zusammenfassung der Arbeit und eine Bewertung der Eignung
des 4C/ID-Modells im Hinblick auf das hier dargestellte Anwendungsbeispiel.
Zur besseren Lesbarkeit wird im Folgenden ausschließlich die männliche Form verwendet,
gemeint sind aber explizit immer beide Geschlechter.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Lehrplanentwurf anhand des 4C/ID-Modells
- Kompetenzanalyse und Hierarchieerstellung
- Sequentialisierung der Aufgabenklassen
- Entwurf der Lernaufgaben
- Erstellung von unterstützenden Informationen
- Entwicklung von Just-in-time Informationen
- Das 4C/ID-Modell aus theoretischer Perspektive betrachtet
- Lerntheoretische Aspekte
- Aspekte des situierten Lernens
- Didaktische Szenarien
- Zur Unterstützung des Blueprints geeignete Medien
- Zusammenfassende Bewertung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Web-based Trainings (WBT) für Bildungswissenschaftler im Bereich Design und Entwicklung von Lernmaterialien. Der Fokus liegt dabei auf dem 4C/ID-Modell, einem empirisch fundierten Modell zur Gestaltung von Lernumgebungen für den Erwerb komplexer Fähigkeiten. Die Arbeit verfolgt das Ziel, einen Lehrplanentwurf (Blueprint) für ein WBT zu erstellen, welches Bildungswissenschaftler in die Lage versetzen soll, ein effektives WBT zu entwickeln.
- Kompetenzanalyse und Hierarchieerstellung im 4C/ID-Modell
- Sequenzierung von Aufgabenklassen und deren Schwierigkeitsgrad
- Entwicklung von Lernaufgaben, unterstützenden Informationen und Just-in-time Informationen
- Lerntheoretische Grundlagen des 4C/ID-Modells und des situierten Lernens
- Didaktische Szenarien und geeignete Medien zur Unterstützung des Blueprints
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in die Thematik der Kompetenzentwicklung im Bereich des Web-based Trainings (WBT) ein und stellt die Relevanz des 4C/ID-Modells als empirisch fundierte Methode zur Gestaltung von Lernumgebungen für den Erwerb komplexer Fähigkeiten dar.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf den Lehrplanentwurf anhand des 4C/ID-Modells. Es werden die einzelnen Schritte des Modells detailliert beschrieben, darunter die Kompetenzanalyse und Hierarchieerstellung, die Sequentialisierung der Aufgabenklassen, der Entwurf der Lernaufgaben, die Erstellung von unterstützenden Informationen sowie die Entwicklung von Just-in-time Informationen.
Das dritte Kapitel widmet sich der theoretischen Einordnung des 4C/ID-Modells. Es werden die Verbindungen des Modells mit verschiedenen lerntheoretischen Ansätzen wie dem Behaviorismus, Kognitivismus und Konstruktivismus sowie dem Ansatz des situierten Lernens aufgezeigt. Außerdem werden didaktische Szenarien, die sich für die Integration in das 4C/ID-Modell eignen, und geeignete Medien zur Unterstützung des Blueprints diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das 4C/ID-Modell, Web-based Training (WBT), Kompetenzentwicklung, Bildungswissenschaftler, Lernmaterialien, Design, Entwicklung, Lerntheorie, situiertes Lernen, didaktische Szenarien, Medien, Blueprint, Kompetenzanalyse, Aufgabenklassen, Lernaufgaben, unterstützende Informationen, Just-in-time Informationen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das 4C/ID-Modell?
Das 4C/ID-Modell (Four-Component Instructional Design) ist ein Modell zur Gestaltung von Lernumgebungen, das speziell auf den Erwerb komplexer kognitiver Fähigkeiten ausgerichtet ist.
Was sind die vier Komponenten des Modells?
Die Komponenten sind: Lernaufgaben (Learning Tasks), unterstützende Informationen (Supportive Information), Just-in-time Informationen und Part-task Practice (Teilaufgabenübung).
Was versteht man unter „Just-in-time Informationen“?
Dies sind Informationen, die genau in dem Moment bereitgestellt werden, in dem der Lernende sie zur Ausführung einer spezifischen Routinehandlung benötigt.
Auf welchen Lerntheorien basiert das 4C/ID-Modell?
Das Modell integriert Aspekte des Kognitivismus und Konstruktivismus sowie Ansätze des situierten Lernens, um einen effektiven Kompetenztransfer zu ermöglichen.
Wofür wird ein „Blueprint“ im 4C/ID-Modell benötigt?
Ein Blueprint ist ein detaillierter Lehrplanentwurf, der die Sequenzierung von Aufgabenklassen und die notwendigen Instruktionsmedien für die Entwicklung eines Web-based Trainings (WBT) festlegt.
- Citation du texte
- Valerie Isabel Elss (Auteur), 2013, Das 4C/ID-Modell im Bereich Allgemeine Didaktik und Mediendidaktik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/262810