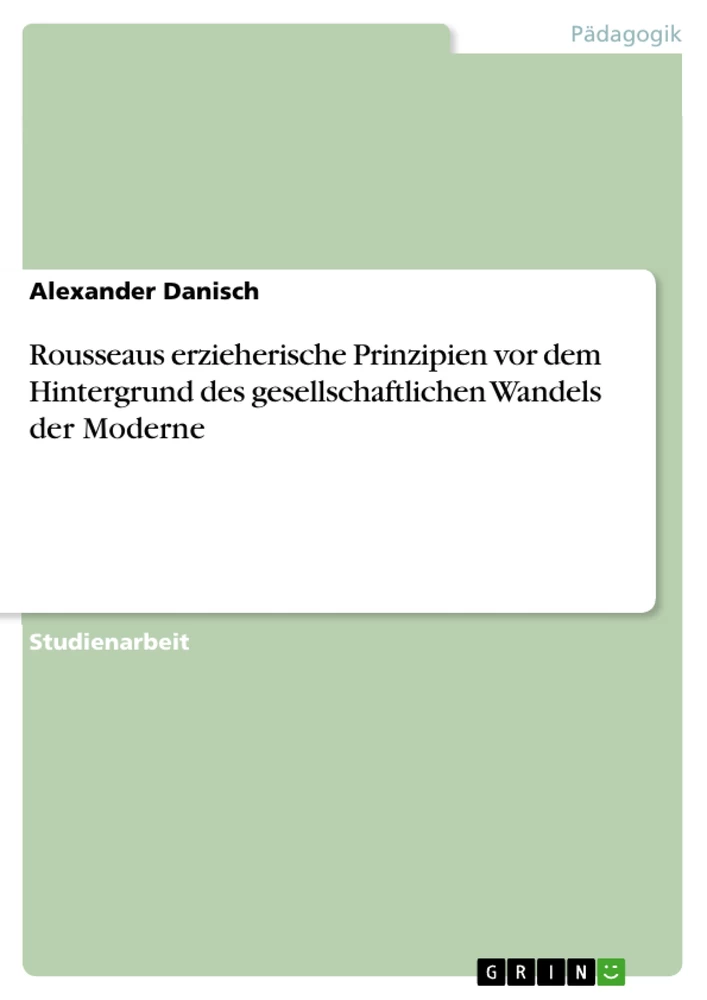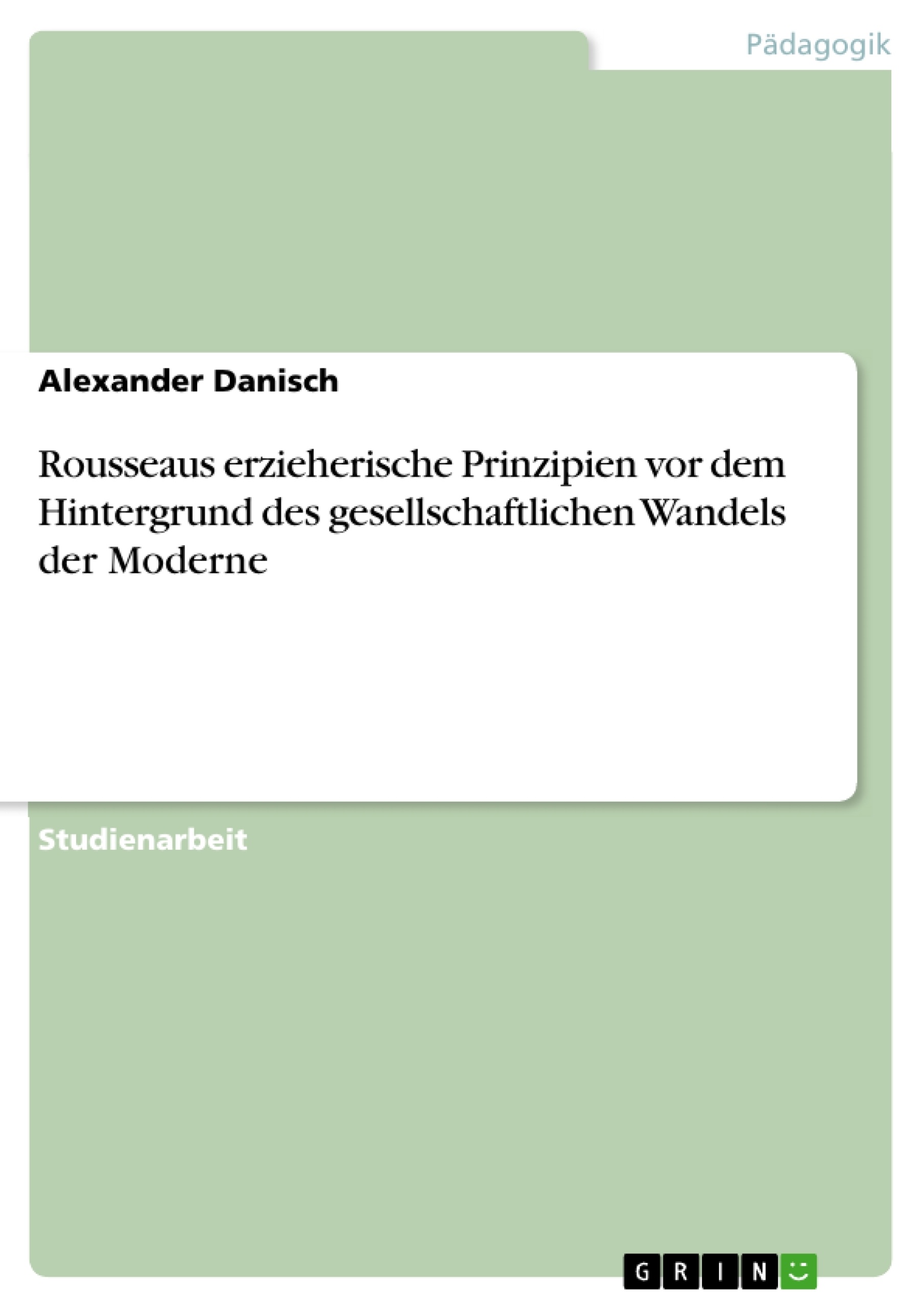Kaum ein anderes Ereignis der Neuzeit hat die kulturelle, soziale und
literarische Welt Europas so stark geprägt wie die Aufklärung. Sie erfasste alle
Lebensgebiete und wandelte diese um, auch wenn diese Entwicklung nicht
allerorts parallel verlief. Die pädagogischen Vertreter der Aufklärung
publizierten ihre Ideen, damit auch die Welt der Erziehung sich dem Trend der
Aufklärung anpasste. Doch inwiefern beeinflussten die Ideen einzelner
Aufklärer das Gedankengut vieler? Änderten sie wirklich etwas oder schrieben
sie nur in ihrer eigenen Welt, fernab von der Realität? Diese Abhandlung soll
die Fragen anhand des Beispiels von Jean-Jaques Rousseau und seinem
Erziehungsroman ,Emile' beantworten. Hierbei gilt es zu klären, ob sich die
Gesellschaft im Hinblick auf die Erziehung tatsächlich den Ideen und
Vorschlägen des Aufklärers angepasst hat oder nicht.
Hierfür werden zu Beginn die Begriffe definiert, mit denen diese
Abhandlung arbeitet, um ein einheitliches Verständnis herzustellen. Als
nächstes wird der gesellschaftliche und soziale Wandel der Modeme
dargestellt. Es wird besonders auf die Sozialisationsinstanzen Familie und
Schule eingegangen. Zur Literatur ist zu sagen, dass die Forschung zu diesem
Thema bislang kein vollständiges Bild zeichnet, jedoch qualifizierende
Forschungen zur Geschichte von Haushalt und Familie bereits eingesetzt haben
(vgl. Schlumbohn 1983, S. 23). Als nächstes wird eine kurze Einleitung in den
,Emile' gegeben, um im Anschluss die erzieherischen Prinzipien dieses
Werkes darzustellen. Hartmut von Hentig hat in seinem Buch ,Rousseau oder
Die wohlgeordnete Freiheit' die Erziehungslehre des Emiles in sieben
pädagogische Prinzipien zusammengefasst. Anschließend geht es darum, die
zuvor erworbenen Informationen zu vergleichen. Spiegeln die Ideen der
erzieherischen Prinzipien tatsächlich den sozialen Wandel der Modeme und
der Aufklärung wider? Es wird also verglichen, ob die sogenannten
aufklärerischen Ideen Rousseaus tatsächlich Anklang in der Bevölkerung
fanden und damit den Zeitgeist der Vernunft wiedergaben oder ob sie nur
abstrakte Gedankenkonstrukte waren, die keinerlei Verbindung zur
pädagogischen Wahrheit besaßen. Im abschließenden Fazit werden die
wichtigsten Erkenntnisse hervorgehoben, um die oben gestellten Fragen noch
einmal kurz und prägnant zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffsbestimmung
- Moderne
- Erziehung
- Der gesellschaftliche Wandel der Moderne
- Die Aufklärung
- Familie
- Schule
- Emile oder über die Erziehung
- Rosseaus erzieherische Prinzipien nach Hentig
- Die erzieherischen Prinzipien im Zusammenhang mit dem gesellschaftlichen Wandel der Moderne
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung analysiert die erzieherischen Prinzipien von Jean-Jacques Rousseau im Kontext des gesellschaftlichen Wandels der Moderne, insbesondere im Lichte der Aufklärung. Sie untersucht, inwieweit Rousseaus Ideen den Zeitgeist der Vernunft widerspiegelten und ob sie tatsächlich einen Einfluss auf die Erziehungspraxis seiner Zeit hatten.
- Definition der Begriffe „Moderne“ und „Erziehung“ im Kontext der Aufklärung
- Analyse des gesellschaftlichen Wandels der Moderne, mit Fokus auf Familie und Schule
- Darstellung der erzieherischen Prinzipien von Rousseau in seinem Werk „Emile oder über die Erziehung“
- Vergleich der erzieherischen Prinzipien Rousseaus mit den realen Entwicklungen in der Erziehung im Kontext der Aufklärung
- Bewertung des Einflusses von Rousseaus Ideen auf die pädagogische Praxis der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz der Aufklärung für die kulturelle und soziale Entwicklung Europas heraus und führt das Thema der Abhandlung ein. Sie beleuchtet die Frage, inwieweit die Ideen der Aufklärung, insbesondere die von Jean-Jacques Rousseau, die Erziehungspraxis beeinflussten.
- Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Moderne“ und „Erziehung“ im Kontext der Abhandlung. Es betont, dass beide Begriffe historisch geprägt sind und keine einheitlichen Definitionen besitzen. Der Modernitätsbegriff wird als das Gegenwartsbewusstsein der Aufklärer verstanden, das sich vom Vorbild der Antike löst. Erziehung wird als ein zielgerichteter und beabsichtigter Prozess eines Erziehers gegenüber seines Zöglings definiert, der abgeschlossen ist, sobald dieser fähig ist, selbstständig zu denken, zu handeln und in der Gesellschaft zu bestehen.
- Der gesellschaftliche Wandel der Moderne: Dieses Kapitel beleuchtet den gesellschaftlichen Wandel der Moderne in drei Aspekten: die Ideen und Gedanken der Aufklärung, den Wandel innerhalb der Familie und die pädagogische Entwicklung der Schule. Die Aufklärung wird als ein wesentlicher Impulsgeber für die moderne europäische Kultur und Geschichte beschrieben. Besondere Merkmale der Pädagogik der Aufklärung sind die Betonung der Vernunft, die Säkularisierung des Bildungssystems und die Fokussierung auf das Kind als vernunftbegabtes Wesen. Die Familie und die Schule werden als wichtige Sozialisationsinstanzen im Kontext des gesellschaftlichen Wandels betrachtet.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Abhandlung sind die pädagogischen Prinzipien von Jean-Jacques Rousseau im Kontext des gesellschaftlichen Wandels der Moderne. Dabei stehen die Begriffe Aufklärung, Erziehung, Moderne, Familie, Schule, Emile und die erzieherischen Prinzipien im Vordergrund. Der Fokus liegt auf der Analyse des Einflusses der Aufklärung auf die Erziehungspraxis, der Rolle der Familie und der Schule als Sozialisationsinstanzen sowie der Relevanz von Rousseaus Ideen für die pädagogische Theorie und Praxis der Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind Rousseaus zentrale erzieherische Prinzipien?
In seinem Werk "Emile" formulierte Rousseau Prinzipien wie die "wohlgeordnete Freiheit", die Orientierung am Kind als vernunftbegabtem Wesen und die Säkularisierung der Bildung.
Wie definiert Rousseau Erziehung?
Erziehung ist ein zielgerichteter Prozess, der abgeschlossen ist, sobald der Zögling fähig ist, selbstständig zu denken, zu handeln und in der Gesellschaft zu bestehen.
Welchen Einfluss hatte die Aufklärung auf die Pädagogik?
Die Aufklärung betonte die Vernunft und führte zu einem Wandel in den Sozialisationsinstanzen Familie und Schule, weg von kirchlicher Bevormundung hin zu moderneren Bildungsidealen.
Waren Rousseaus Ideen in seiner Zeit realitätsnah?
Die Arbeit untersucht genau diesen Punkt: Ob seine Ideen den realen sozialen Wandel widerspiegelten oder eher abstrakte Gedankenkonstrukte ohne Verbindung zur damaligen pädagogischen Wahrheit waren.
Wie interpretiert Hartmut von Hentig Rousseaus Lehre?
Hentig fasst die Erziehungslehre des "Emile" in sieben pädagogische Prinzipien zusammen, die als Grundlage für den Vergleich mit dem gesellschaftlichen Wandel dienen.
- Quote paper
- Master of Arts Alexander Danisch (Author), 2010, Rousseaus erzieherische Prinzipien vor dem Hintergrund des gesellschaftlichen Wandels der Moderne, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/263778