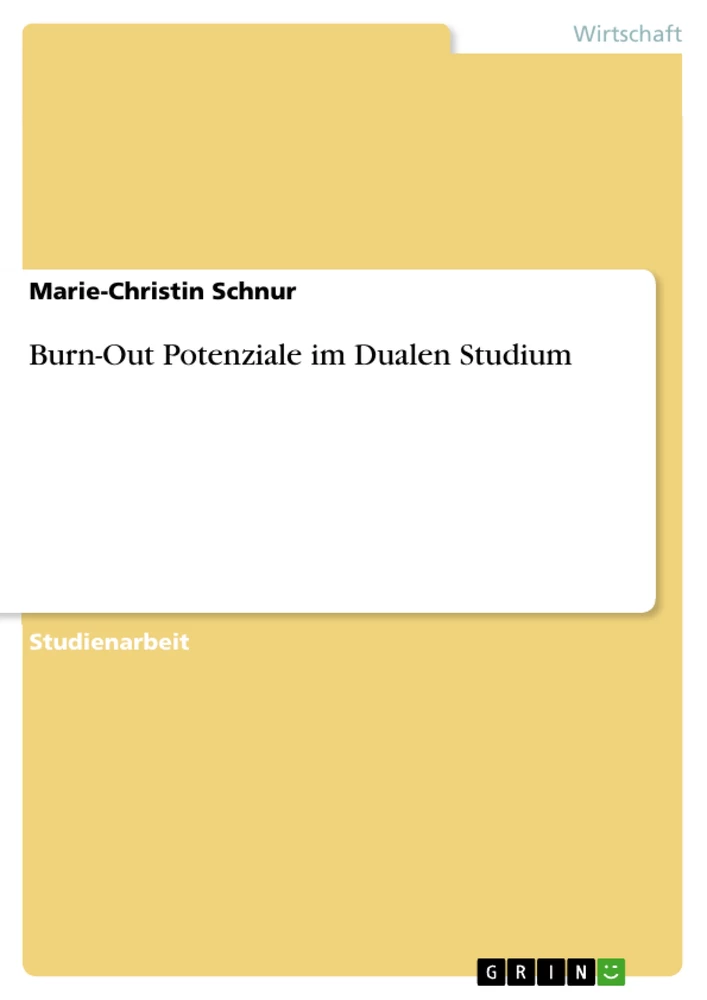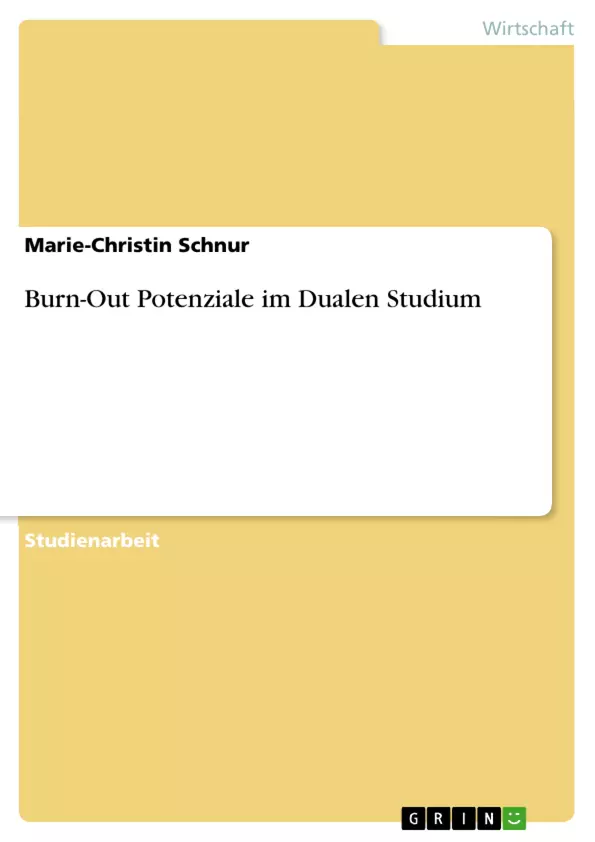Diese Studienarbeit beschäftigt sich mit der (scheinbar aktuellen und immer wieder auftauchenden) Frage, ob Studenten (insbesondere die des Dualen Studiums) gefährdet sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Was ist Burn-Out?
- 2.1 Ist Burn-Out eine Krankheit oder eine Modeerscheinung?
- 2.2 Der Burn-Out-Zyklus nach Freudenberger und North
- 2.3 Gründe des Ausbrennens
- 3 Wer kann betroffen sein?
- 3.1 Gefährdete Personen
- 3.2 Studenten als mögliche Gefährdete
- 4 Empirische Befragung: Macht studieren krank?
- 4.1 Auswertung der Umfrage
- 4.2 Erkenntnis der Befragung
- 5 Vorbeugenden Maßnahmen
- 5.1 Work-Life-Balance: Das richtige Gleichgewicht finden
- 5.2 Präventionen aus studentischer Sicht
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Studienarbeit untersucht die Burn-Out-Gefahr für Studierende im dualen Studium. Ziel ist es, Handlungsempfehlungen für psychologische Betreuer der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin zu liefern und Studierende über das Burn-Out-Syndrom aufzuklären. Die Arbeit analysiert, ob und welche Burn-Out-Potenziale im dualen Studium liegen und sensibilisiert für präventive Maßnahmen.
- Definition und Einordnung von Burn-Out
- Burn-Out-Risikofaktoren im dualen Studium
- Ergebnisse einer empirischen Befragung zum Thema Burn-Out bei dualen Studenten
- Präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Burn-Out
- Handlungsempfehlungen für die psychologische Betreuung an Hochschulen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung beschreibt den aktuellen Fokus auf das Burn-Out-Syndrom, insbesondere im Arbeitskontext. Sie hebt den steigenden Leistungsdruck in Schule und Studium hervor und verdeutlicht den besonderen Kontext des dualen Studiums als Kombination aus Theorie und Praxis. Die Autorin beschreibt eigene Beobachtungen von erhöhten Krankheitsfällen unter Kommilitonen im vierten Semester und begründet damit die Notwendigkeit der Untersuchung von Burn-Out-Potenzialen im dualen Studium. Die Arbeit formuliert das Ziel, Handlungsempfehlungen für die psychologische Betreuung und Aufklärung unter den Studenten zu entwickeln.
2 Was ist Burn-Out?: Dieses Kapitel beleuchtet die Definition und Einordnung des Burn-Out-Syndroms. Es thematisiert die kontroverse Diskussion darüber, ob es sich um eine eigenständige Krankheit oder lediglich eine Modeerscheinung handelt. Der Abschnitt untersucht verschiedene Definitionen und diskutiert die Einordnung im ICD-10-WHO, wobei hervorgehoben wird, dass Burn-Out derzeit nicht als eigenständige Krankheit klassifiziert ist, sondern eher unter Kategorien wie „Depression“ oder „Neurasthenie“ fällt. Der Fokus liegt auf der Klärung des Begriffs und seiner verschiedenen Interpretationen.
Schlüsselwörter
Burn-Out, Duales Studium, Leistungsdruck, Studenten, Prävention, Erschöpfung, Motivationslosigkeit, Work-Life-Balance, Handlungsempfehlungen, empirische Befragung, Hochschule.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Burn-Out im dualen Studium
Was ist der Hauptfokus dieser Studienarbeit?
Diese Arbeit untersucht die Burn-Out-Gefahr für Studierende im dualen Studium. Ziel ist es, Handlungsempfehlungen für psychologische Betreuer der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin zu liefern und Studierende über das Burn-Out-Syndrom aufzuklären. Die Arbeit analysiert Burn-Out-Potenziale im dualen Studium und sensibilisiert für präventive Maßnahmen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und Einordnung von Burn-Out, Burn-Out-Risikofaktoren im dualen Studium, die Ergebnisse einer empirischen Befragung zum Thema Burn-Out bei dualen Studenten, präventive Maßnahmen zur Vermeidung von Burn-Out und Handlungsempfehlungen für die psychologische Betreuung an Hochschulen. Sie beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zur Definition von Burn-Out (inkl. Diskussion um Krankheit vs. Modeerscheinung und den Burn-Out-Zyklus nach Freudenberger und North), ein Kapitel zu betroffenen Personengruppen (inkl. Studenten), die Ergebnisse einer empirischen Befragung, ein Kapitel zu präventiven Maßnahmen (inkl. Work-Life-Balance) und ein Fazit.
Was ist der Burn-Out-Zyklus nach Freudenberger und North?
Die Arbeit erwähnt den Burn-Out-Zyklus nach Freudenberger und North, jedoch werden die Details dieses Zyklus nicht explizit in der Inhaltsangabe erläutert. Weitere Informationen hierzu müssten im Haupttext der Arbeit nachgeschlagen werden.
Wer sind die potenziellen Zielgruppen der Arbeit?
Die Hauptzielgruppen sind psychologische Betreuer an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin und Studierende im dualen Studium. Die Arbeit soll sowohl Handlungsempfehlungen für Betreuer liefern als auch Studierende über Burn-Out aufklären.
Wie wird Burn-Out in dieser Arbeit definiert und eingeordnet?
Die Arbeit thematisiert die kontroverse Diskussion um Burn-Out als eigenständige Krankheit oder Modeerscheinung. Es wird erwähnt, dass Burn-Out im ICD-10-WHO nicht als eigenständige Krankheit klassifiziert ist, sondern eher unter Kategorien wie „Depression“ oder „Neurasthenie“ fällt. Die Arbeit konzentriert sich auf die Klärung des Begriffs und seiner verschiedenen Interpretationen.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Arbeit beinhaltet eine empirische Befragung von Studierenden zum Thema Burn-Out im dualen Studium. Die Auswertung dieser Befragung und die daraus gewonnenen Erkenntnisse sind Bestandteil der Arbeit.
Welche präventiven Maßnahmen werden vorgeschlagen?
Die Arbeit schlägt präventive Maßnahmen vor, darunter die Wichtigkeit einer ausgewogenen Work-Life-Balance und weitere Präventionsmaßnahmen aus studentischer Sicht. Die genauen Maßnahmen werden im Kapitel zu den präventiven Maßnahmen detailliert beschrieben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Burn-Out, Duales Studium, Leistungsdruck, Studenten, Prävention, Erschöpfung, Motivationslosigkeit, Work-Life-Balance, Handlungsempfehlungen, empirische Befragung, Hochschule.
- Citar trabajo
- Marie-Christin Schnur (Autor), 2013, Burn-Out Potenziale im Dualen Studium, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264288