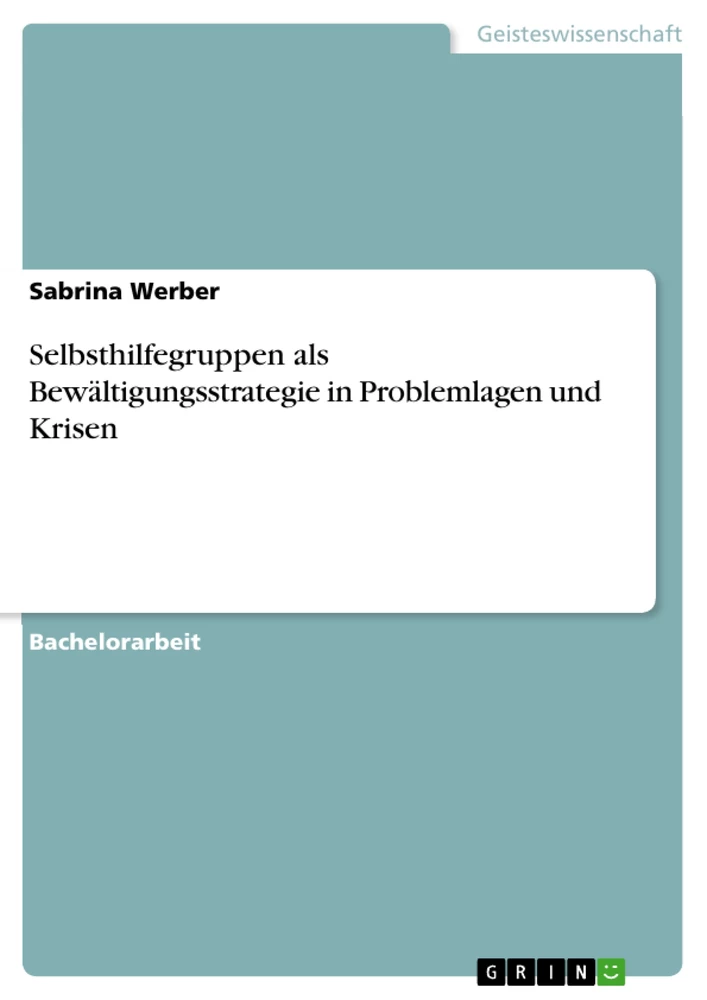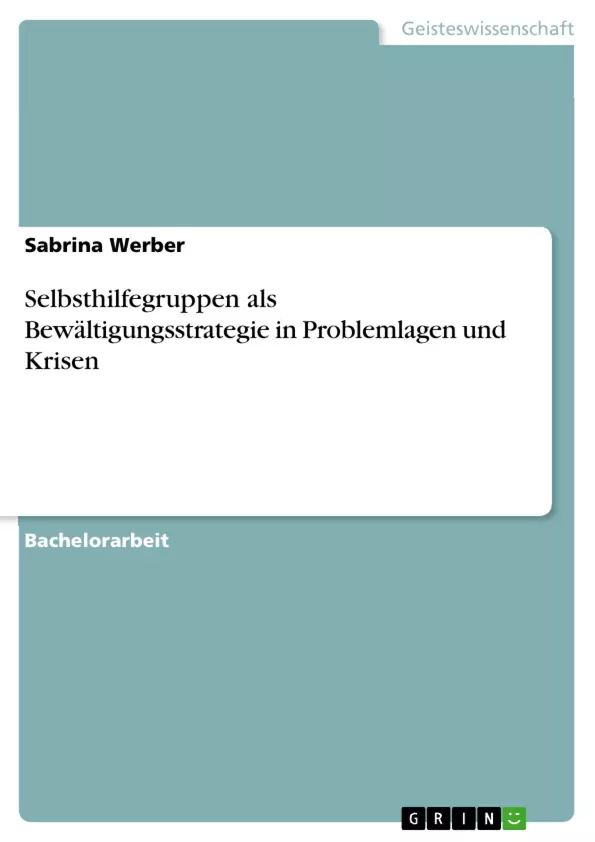Selbsthilfegruppen gehören heute fast schon zu unserer Kultur.
Nehmen wir mal ein Beispiel an: Wenn immer mehr Menschen aus dem Erwerbsleben ausscheiden, hat das erhebliche Auswirkungen auf das gesellschaftliche Zusammenleben. Denn Erwerbsarbeit hat nicht nur die Aufgabe die Existenz zu sichern, sie hat auch eine hohe soziale Funktion. Sie schafft soziale Zusammenhänge, Möglichkeiten des Austauschs und der Begegnung. Wer nicht mehr erwerbstätig ist, ist sozial auf andere Zusammenhänge und Netzwerke angewiesen. Je älter Menschen werden, desto mehr dünnen auch die ursprünglichen sozialen Bezüge wie Familie und Freunde aus. Deshalb werden diverse Arten von Selbsthilfegruppen, wie Nachbarschaftsinitiativen immer wichtiger. Sie sind Teil einer lebendigen demokratischen Stadtgesellschaft, die der Selbstorganisation ihrer BewohnerInnen Raum eröffnet und Teilhabe für alle schafft, unabhängig von Alter und Gesundheitszustand. Das betrifft aber nicht, wie hier an einem Beispiel festgemacht, nur das Ausscheiden aus dem Erwerbsleben mit seinen Folgen, sondern auch andere Bereiche des Lebens, wie andere seelische oder körperliche Belange, die die Notwendigkeit aufweisen Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Aus diesem Beispiel kam ein bedeutender Aspekt hervor, wieso Selbsthilfegruppen in unserer Zeit bedeutsam geworden sind. In einer Mischform von Gesellschaften, wie zum Beispiel der Risikogesellschaft oder der Wissensgesellschaft, ist es oft schwer sich als Individuum zu behaupten und funktionsfähig nach den Anforderungen der Gesellschaft zu agieren. Durch diverse Defizite ist nicht gerade eine Minderzahl der Bevölkerung gehandicapt. Defizite meinen in diesem Zusammenhang, nicht produktiv für die Gesellschaft sein zu können, ob durch körperliche oder seelische Beschwerden. Diese Zielgruppe, so vielfältig sie auch sein mag, benötigt Hilfe, Hilfe um sich selbst zu helfen, also Selbsthilfe. Durch Zusammenschluss mehrerer Betroffenen des gleichen Leidens, entsteht die Etablierung einer Selbsthilfegruppe.
Genau damit möchte ich mich in dieser Arbeit befassen, den Selbsthilfegruppen. Nach dem Aufzeigen der Bedeutung der Selbsthilfe(-gruppe) möchte ich vorerst deskriptiv einen geschichtlichen Abriss der Selbsthilfegruppe darstellen. Darauf aufbauend sollen sieben unterschiedliche Kategorien nach M.L. Moeller dargestellt werden. Merkmale einer Gesprächsselbsthilfegruppe wird als weiterer Punkt behandelt. Nach der Darstellung von Selbsthilfegruppen möchte ich mit Hilfe von
Gliederung
1. Einleitung
2. Begriffsdefinition
3. Zur Geschichte der Selbsthilfegruppenbewegung
3.1 Selbsthilfegruppen in historischer Sicht
3.2 Verbreitung psychologisch-therapeutischer Selbsthilfegruppen in den USA
Exkurs: Empowerment-Konzept
3.2.1 Entstehung der Anonymen Alkoholiker (AA)
3.3 Geschichte der Selbsthilfe in Deutschland
4. Kategorien von Selbsthilfegruppen
4.1 Psychologisch-therapeutische Selbsthilfegruppen
4.2 Medizinische Selbsthilfegruppen
4.3 Bewusstseinsveränderte Selbsthilfegruppen
4.4 Lebensgestaltende Selbsthilfegruppen
4.5 Arbeitsorientierte Selbsthilfegruppen
4.6 Lern -bzw. ausbildungsorientierte Selbsthilfegruppen
4.7 Bürgerinitiativen
5. Merkmale und Geschehen in einer typischen psychologisch-therapeutischen Gesprächs-Selbsthilfegruppe
6. Wirkung von Selbsthilfegruppen insbesondere der psychologisch-therapeutischen Gesprächs-Selbsthilfegruppe
7. Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
- Quote paper
- Sabrina Werber (Author), 2011, Selbsthilfegruppen als Bewältigungsstrategie in Problemlagen und Krisen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/264304