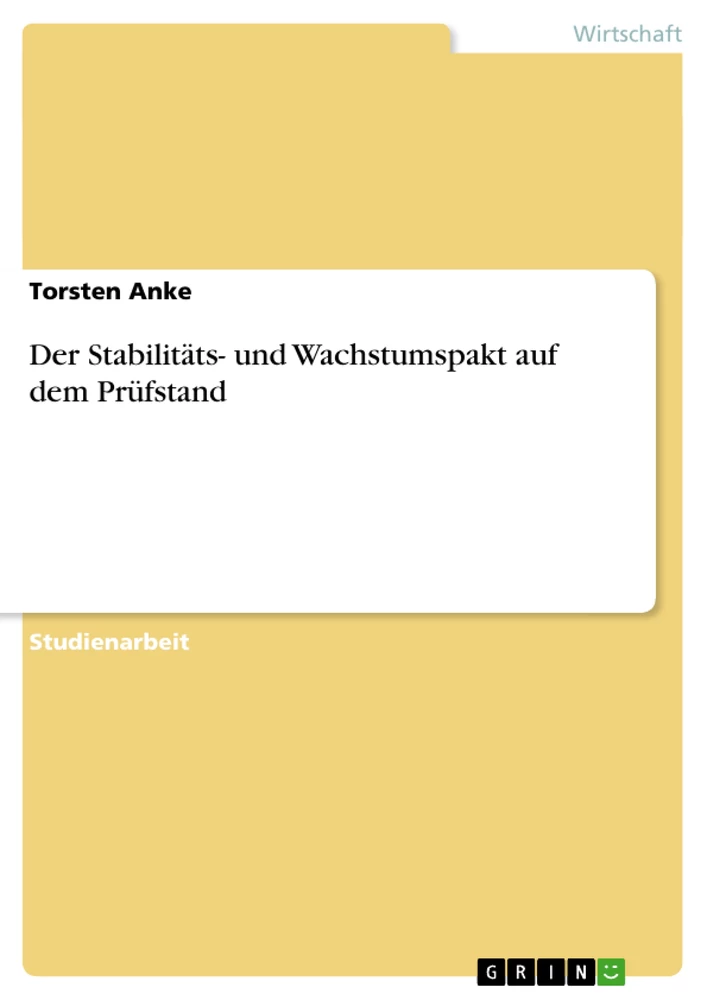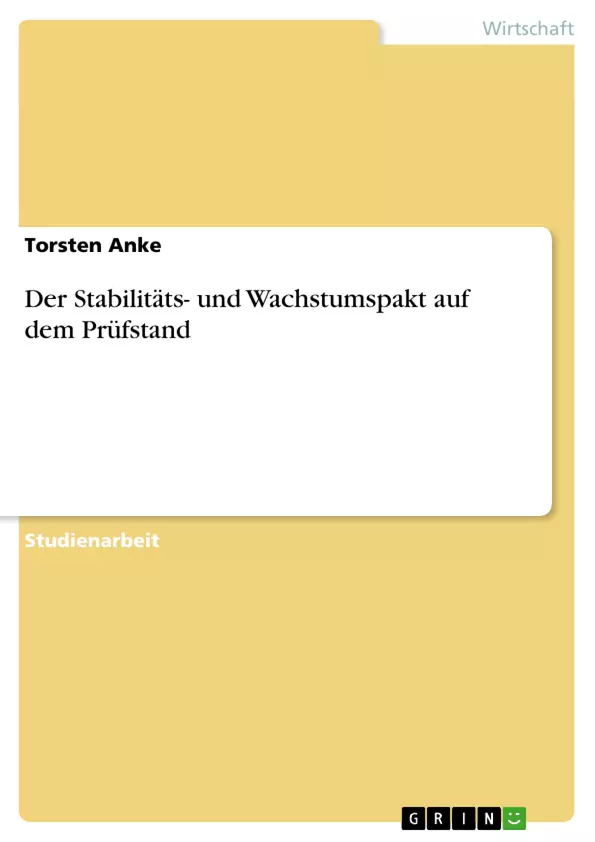Die vorliegende Hausarbeit widmet sich der Frage, ob der Stabilitäts- und Wachstumspakt umfassende Reformmaßnahmen bedarf, um seinem originären Ziel, einer stabilitätsorientierten EU-Haushaltspolitik, nach zu kommen. Bei der Beantwortung wird implizit unterstellt, dass der Pakt, welcher 1997 von allen Mitgliedsländern in Amsterdam unterzeichnet wurde, als ein notwendiges Mittel der gemeinsamen EU-Wirtschaftspolitik anerkannt ist. Im Mittelpunkt des Interesses steht nicht die Frage, ob zusätzlich zum Vertrag von Maastricht ein Stabilitätspakt notwendig ist, sondern ob der Pakt in seiner jetzigen Form ausreicht, um die einzelnen Mitgliedsländer der Europäischen Union im Hinblick auf ihre nationale Finanzpolitik zu disziplinieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts
- Das Ziel des Stabilitäts- und Wachstumspakts
- Die Maastrichter Referenzwerte
- Die Konvergenz- und Stabilitätsprogramme
- Der Sanktionsmechanismus
- Die Entwicklung des Stabilitäts- und Wachstumspakts
- Argumente für die Beibehaltung des Pakts
- Vermeiden von Vertrauensverlusten
- Ausreichende Flexibilitätsvorgaben
- Argumente für eine Modifizierung des Pakts
- Mangel an ökonomischer Fundamentation
- Fehlende langfristige Orientierung
- Förderung einer pro-zyklischen Finanzpolitik
- Gleichbehandlung der Mitgliedsländer
- Der Entscheidungsprozess im ECOFIN
- Reformvorschläge
- Strukturelles Defizit als Referenzgröße
- Ausgabenziele statt Defizitbeschränkung
- Einführung nationaler Schuldenquoten
- Implementierung von „Rainy-day-funds"
- Objektivierung des Sanktionsmechanismus
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit untersucht die Funktionsweise des Stabilitäts- und Wachstumspakts und analysiert die aktuellen Diskussionen um seine Reform. Ziel ist es, die Frage zu beantworten, ob der Pakt in seiner derzeitigen Form seinen Zielen gerecht wird und ob umfassende Reformmaßnahmen notwendig sind, um eine stabilitätsorientierte EU-Haushaltspolitik zu gewährleisten.
- Die Ziele und Bestimmungen des Stabilitäts- und Wachstumspakts
- Die Entwicklung des Pakts seit seiner Einführung
- Argumente für und gegen die Beibehaltung des Pakts
- Reformvorschläge zur Verbesserung der Funktionsweise des Pakts
- Die Auswirkungen des Pakts auf die deutsche und europäische Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 widmet sich der Vorstellung des Stabilitäts- und Wachstumspakts, seiner Ziele und seiner wichtigsten Bestimmungen. Es analysiert die Entstehung des Pakts und die Beweggründe für seine Einführung.
Kapitel 3 beleuchtet die Entwicklung des Stabilitäts- und Wachstumspakts seit seiner Einführung im Jahr 1997. Es untersucht die Erfahrungen der Mitgliedsländer mit der Umsetzung des Pakts und analysiert die Herausforderungen, die im Zuge der Anwendung des Pakts entstanden sind.
Kapitel 4 und 5 präsentieren die wichtigsten Argumente für und gegen die Beibehaltung des Stabilitäts- und Wachstumspakts in seiner derzeitigen Form. Es werden sowohl ökonomische als auch politische Argumente berücksichtigt.
Schlüsselwörter
Stabilitäts- und Wachstumspakt, EU-Haushaltspolitik, Defizitkriterium, Sanktionsmechanismus, Reformvorschläge, Maastricht-Vertrag, Europäische Währungsunion, EZB, Euroland.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptziel des Stabilitäts- und Wachstumspakts?
Das Ziel ist die Sicherstellung einer stabilitätsorientierten Haushaltspolitik der EU-Mitgliedstaaten zur Sicherung der gemeinsamen Währung.
Welche Referenzwerte wurden im Maastricht-Vertrag festgelegt?
Die zwei zentralen Kriterien sind ein jährliches Haushaltsdefizit von maximal 3 % und ein Gesamtschuldenstand von maximal 60 % des BIP.
Wie funktioniert der Sanktionsmechanismus des Pakts?
Bei dauerhaften Verstößen gegen die Defizitkriterien können gegen das betroffene Land finanzielle Sanktionen verhängt werden, koordiniert durch den ECOFIN-Rat.
Welche Reformvorschläge werden in der Arbeit diskutiert?
Diskutiert werden unter anderem die Nutzung des strukturellen Defizits als Maßstab, Ausgabenziele statt Defizitgrenzen und die Einführung von „Rainy-day-funds“.
Was wird am aktuellen Entscheidungsprozess kritisiert?
Kritiker bemängeln die politische Einflussnahme im ECOFIN-Rat und fordern eine Objektivierung bzw. Automatisierung des Sanktionsmechanismus.
- Citar trabajo
- Torsten Anke (Autor), 2004, Der Stabilitäts- und Wachstumspakt auf dem Prüfstand, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/26473