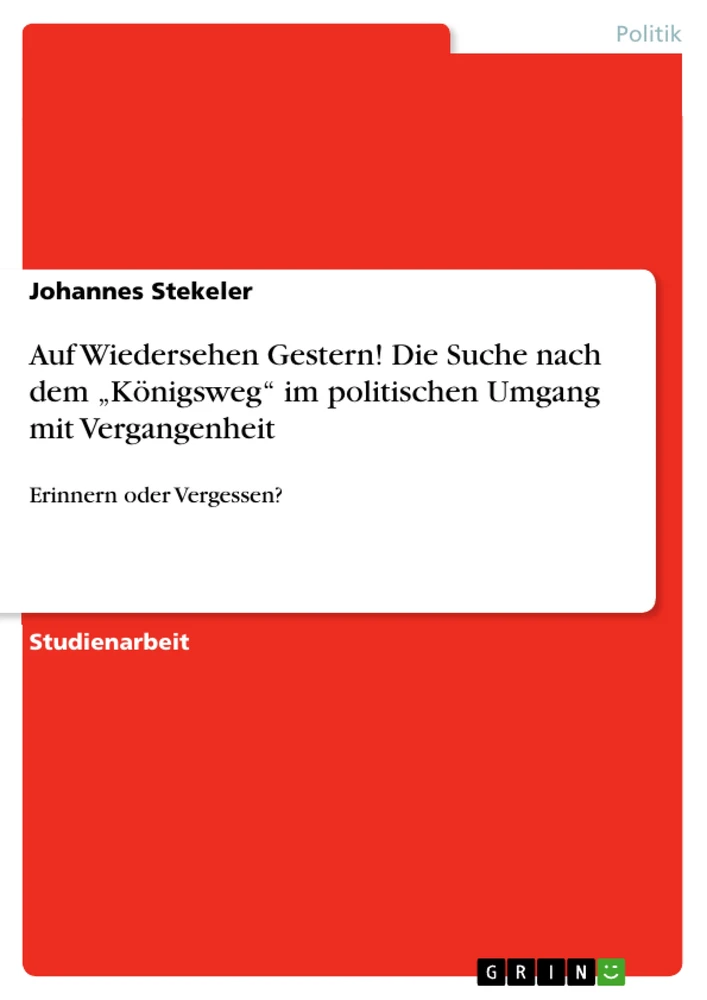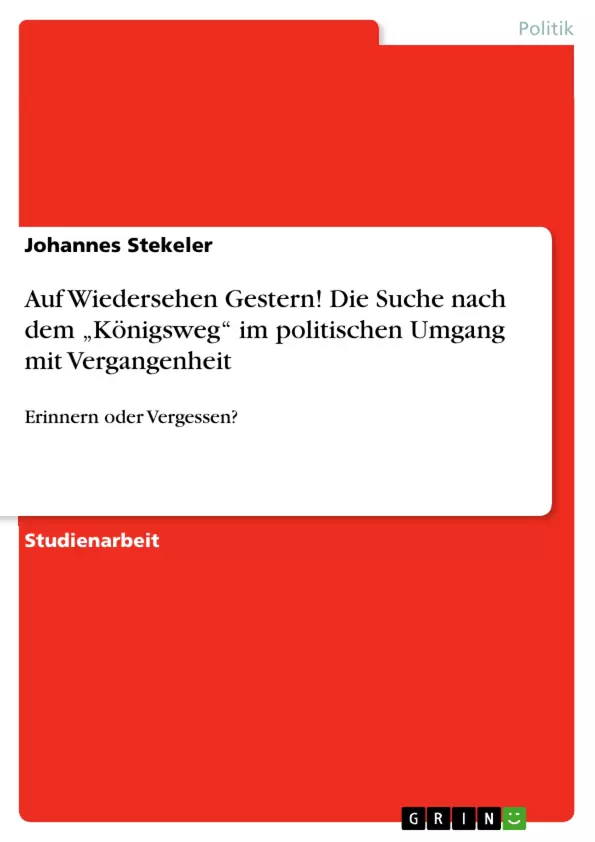„Ein Volk, das diese wirtschaftlichen Leistungen erbracht hat, hat ein Recht darauf, von Auschwitz nichts mehr hören zu wollen.“
Franz Josef Strauß, 1969.
Arbeit scheint auch zwanzig Jahre nachdem die Tore der NS-Vernichtungslager geschlossen wurden, „frei“ zu machen. Sich auf den Wiederaufbau und in die Arbeit zu stürzen, den Blick immer geradeaus gen Zukunft, die „fetten“ Wirtschaftswunderjahre genießen und bei allem stets den Blick über die Schulter, den in die Vergangenheit vermeiden - dies kann auch eine Methode sein, Vergangenes hinter sich zu lassen und sich deren Last zu entledigen. Doch ist dies der beste Weg eine schlimme Vergangenheit zu „bewältigen“? Kann die Schuld aus vergangenen Tagen einfach unreflektiert durch „wirtschaftliche Leistungen“ abgegolten werden? Kommt diese fragwürdige Aussage des ehemaligen CSU-Politikers nicht einer Ohrfeige für alle Opfer des Genozids gleich? Denn genau die Opfer sind es, gegenüber denen sich Täter, Volk und Staat für die ihnen angetanen Verbrechen zu verantworten haben. Sie und nicht zuletzt die, die in ihrem Namen sprechen, stehen zwischen der Unabweisbarkeit der Erinnerung und dem Drang zu vergessen. Aber nicht nur diejenigen, die auf der Seite der Täter und Verlierer stehen, äußern den Wunsch nach Vergessen. Auch auf Seiten der Opfer und Sieger kann Nicht-Erinnern eine Alternative sein. Amnestie und gewollte Amnesie, so zeigt der Verlauf der Geschichte, waren zu allen Zeiten willkommene Werkzeuge im Umgang mit unrühmlicher Vergangenheit. Die Geschichte zeigt aber auch, dass bloßes Verdrängen oder Erlassen von Schuld den Nährboden für noch mehr Schuld (z.B. Rache) bieten kann und die Zukunft damit auf wackelige Beine stellt. Es stellt sich also die Frage, welches wohl die beste Art ist mit Vergangenheit umzugehen und ob es vielleicht so etwas wie einen „Königsweg“ für die schuldbeladenen Staaten und Menschen gibt? Und wenn ja, was steht auf dessen Wegweiser - Vergessen oder Erinnern?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Anker oder Last? - Motivationen für staatl. Vergangenheitsumgang
- 3. Schuldig gemacht... - Erinnern oder Vergessen?
- 3.1. Vergangenheit vergessen - Amnesie & Amnestie
- 3.2. Vergangenheit erinnern – Aufarbeitung, Wiedergutmachung und ,,Bewältigung“
- 4. Erinnern, eine demokratische Pflicht? - Demokratisierung und Vergangenheit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Umgang von Staaten und Individuen mit ihrer Vergangenheit. Sie hinterfragt die Motivationen hinter staatlichen Strategien des Erinnerns und Vergessens und beleuchtet verschiedene Ansätze zur Verarbeitung von Schuld und Trauma. Im Mittelpunkt steht die Frage nach einem optimalen Weg ("Königsweg") im Umgang mit einer belasteten Vergangenheit.
- Motivationen für staatlichen Umgang mit der Vergangenheit
- Die Rolle von Erinnern und Vergessen in der Verarbeitung von Schuld
- Die Beziehung zwischen Demokratisierung und der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
- Der ethische Umgang mit kollektiver Schuld und Verantwortung
- Die Suche nach einem optimalen Weg der Vergangenheitsbewältigung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem optimalen Umgang mit einer belasteten Vergangenheit. Sie beleuchtet die Ambivalenz zwischen dem Wunsch nach Vergessen und der Notwendigkeit des Erinnerns, unter Bezugnahme auf ein Zitat von Franz Josef Strauß, das die problematische Tendenz zur Verdrängung von Vergangenheit illustriert. Die Einleitung skizziert die verschiedenen Möglichkeiten des Umgangs mit der Vergangenheit, von Amnesie bis zur öffentlichen Aufarbeitung, und leitet zur zentralen Frage nach einem möglichen „Königsweg“ über.
2. Anker oder Last? - Motivationen für staatl. Vergangenheitsumgang: Dieses Kapitel untersucht die Motivationen hinter dem staatlichen Umgang mit der Vergangenheit. Es unterscheidet zwischen der Betonung von Kontinuität und der Abkehr von traditionellen Strukturen. Im ersten Fall dient die Vergangenheit der Legitimation und Identitätsstiftung, im zweiten Fall wird sie als Last betrachtet, die überwunden werden muss. Das Kapitel beleuchtet, wie die Interpretation der Vergangenheit von den herrschenden Gruppen und Eliten beeinflusst wird und wie das Geschichtsbewusstsein zur Stärkung bestehender Machtstrukturen eingesetzt werden kann.
3. Schuldig gemacht... - Erinnern oder Vergessen?: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Strategien des Erinnerns und Vergessens. Es untersucht die Mechanismen von Amnesie und Amnestie als Methoden der Verdrängung und die Bedeutung der Aufarbeitung, Wiedergutmachung und Bewältigung als Gegenstrategien. Es beleuchtet die unterschiedlichen Perspektiven von Tätern und Opfern und die Herausforderungen, die sich aus der Notwendigkeit des Erinnerns und dem Wunsch nach Vergessen ergeben. Die unterschiedlichen Kapitelteile befassen sich mit dem Vergessen als aktivem Prozess und dem Erinnern als eine Form der Verarbeitung und der damit verbundenen Möglichkeiten der Gerechtigkeit und der Wiedergutmachung.
4. Erinnern, eine demokratische Pflicht? - Demokratisierung und Vergangenheit: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Demokratisierung und dem Umgang mit der Vergangenheit. Es beleuchtet die Rolle des Erinnerns als demokratische Pflicht und die Bedeutung der Aufarbeitung von Unrecht für den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft. Der Fokus liegt auf der Frage, wie die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zur Stärkung demokratischer Werte und zur Prävention zukünftiger Übergriffe beitragen kann. Es diskutiert die Verantwortung von Staat und Gesellschaft im Umgang mit einer belasteten Vergangenheit.
Schlüsselwörter
Vergangenheitsbewältigung, Erinnern, Vergessen, Amnesie, Amnestie, Schuld, Wiedergutmachung, Demokratisierung, Geschichtsbewusstsein, kollektive Verantwortung, Staatsverantwortung, politische Ethik, „Königsweg“.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Umgang mit der Vergangenheit - Ein "Königsweg"?
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Umgang von Staaten und Individuen mit ihrer Vergangenheit. Sie analysiert die Motivationen hinter staatlichen Strategien des Erinnerns und Vergessens und beleuchtet verschiedene Ansätze zur Verarbeitung von Schuld und Trauma. Zentral ist die Frage nach einem optimalen Weg ("Königsweg") im Umgang mit einer belasteten Vergangenheit.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Motivationen für staatlichen Umgang mit der Vergangenheit, die Rolle von Erinnern und Vergessen in der Verarbeitung von Schuld, den Zusammenhang zwischen Demokratisierung und der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, den ethischen Umgang mit kollektiver Schuld und Verantwortung sowie die Suche nach einem optimalen Weg der Vergangenheitsbewältigung.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Kapitel 1 (Einleitung): Stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem optimalen Umgang mit einer belasteten Vergangenheit vor und beleuchtet die Ambivalenz zwischen Vergessen und Erinnern. Es skizziert verschiedene Umgangsweisen mit der Vergangenheit und leitet zur Frage nach einem "Königsweg" über.
Kapitel 2 (Anker oder Last?): Untersucht die Motivationen hinter dem staatlichen Umgang mit der Vergangenheit. Es differenziert zwischen der Betonung von Kontinuität (Vergangenheit als Legitimationsgrundlage) und der Abkehr von traditionellen Strukturen (Vergangenheit als zu überwindende Last). Es beleuchtet den Einfluss herrschender Gruppen auf die Geschichtsinterpretation.
Kapitel 3 (Schuldig gemacht...): Analysiert Strategien des Erinnerns und Vergessens (Amnesie, Amnestie, Aufarbeitung, Wiedergutmachung). Es beleuchtet unterschiedliche Perspektiven von Tätern und Opfern und die Herausforderungen, die sich aus dem Erinnern und dem Wunsch nach Vergessen ergeben.
Kapitel 4 (Erinnern, eine demokratische Pflicht?): Untersucht den Zusammenhang zwischen Demokratisierung und dem Umgang mit der Vergangenheit. Es beleuchtet die Rolle des Erinnerns als demokratische Pflicht und die Bedeutung der Aufarbeitung von Unrecht für den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Vergangenheitsbewältigung, Erinnern, Vergessen, Amnesie, Amnestie, Schuld, Wiedergutmachung, Demokratisierung, Geschichtsbewusstsein, kollektive Verantwortung, Staatsverantwortung, politische Ethik, „Königsweg“.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, den Umgang mit einer belasteten Vergangenheit zu untersuchen und verschiedene Strategien des Erinnerns und Vergessens zu analysieren. Sie sucht nach einem optimalen Weg ("Königsweg") im Umgang mit der Vergangenheit und beleuchtet die ethischen und politischen Implikationen dieser Thematik.
- Citation du texte
- Johannes Stekeler (Auteur), 2013, Auf Wiedersehen Gestern! Die Suche nach dem „Königsweg“ im politischen Umgang mit Vergangenheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265797