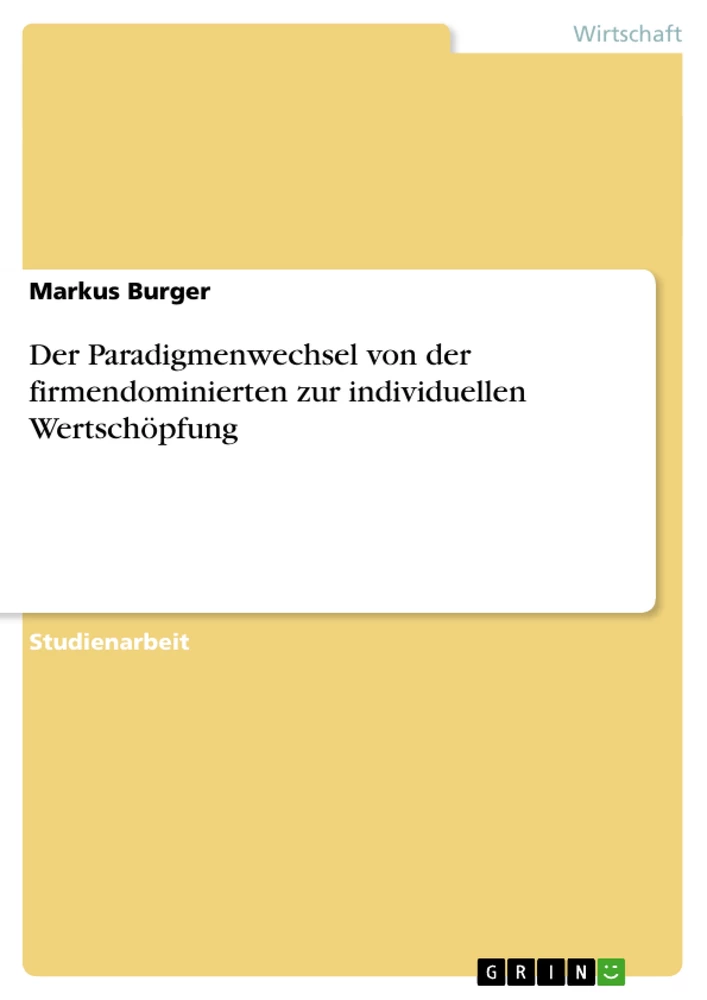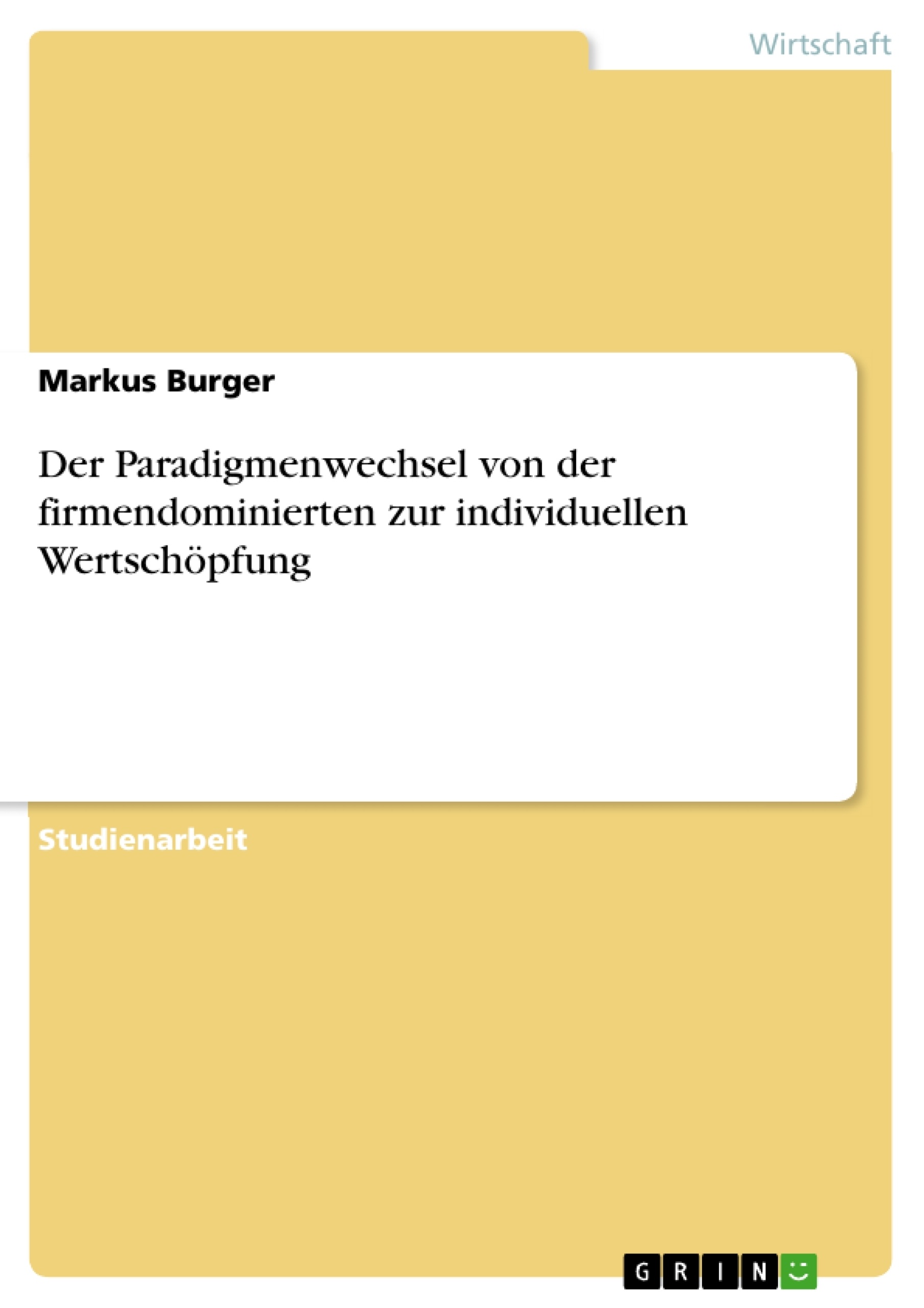Es werden wichtige Begrifflichkeiten des Paradigmenwechsels und der Wertschöpfung bzw. der Innovation in Kapitel 2 definitorisch erläutert. Darauf aufbauend widmet sich Kapitel 3 den verschiedenen Formen der Wertschöpfung. Ziel dieses Kapitels ist es firmen-dominierte, hybride und individuelle Wertschöpfung miteinander vergleichen zu können. Zu Beginn dieses Kapitels wird ebenfalls eine Einführung zu den Grundlagen der Wertschöpfungsmodelle gegeben. Kapitel 4 verbindet die theoretischen Grundlagen mit praktischen Beispielen. Diese Beispiele werden aus vier Interviews, welche im Rahmen dieser Seminararbeit geführt wurden, abgeleitet. Basierend auf den vorher erlangten Erkenntnissen werden im vorletzten Kapitel verschiedene Szenarien für die einzelnen Wertschöpfungsmodelle und die Zukunft der Arbeit abgeleitet. Kapitel 6 befasst sich abschließend mit einem finalen Fazit sowie den Auswirkungen der Erkenntnisse auf die Praxis und die zukünftige Forschung.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Formelverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Definitionen
- Paradigma und Paradigmenwechsel
- Wertschöpfung durch Innovation
- Modelle der Wertschöpfung
- Grundlage der Wertschöpfungsmodelle
- Firmen-dominierte Wertschöpfung
- Hybride Wertschöpfung
- Individuelle Wertschöpfung
- Gesamtübersicht der Wertschöpfungsmodelle
- Wertschöpfungsmodelle in der Praxis der Arbeitswelt
- Vorstellung der Interviewpartner
- Firmen-dominierte Wertschöpfung im Mittelstand
- Der Wandel zur hybriden Wertschöpfung
- Platform Innovation in der Automotive Branche
- Maker als kollaborative Innovierer
- Wertschöpfung und Arbeitswelt der Zukunft
- Fazit
- Literaturverzeichnis
- Anhang A. Interview A
- Anhang B. Interview B
- Anhang C. Interview C
- Anhang D. Interview D
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet der Paradigmenwechsel in der Wertschöpfung?
Er beschreibt den Wandel von einer rein firmendominierten Wertschöpfung, bei der das Unternehmen alles kontrolliert, hin zu hybriden und individuellen Modellen, bei denen Kunden und externe Partner aktiv mitwirken.
Was ist der Unterschied zwischen hybrider und individueller Wertschöpfung?
Hybride Wertschöpfung kombiniert Produkte und Dienstleistungen in enger Zusammenarbeit, während individuelle Wertschöpfung den Fokus auf die spezifischen Beiträge und Bedürfnisse einzelner Akteure legt.
Welche Rolle spielen „Maker“ in diesem Prozess?
Maker agieren als kollaborative Innovierer, die durch neue Technologien (z.B. 3D-Druck) Produkte selbst gestalten und damit die traditionelle Rolle der Industrie herausfordern.
Wie beeinflusst dieser Wandel die Arbeitswelt der Zukunft?
Die Arbeit wird flexibler, kollaborativer und weniger an starre Unternehmensstrukturen gebunden sein, was neue Anforderungen an Führung und Organisation stellt.
Gibt es Praxisbeispiele für hybride Wertschöpfung?
Die Arbeit nutzt Interviews, um Beispiele wie Plattform-Innovationen in der Automotive-Branche und den Wandel im Mittelstand zu veranschaulichen.
Was ist eine firmendominierte Wertschöpfung?
In diesem klassischen Modell liegt die gesamte Kontrolle über Innovation, Produktion und Vertrieb beim Unternehmen; der Kunde ist lediglich der passive Empfänger.
- Citation du texte
- Bachelor of Science Markus Burger (Auteur), 2013, Der Paradigmenwechsel von der firmendominierten zur individuellen Wertschöpfung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/265871