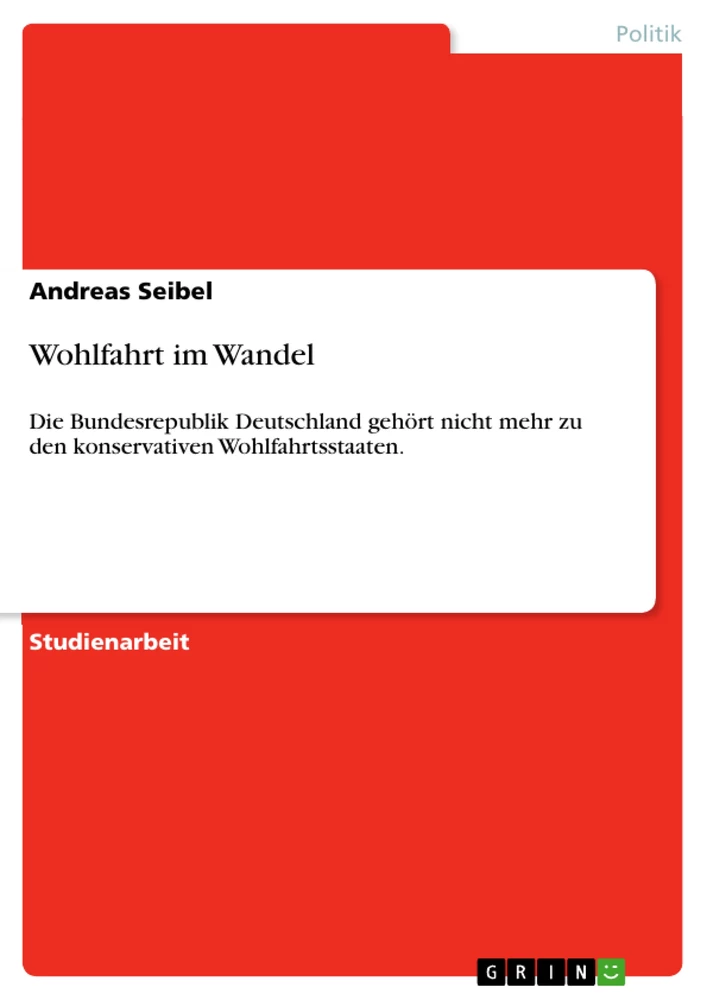Das „Bündnis für Arbeit“ der rot-grünen Koalition aus dem Jahre 1998 gilt als tiefgreifende Zäsur der deutschen Sozialstaatlichkeit, die mit der Einsetzung der Hartz-Kommission im Frühjahr 2002 für Arbeitsmarktreformen ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe 2005 („Hartz IV“) war hierbei das letzte und wohl wichtigste Element. Sie gilt als Bruch in der Geschichte der deutschen Sozialpolitik. Die Reform geht mit einem deutlichen Paradigmenwechsel einher. Die Arbeitsmarktpolitik steht seitdem im Zeichen der konsequenten Aktivierung der Arbeitssuchenden und hat sich somit von einer aktiven hin zu einer aktivierenden Politik gewandelt.1 In der vorliegenden Arbeit möchte ich die Überlegung anstellen, ob nach den Hartz- Gesetzen Deutschland noch als konservativer Wohlfahrtsstaat angesehen werden kann, oder es vielmehr so ist, dass sich damit die wohlfahrtsstaatlichen Grundvorstellungen so radikal verändert haben, dass man von diesem Typus nicht mehr sprechen kann. Oder ist es eventuell so, dass sich dadurch nur die secondary beliefs, also die Vorstellung über die Instrumente des Policy-Instrumentariums verändert haben, die core beliefs jedoch unangetastet blieben? Diese Arbeit ist somit eine kritische Überprüfung, genauere Analyse und gegebenenfalls eine Modifizierung der „Arbeitspapiere der Arbeitsstelle für Internationale Politische Ökonomie“ der Freien Universität Berlin, welches von Judith Zimmermann unter dem Titel: „Wandel oder Kontinuitätsbruch des konservativen Wohlfahrtsstaats: Wie veränderten die Hartz-Reformen die deutsche Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik?“ verfasst wurde.
[...]
1 Heinelt, S. 126.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung/methodisches Vorgehen
- Grundkonzept Esping-Andersen
- Liberaler Wohlfahrtsstaat
- Konservativer Wohlfahrtsstaat
- Sozialdemokratischer Wohlfahrtsstaat
- Sabatiers Advocacy Coalition Framework Ansatz
- Grundkonzept Esping-Andersen
- Kritik an Esping-Andersen
- Unterstützung Esping-Andersens
- Forschungsmeinungen: Ist Deutschland noch ein konservativer Wohlfahrtsstaat?
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert, ob Deutschland nach den Hartz-Reformen noch als konservativer Wohlfahrtsstaat eingestuft werden kann. Sie untersucht die Auswirkungen der Hartz-Reformen auf die deutsche Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik und hinterfragt, ob diese Reformen einen Wandel des konservativen Wohlfahrtsstaates oder einen Kontinuitätsbruch darstellen.
- Die Relevanz des Esping-Andersen-Modells zur Analyse der deutschen Wohlfahrtsentwicklung
- Die Kritikpunkte an Esping-Andersens Konzept und die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung
- Die Auswirkungen der Hartz-Reformen auf die deutschen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik
- Die Frage, ob die Hartz-Reformen einen Wandel des konservativen Wohlfahrtsstaates oder einen Kontinuitätsbruch darstellen
- Die Bedeutung des Advocacy Coalition Framework Ansatz für die Analyse des Wandels im deutschen Wohlfahrtsstaat
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der deutschen Sozialstaatlichkeit im Wandel vor und führt die Hartz-Reformen als zentrale Zäsur ein. Sie formuliert die Frage, ob Deutschland nach den Hartz-Gesetzen noch als konservativer Wohlfahrtsstaat angesehen werden kann.
Das Kapitel „Problemstellung/methodisches Vorgehen" stellt die beiden zentralen Theorien vor, die zur Analyse der Fragestellung herangezogen werden: Esping-Andersens Wohlfahrtsstaattypologie und Sabatiers Advocacy Coalition Framework Ansatz. Esping-Andersen unterscheidet drei Typen des Wohlfahrtsstaates: den liberalen, den konservativen und den sozialdemokratischen. Sabatier hingegen betrachtet politische Prozesse als Interaktionen zwischen Advocacy Koalitionen, die sich durch ein gemeinsames Belief-System auszeichnen.
Das Kapitel „Kritik an Esping-Andersen" beleuchtet die Schwächen des Esping-Andersen-Modells. Kritiker bemängeln die Ausblendung der Geschlechterdimensionen, die Ausklammerung sozialer Dienstleistungen und die Institutionsblindheit des Ansatzes. Einige Autoren halten das Modell für zu simpel und fordern eine Diversifizierung und Hybridisierung der Wohlfahrtsstaatstypen.
Das Kapitel „Unterstützung Esping-Andersens" zeigt die Relevanz des Esping-Andersen-Modells für die Wohlfahrtsstaatenforschung auf. Trotz der Kritikpunkte wird das Modell als prägend für das Forschungsfeld angesehen, da es neue Denkanstöße liefert und als Ausgangspunkt für weitere Forschung dient.
Das Kapitel „Forschungsmeinungen: Ist Deutschland noch ein konservativer Wohlfahrtsstaat?" analysiert die verschiedenen Meinungen zur Einordnung Deutschlands im Wohlfahrtsstaatensystem. Einige Forscher sehen Deutschland aufgrund der Hartz-Reformen auf dem Weg zum liberalen Wohlfahrtsstaat, während andere die Kontinuität des konservativen Modells betonen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den konservativen Wohlfahrtsstaat, die Hartz-Reformen, die deutsche Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik, das Esping-Andersen-Modell, den Advocacy Coalition Framework Ansatz, die Dekommodifizierung, die Stratifizierung, die Belief-Systeme, die Advocacy Koalitionen, die Geschlechterrollen, den liberalen Wohlfahrtsstaat, den sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat und den Wandel des deutschen Sozialstaates.
Häufig gestellte Fragen
Ist Deutschland noch ein konservativer Wohlfahrtsstaat?
Die Arbeit untersucht, ob die Hartz-Reformen einen radikalen Bruch mit dem konservativen Modell darstellen oder ob die Grundwerte (core beliefs) trotz instrumenteller Änderungen erhalten blieben.
Was sind die drei Wohlfahrtsstaatstypen nach Esping-Andersen?
Esping-Andersen unterscheidet zwischen dem liberalen, dem konservativen (korporatistischen) und dem sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat.
Welchen Einfluss hatten die Hartz-Reformen auf die Arbeitsmarktpolitik?
Sie markieren einen Paradigmenwechsel von einer passiven hin zu einer aktivierenden Arbeitsmarktpolitik ("Fordern und Fördern"), insbesondere durch Hartz IV.
Was ist das Advocacy Coalition Framework (ACF)?
Ein theoretischer Ansatz von Sabatier, der politischen Wandel durch das Zusammenwirken von Interessengruppen (Koalitionen) mit gemeinsamen Überzeugungen erklärt.
Welche Kritik gibt es am Modell von Esping-Andersen?
Kritiker bemängeln die Vernachlässigung der Geschlechterdimension, sozialer Dienstleistungen und die teils zu starre Typisierung moderner Hybridsysteme.
- Citar trabajo
- Andreas Seibel (Autor), 2013, Wohlfahrt im Wandel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266344