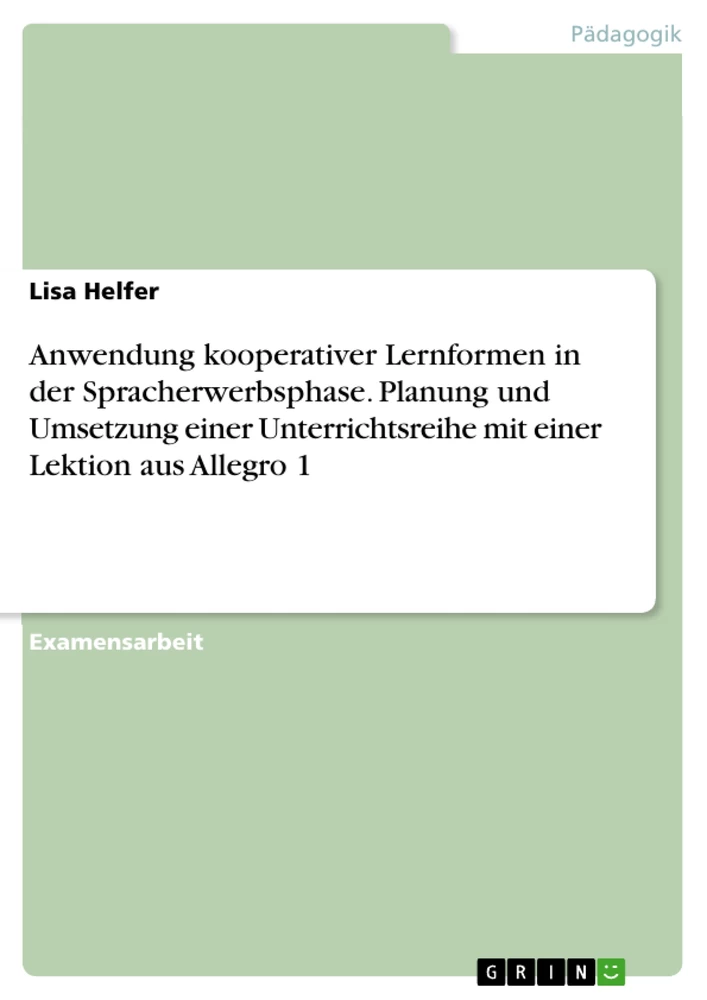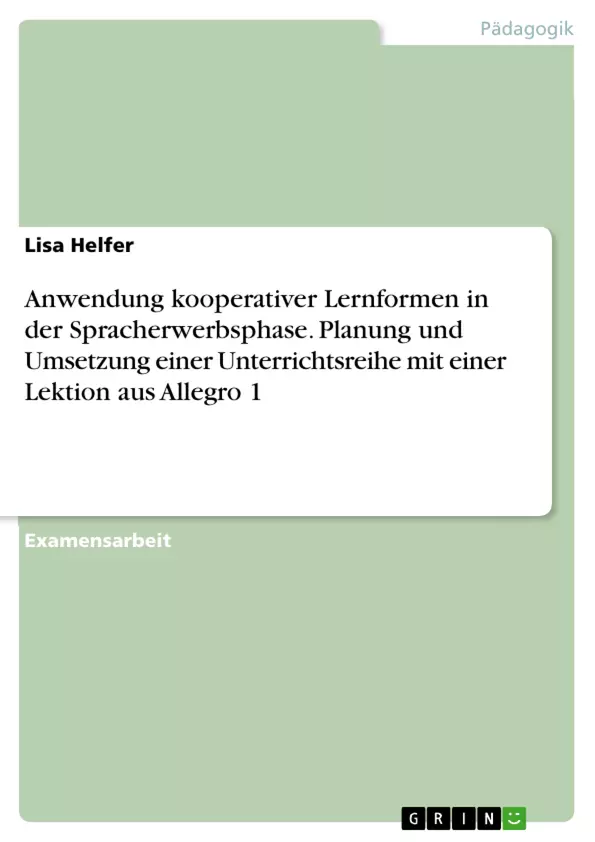Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Erarbeitung einer Lehrbuchslektion aus dem am Gymnasium eingeführten Lehrwerk Allegro A1 mit Schülern der Klasse 8IN. Bei der Unterrichtsplanung habe ich überwiegend auf kooperative Lernformen zurückgegriffen und diese in der Praxis erprobt.
Im ersten Teil beleuchtet die Arbeit zunächst die Grundlagen der Unterrichtsreihe. Hierbei steht die Begründung kooperativer Lernformen im Vordergrund. Anschließend wird das 'Kooperative Lernen' zunächst aus theoretischer Sicht betrachtet, wobei zuerst die Prinzipien vorgestellt werden, bevor auf die Basiselemente dieser Methode eingegangen wird. Es folgt ein Kapitel zur Planung der Unterrichtsreihe, an die sich die eigentliche Präsentation der Reihe anschließt. In einem letzten Schritt erfolgt dann die Bewertung der Unterrichtsreihe aus Schüler- und Lehrersicht.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Begründung und Sachanalyse des Themas
- Warum Kooperative Lernformen?
- Prinzipien des kooperativen Arbeitens
- Basiselemente des kooperativen Lernens
- Zum Lehrwerk Allegro A1
- Vorbemerkung
- Die Methode von Allegro I
- Der Aufbau einer Lektion
- Überblick über die grammatischen und thematischen Inhalte der Lezione 8
- Planung der Unterrichtsreihe
- Begründung des methodisch-didaktischen Vorgehens für die gesamte Reihe
- Analyse des Lehr- und Lernfeldes
- Lernvoraussetzungen
- Praktische Umsetzung der Unterrichtsreihe
- Aufbau der Unterrichtsreihe (tabellarische Übersicht)
- Detaillierte Darstellung einiger ausgewählter Stunden
- Ausführlichere Beschreibung zweier ausgewählter Stunden
- Beschreibung weiterer exemplarischer Stunden
- Auswertung der Unterrichtsreihe
- Auswertung aus Sicht der Schüler
- Auswertung aus Sicht der Lehrkraft
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die pädagogische Hausarbeit beschäftigt sich mit der Anwendung kooperativer Lernformen im Italienischunterricht, speziell in der Spracherwerbsphase. Ziel der Arbeit ist es, eine Unterrichtsreihe zu entwickeln, die die Schüler aktiv in den Lernprozess einbezieht und ihnen die Möglichkeit bietet, neben sprachlichen auch soziale und methodische Kompetenzen zu erwerben. Die Arbeit untersucht die Grundlagen des kooperativen Lernens, analysiert die Eignung des Lehrwerks Allegro A1 für die Umsetzung kooperativer Lernformen und präsentiert eine detaillierte Planung und Durchführung einer Unterrichtsreihe.
- Kooperatives Lernen als Unterrichtsstrategie
- Prinzipien und Basiselemente des kooperativen Lernens
- Analyse des Lehrwerks Allegro A1
- Planung und Durchführung einer Unterrichtsreihe mit kooperativen Lernformen
- Auswertung der Unterrichtsreihe aus Schüler- und Lehrersicht
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel „Begründung und Sachanalyse des Themas" beleuchtet die Bedeutung kooperativer Lernformen in der heutigen Zeit. Es werden die Prinzipien des kooperativen Arbeitens und die fünf Basiselemente (Positive Abhängigkeit, Verantwortungsübernahme, soziale Fähigkeiten, direkte Interaktion und Evaluation) erläutert. Der Abschnitt „Zum Lehrwerk Allegro A1" analysiert die Methode und den Aufbau des Lehrwerks und stellt die grammatischen und thematischen Inhalte der Lezione 8 „Che cosa hai fatto ieri?" vor. Das Kapitel „Planung der Unterrichtsreihe" beschreibt die didaktischen Überlegungen, die der Unterrichtsreihe zugrunde liegen, und analysiert das Lehr- und Lernfeld, sowie die Lernvoraussetzungen der Schüler. Im Kapitel „Praktische Umsetzung der Unterrichtsreihe" wird die Unterrichtsreihe in Form einer tabellarischen Übersicht dargestellt und einige Stunden detailliert beschrieben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen kooperatives Lernen, Italienischunterricht, Spracherwerbsphase, Lehrwerk Allegro A1, Unterrichtsreihe, Methodenanalyse, Lerntempoduett, Placemat, Redekette, Lernprozess, Schüleraktivität, soziale Kompetenzen, methodische Kompetenzen, Auswertung der Unterrichtsreihe.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Basiselemente des kooperativen Lernens?
Dazu gehören positive Abhängigkeit, individuelle Verantwortungsübernahme, soziale Fähigkeiten, direkte Interaktion und die Evaluation des Gruppenprozesses.
Warum eignet sich das Lehrwerk Allegro A1 für kooperative Lernformen?
Das Lehrwerk bietet thematische Anknüpfungspunkte, wie die Lektion „Che cosa hai fatto ieri?“, die sich gut für interaktive Methoden wie das Lerntempoduett eignen.
Was ist ein Lerntempoduett?
Es ist eine kooperative Methode, bei der Schüler in ihrem eigenen Tempo arbeiten und sich nach Abschluss einer Aufgabe mit einem Partner austauschen, der ebenfalls fertig ist.
Welche Vorteile bietet kooperatives Lernen im Italienischunterricht?
Es fördert neben der Sprachkompetenz auch soziale und methodische Fähigkeiten und erhöht die aktive Sprechzeit der Schüler.
Wie bewerten Schüler diese Unterrichtsform?
Die Auswertung zeigt oft eine höhere Motivation und ein besseres Verständnis, da die Schüler voneinander lernen und sich gegenseitig unterstützen.
- Citation du texte
- Lisa Helfer (Auteur), 2013, Anwendung kooperativer Lernformen in der Spracherwerbsphase. Planung und Umsetzung einer Unterrichtsreihe mit einer Lektion aus Allegro 1, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266448