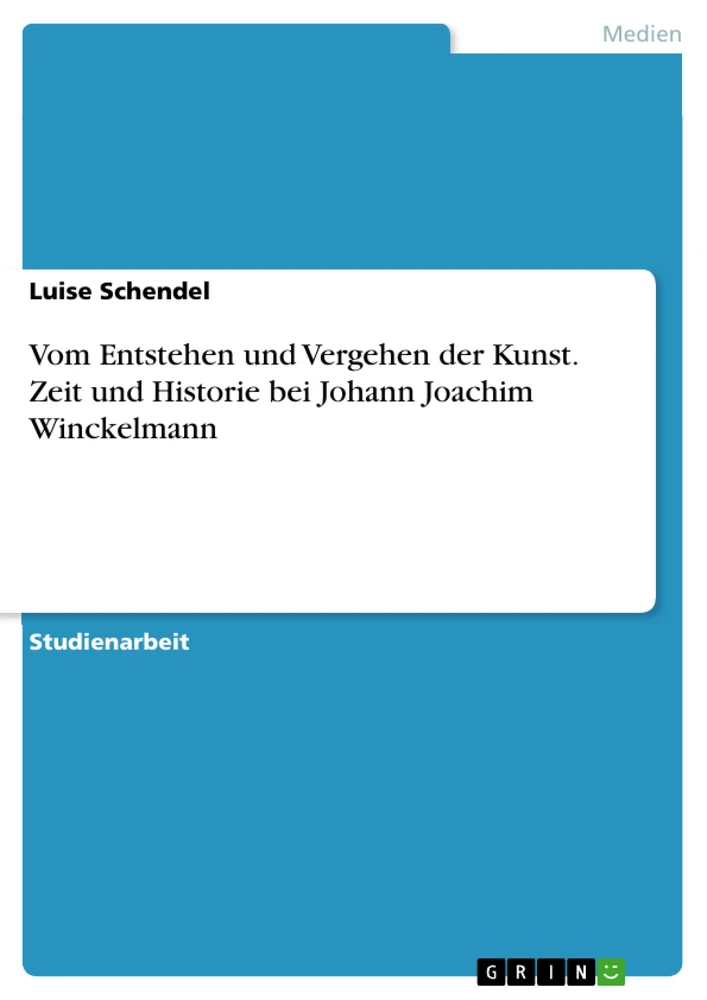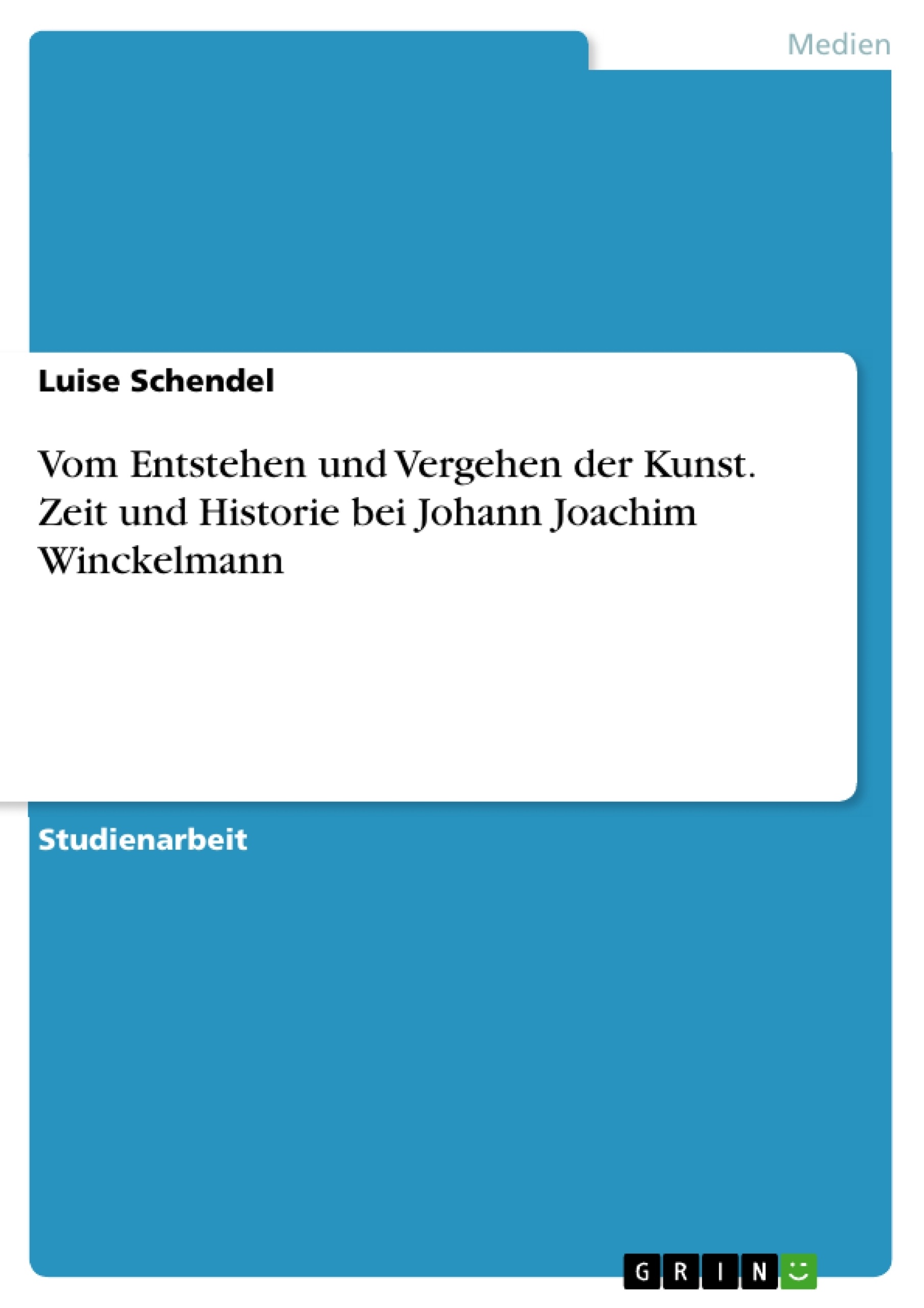Die Zeit um 1760 war durch kunsttheoretische Zerrissenheit in den Reihen der Gelehrten geprägt. So meinte schon Wilhelm Senff in seinen Anmerkungen zur „Geschichte der Kunst des Altertums“ des Jahres 1764, dass in jener Zeit die weltlichen und kirchlichen Obrigkeiten Anschauungen begünstigten, die das Kunstschaffen auf die ‚unwissenschaftliche’ Wirksamkeit transzendentaler Kräfte und nicht auf Zusammenhänge zu der gesellschaftlichen Wirklichkeit zurückführten. Dieser Lehre wurden vor allem in Frankreich und England wissenschaftliche Betrachtungen entgegengesetzt, deren theoretischen Höhepunkt wahrscheinlich der Franzose Jean Baptiste Du Bos mit seinen Schriften bildete. Jener bezog in seine Abhandlungen vor allem die gesellschaftlichen Faktoren in die Kunstbetrachtung mit ein – die „les causes morales“. Diesem Ansatz folgte später auch Johann Joachim Winckelmann - der Mann, der bis heute als Begründer der archäologischen Kunstwissenschaft gilt. Jener hatte die Zeit und die Geschichte als zentrale Fixpunkte der rückwärtigen Kunstbetrachtung und Kunsttheorie herausgearbeitet.
Inhaltsverzeichnis
- Die Betrachtung der Kunst.
- Johann Joachim Winckelmanns Studium der antiken Kunst.
- Voraussetzungen und Grundlagen.
- Die altertumsbezogene historische Kunstbetrachtung.
- Erste Schritte zur Untersuchung antiker Kunst und Geschichte
- Entstehung antiker (griechischer) Kunst.
- Die Größe der griechischen Kunst.
- Die Statuenbeschreibungen.
- Winckelmanns Laokoon.
- Die Beschreibung des Herkules- Torsos.
- Die,alte' und die neue' Kunst.
- Der,Ausdruck' und die Schönheit'.
- Differenzierung und Beurteilung.
- Die Nachahmung der,Alten'.
- Die Natur und die Nachahmung.
- Die Wurzeln der Nachahmung.
- Die innere Aporie.
- Erste Schritte zur Untersuchung antiker Kunst und Geschichte
- Die Rezeption der Theorien Johann Joachim Winckelmanns.
- Johann Gottfried Herder.
- Karl Philipp Moritz.
- Friedrich Schlegel.
- Die literarischen Rezipienten.
- Architekten und Plastische Künstler.
- Zwischen Vergangenheit und Gegenwart.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit von Luise Schendel befasst sich mit der Kunsttheorie Johann Joachim Winckelmanns, insbesondere mit seiner Betrachtung von Zeit und Geschichte. Der Fokus liegt auf Winckelmanns Studium der antiken Kunst und seiner Analyse der Entstehung und Entwicklung der Kunst im Laufe der Zeit. Schendel untersucht, wie Winckelmann die „alte“ Kunst von der „neuen“ Kunst unterschied und wie seine Theorien von späteren Denkern rezipiert wurden.
- Winckelmanns Kunsttheorie und seine Betrachtung von Zeit und Geschichte
- Das Studium der antiken Kunst und die Rolle der Zeit in Winckelmanns Analyse
- Die Unterscheidung zwischen „alter“ und „neuer“ Kunst
- Die Rezeption von Winckelmanns Theorien durch spätere Denker
- Der Einfluss von Winckelmanns Ansichten auf die Kunstgeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Die Betrachtung der Kunst
Dieses Kapitel stellt den Kontext der kunsttheoretischen Debatte um 1760 dar, in der die Ansichten Winckelmanns sich entwickelten. Es werden die unterschiedlichen Ansätze der Zeit beleuchtet, die entweder transzendentale Kräfte oder gesellschaftliche Faktoren in den Vordergrund stellten. Winckelmann, der die Kunst im Kontext von Zeit und Geschichte betrachtete, wird als eine bedeutende Stimme in diesem Diskurs vorgestellt.
Kapitel 2: Johann Joachim Winckelmanns Studium der antiken Kunst
Kapitel 2 befasst sich mit Winckelmanns Studium der antiken Kunst und den Grundlagen seiner Theorien. Es wird die Bedeutung seiner literarischen Bildung und die Notwendigkeit der Unterscheidung von Originalen und Nachahmungen in der Kunstbetrachtung hervorgehoben. Weiterhin wird die mangelnde wissenschaftliche Fundierung der Kunstgeschichte vor Winckelmann kritisiert, die zu fehlerhaften Einordnungen und Zuordnungen führte.
Kapitel 2.1: Voraussetzungen und Grundlagen
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Bedeutung der literarischen Bildung für Winckelmanns Kunstverständnis. Es wird betont, dass er die wissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Vorgänger als Ausgangspunkt für seine eigenen Untersuchungen nutzte. Die Notwendigkeit, bereits bestehende Ansichten zu berücksichtigen und neue Erkenntnisse zu gewinnen, wird deutlich gemacht.
Kapitel 2.2: Die altertumsbezogene historische Kunstbetrachtung
Dieses Unterkapitel untersucht Winckelmanns Ansatz zur Betrachtung der Kunst im Kontext der Geschichte. Es werden die ersten Schritte zur Untersuchung antiker Kunst und Geschichte erläutert, einschließlich der Unterscheidung zwischen Originalen und Nachahmungen. Die mangelnde zeitliche Einordnung der Kunst vor Winckelmann wird kritisiert, und es wird deutlich gemacht, dass die Geschichte der Kunst auf falschen oder ideellen Grundlagen basierte.
Kapitel 2.2.1: Erste Schritte zur Untersuchung antiker Kunst und Geschichte
Hier werden die ersten Schritte von Winckelmann bei der Analyse der antiken Kunst beschrieben, darunter die Untersuchung der Entstehung der griechischen Kunst und die Bedeutung der griechischen Kunst für die gesamte Kunstgeschichte.
Kapitel 2.2.2: Die Statuenbeschreibungen
Dieses Unterkapitel befasst sich mit Winckelmanns Analyse von antiken Statuen. Es werden zwei Beispiele für seine Statuenbeschreibungen vorgestellt: die Beschreibung des Laokoon und die Beschreibung des Herkules-Torsos.
Kapitel 2.2.3: Die,alte' und die neue' Kunst
Hier werden Winckelmanns Definitionen von „alter“ und „neuer“ Kunst vorgestellt. Es wird die Rolle des „Ausdrucks“ und der „Schönheit“ in seiner Kunsttheorie erläutert und die Unterschiede in der Beurteilung von antiker und moderner Kunst herausgestellt.
Kapitel 2.3: Die Rezeption der Theorien Johann Joachim Winckelmanns
Dieses Kapitel untersucht die Rezeption von Winckelmanns Theorien durch spätere Denker. Es werden die Ansichten von Johann Gottfried Herder, Karl Philipp Moritz und Friedrich Schlegel sowie die Rezeption durch literarische und künstlerische Kreise beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Kunsttheorie Johann Joachim Winckelmanns und seine Betrachtung von Zeit und Geschichte. Schlüsselbegriffe sind: antike Kunst, Kunstgeschichte, Kunstbetrachtung, "alte" Kunst, "neue" Kunst, Nachahmung, Ausdruck, Schönheit, historische Perspektive, zeitliche Einordnung, Rezeption, Johann Gottfried Herder, Karl Philipp Moritz, Friedrich Schlegel.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Johann Joachim Winckelmann?
Winckelmann gilt als der Begründer der modernen archäologischen Kunstwissenschaft und der Kunstgeschichte als wissenschaftliche Disziplin.
Was ist der Kern von Winckelmanns Kunsttheorie?
Er arbeitete Zeit und Geschichte als zentrale Fixpunkte der Kunstbetrachtung heraus und unterschied zwischen der „alten“ (antiken) und der „neuen“ Kunst.
Wie beurteilte Winckelmann die griechische Kunst?
Für Winckelmann war die griechische Kunst das Ideal von Schönheit und Ausdruck, was er unter anderem in seinen Beschreibungen des Laokoon und des Herkules-Torsos verdeutlichte.
Welche Rolle spielt die Nachahmung in seinem Werk?
Winckelmann propagierte die „Nachahmung der Alten“ als Weg zur Größe, wobei er zwischen bloßer Kopie und geistiger Nachahmung differenzierte.
Wer rezipierte Winckelmanns Theorien?
Bedeutende Denker wie Johann Gottfried Herder, Karl Philipp Moritz und Friedrich Schlegel setzten sich intensiv mit seinen Schriften auseinander.
- Citar trabajo
- M.A. Luise Schendel (Autor), 2008, Vom Entstehen und Vergehen der Kunst. Zeit und Historie bei Johann Joachim Winckelmann, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/266593