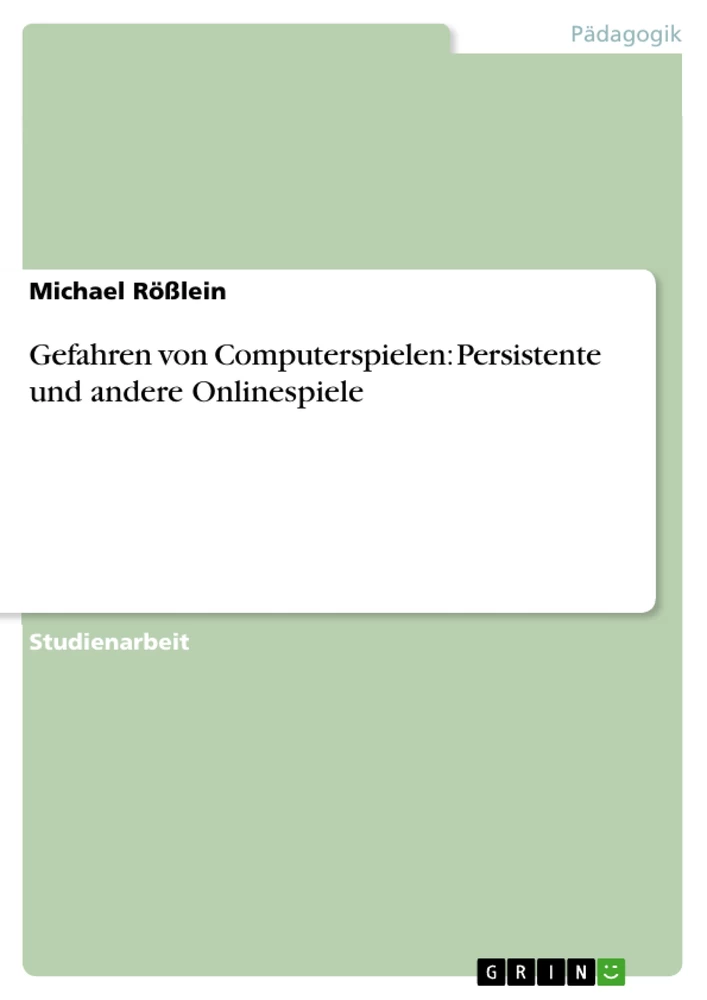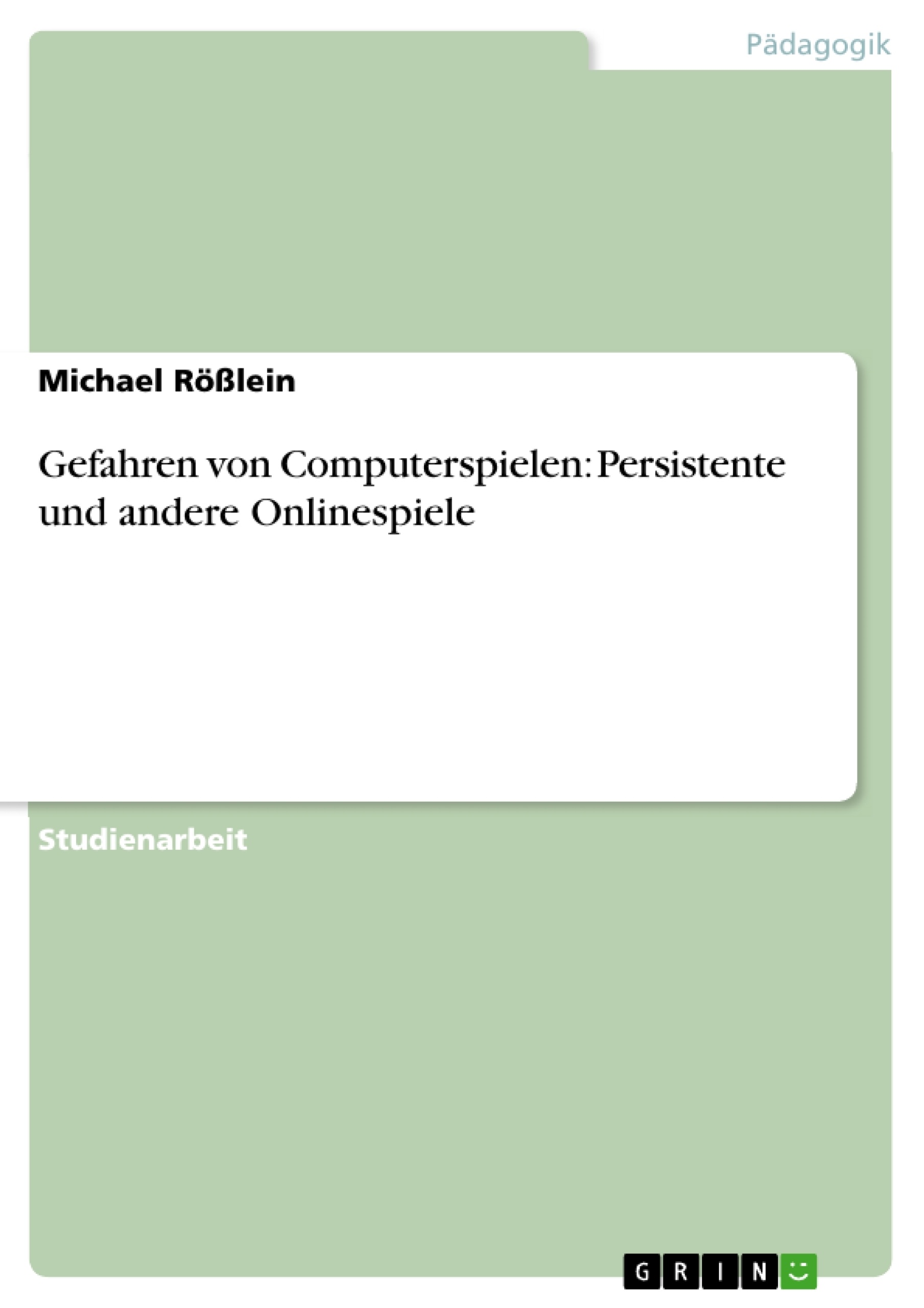In der vorliegenden Arbeit, deren Thema die Gefahren von Computerspielen sind, geht es in einem ersten Schritt darum, welche Spiele überhaupt süchtig machen können. Anschließend werden diese Spieltypen näher erläutert, da es verschiedene Arten gibt. Der darauf folgende Absatz beschäftigt sich mit der Definition von Sucht, um ein erstes Grundverständnis davon zu erhalten. Weiterhin wird erörtert, welches suchtfördernde Potential in unserer Gesellschaft vorliegt, bevor es um die eigentliche Klassifikation der Computerspielsucht und den Kennzeichen dieser Sucht geht. Hierzu gehört auch die kurze Betrachtung und Erläuterung eines integrativen ätiologischen Modells, das zu erklären versucht, welche Faktoren eine Sucht begünstigen. Somit wird in dieser Arbeit vornehmlich auf die Computerspielsucht eingegangen, da diese die größte Gefahr bei Computerspielen darstellt. Doch anschließend an die Kennzeichen und die Klassifikation der Computerspielsucht wird versucht, einen ergänzenden Überblick zu geben, der die Gefahren anspricht, welche oft aus der Computerspielsucht entstehen können, wie z.B. das aggressive Verhalten von Betroffenen oder der Realitätsverlust. Am Ende dieser Arbeit soll der Zusammenhang zwischen diesem Thema und dem Lehrplan für den katholischen Religionsunterricht des bayerischen Gymnasiums hergestellt werden. Damit soll gezeigt werden, dass dieses - relativ moderne - Thema im Religionsunterricht gewinnbringend eingebracht werden kann.
Gliederung:
1. Einleitung
2. Gefahren von Computerspielen
2.1. Grad der Beständigkeit von Computerspielen
2.1.1. Nicht persistente Onlinespiele
2.1.2. Persistente Onlinespiele
2.1.2.1. Persistente Online-Welten mit Avataranbindung
2.1.2.2. Persistente Online-Welten mit Siedlungsbindung
2.2. Definition des Begriffs Sucht nach Schulz
2.3. Suchtförderndes Potential
2.4. Klassifikation der Computerspielsucht
2.5. Kennzeichen der Computerspielsucht nach Grüsser
2.6. Integratives ätiologisches Modell
2.7. Weitere Gefahren von Computerspielen
2.7.1. Aggressives Verhalten
2.7.2. Soziale Folgen
2.7.3. Realitätsverlust
2.7.4. Physische Folgen
2.7.5. Goldfarmen
2.8. Religionspädagogischer Bezug
3. Resümee
4. Literaturverzeichnis
Häufig gestellte Fragen
Was sind persistente Onlinespiele?
Persistente Onlinespiele sind virtuelle Welten, die sich auch dann weiterentwickeln, wenn der einzelne Spieler nicht eingeloggt ist. Dies erzeugt einen hohen sozialen Druck und Bindung an das Spiel.
Wie wird Computerspielsucht klassifiziert?
Die Arbeit nutzt Definitionen nach Schulz und Kennzeichen nach Grüsser, um Suchtverhalten durch Kontrollverlust, Priorisierung des Spielens und soziale Isolation zu beschreiben.
Welche sozialen Folgen kann die Spielsucht haben?
Zu den Folgen zählen aggressives Verhalten, der Verlust realer sozialer Kontakte und ein zunehmender Realitätsverlust, bei dem die virtuelle Welt wichtiger wird als das echte Leben.
Was erklärt das integrative ätiologische Modell?
Dieses Modell versucht die verschiedenen Faktoren (persönliche, soziale und spielimmanente) zu erklären, die die Entstehung einer Computerspielsucht begünstigen.
Gibt es einen Bezug zum Religionsunterricht?
Ja, die Arbeit stellt einen Zusammenhang zum Lehrplan für katholischen Religionsunterricht an bayerischen Gymnasien her, um das Thema ethisch und pädagogisch aufzuarbeiten.
- Arbeit zitieren
- Michael Rößlein (Autor:in), 2011, Gefahren von Computerspielen: Persistente und andere Onlinespiele, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267408