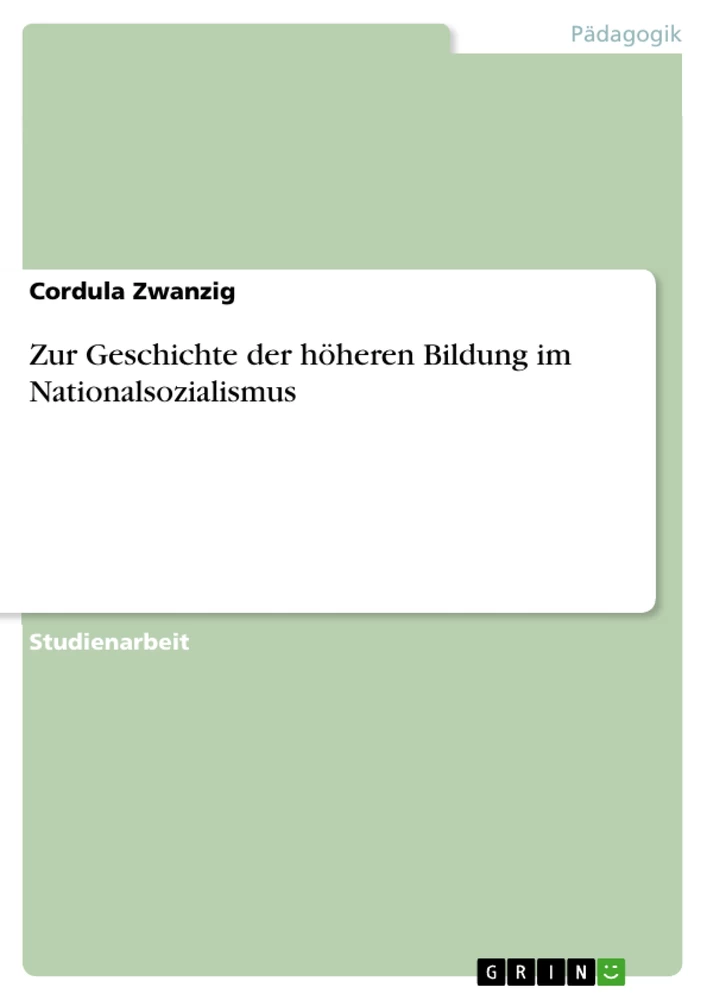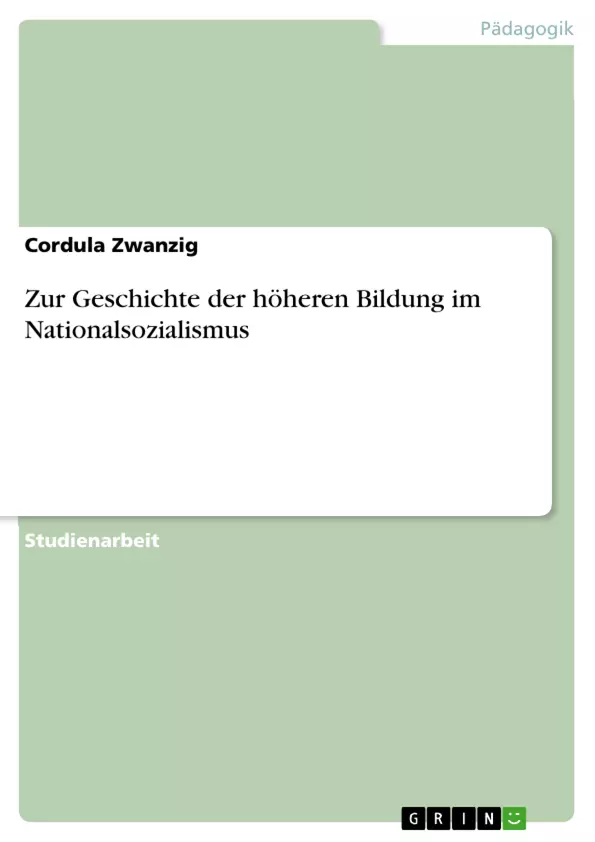Diese studentische Arbeit soll keine beschreibende Abhandlung in Jahreszahlen abliefern, sondern exemplarisch zu zeigen, wie humanistische Bildungsgedanken so sehr außer Kraft gesetzt werden konnten, dass die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg unter dem Begriff der reeducation verfügten, dass neue Lehrer das deutsche Bildungssystem wieder auf einen von nationalsozialistischen Ideen freien Weg bringen sollten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Zielsetzung
- Einflüsse aus der Vergangenheit — Die Nachwirkungen der Weimarer Republik
- Hitlers Ideologie im Bezug auf Erziehung und ihre Widersprüche
- Die Zielvorstellungen speziell in der höheren Bildung
- Umsetzung und Maßnahmen in der höheren Bildung
- Kritische Schlussbetrachtung
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Geschichte der höheren Bildung im Nationalsozialismus. Sie analysiert die Einflüsse der Weimarer Republik auf die nationalsozialistische Erziehungsideologie, beleuchtet Hitlers Vorstellungen von Bildung und deren Umsetzung in der Praxis, und untersucht die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die höhere Bildung.
- Die Nachwirkungen der Weimarer Republik auf die nationalsozialistische Erziehung
- Hitlers Ideologie im Bezug auf Erziehung und ihre Widersprüche
- Die Zielvorstellungen des Nationalsozialismus für die höhere Bildung
- Die praktische Umsetzung der nationalsozialistischen Bildungspolitik
- Die Auswirkungen der nationalsozialistischen Bildungspolitik auf die deutsche Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die persönliche Motivation der Autorin für die Auseinandersetzung mit dem Thema dar und verdeutlicht den Widerspruch zwischen der heiteren Darstellung des Schulalltags im Film "Die Feuerzangenbowle" und der historischen Realität der nationalsozialistischen Erziehung. Die Autorin betont die Notwendigkeit, sich mit den Ursachen und Folgen der nationalsozialistischen Bildungspolitik auseinanderzusetzen, um die Gefahren dieser Ideologie zu verstehen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Einflüssen der Weimarer Republik auf die nationalsozialistische Erziehung. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den Bildungsidealen der Weimarer Republik und des Nationalsozialismus aufgezeigt, sowie die Probleme und Fehler des Bildungssystems der Weimarer Republik analysiert, die den Aufstieg des Nationalsozialismus begünstigten.
Das dritte Kapitel beleuchtet Hitlers Ideologie im Bezug auf Erziehung und ihre Widersprüche. Es analysiert Hitlers Vorstellungen von einer neuen, starken und autoritären Jugend, die für die Ziele des Nationalsozialismus eingesetzt werden sollte. Es werden die rassistischen und menschenverachtenden Ansichten Hitlers im Bezug auf Juden, Frauen und Menschen mit Behinderungen dargestellt.
Das vierte Kapitel widmet sich den Zielvorstellungen des Nationalsozialismus für die höhere Bildung. Es wird deutlich, dass die nationalsozialistische Bildungspolitik darauf abzielte, eine neue Elite zu schaffen, die die Ideologie des Nationalsozialismus verinnerlicht und für die Ziele des Regimes eingesetzt werden konnte. Die Bedeutung der "Adolf-Hitler-Schulen" und deren Rolle in der Ausbildung einer neuen Führungsschicht wird hervorgehoben.
Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der praktischen Umsetzung der nationalsozialistischen Bildungspolitik. Es werden die Maßnahmen zur Kontrolle und Unterdrückung des Bildungssystems, wie die Entlassung von Lehrkräften, die Einschränkung des Zugangs zu Hochschulen und die Einführung neuer Lehrpläne, aufgezeigt. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die Qualität der Bildung und die soziale Gerechtigkeit werden beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Geschichte der höheren Bildung im Nationalsozialismus, die nationalsozialistische Erziehungsideologie, Hitlers Vorstellungen von Bildung, die Umsetzung der nationalsozialistischen Bildungspolitik in der Praxis, die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die höhere Bildung und die deutsche Gesellschaft, sowie die Rolle der Lehrer und Schüler in diesem Kontext. Der Text beleuchtet die Gefahren der nationalsozialistischen Ideologie und die Bedeutung der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit für die Gegenwart.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurde das Bildungssystem im Nationalsozialismus instrumentalisiert?
Die nationalsozialistische Führung setzte humanistische Bildungsgedanken außer Kraft, um eine neue Elite heranzuziehen, die die Ideologie des Regimes verinnerlichte. Schulen wurden zu Orten der Indoktrination und Kontrolle.
Welche Rolle spielten die "Adolf-Hitler-Schulen"?
Diese Schulen dienten speziell der Ausbildung einer neuen Führungsschicht. Sie waren zentraler Bestandteil der nationalsozialistischen Zielvorstellung, eine ideologisch gefestigte und körperlich leistungsstarke Elite zu schaffen.
Welchen Einfluss hatte die Weimarer Republik auf die NS-Bildungspolitik?
Die Arbeit analysiert Fehler und Probleme des Bildungssystems der Weimarer Republik, die den Aufstieg des Nationalsozialismus begünstigten, sowie die radikale Abkehr von den dortigen demokratischen Idealen.
Wie veränderte sich der Alltag für Lehrer und Schüler in der höheren Bildung?
Es kam zur Entlassung unliebsamer Lehrkräfte, zur Einführung neuer, ideologisch geprägter Lehrpläne und zur Einschränkung des Hochschulzugangs für bestimmte Bevölkerungsgruppen, was die Qualität der Bildung massiv beeinträchtigte.
Was bedeutete der Begriff "reeducation" nach dem Zweiten Weltkrieg?
Die Alliierten verfügten die "reeducation" (Umerziehung), um das deutsche Bildungssystem von nationalsozialistischen Ideen zu befreien und neue Lehrer einzusetzen, die demokratische Werte vermitteln sollten.
- Quote paper
- Cordula Zwanzig (Author), 2010, Zur Geschichte der höheren Bildung im Nationalsozialismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267556