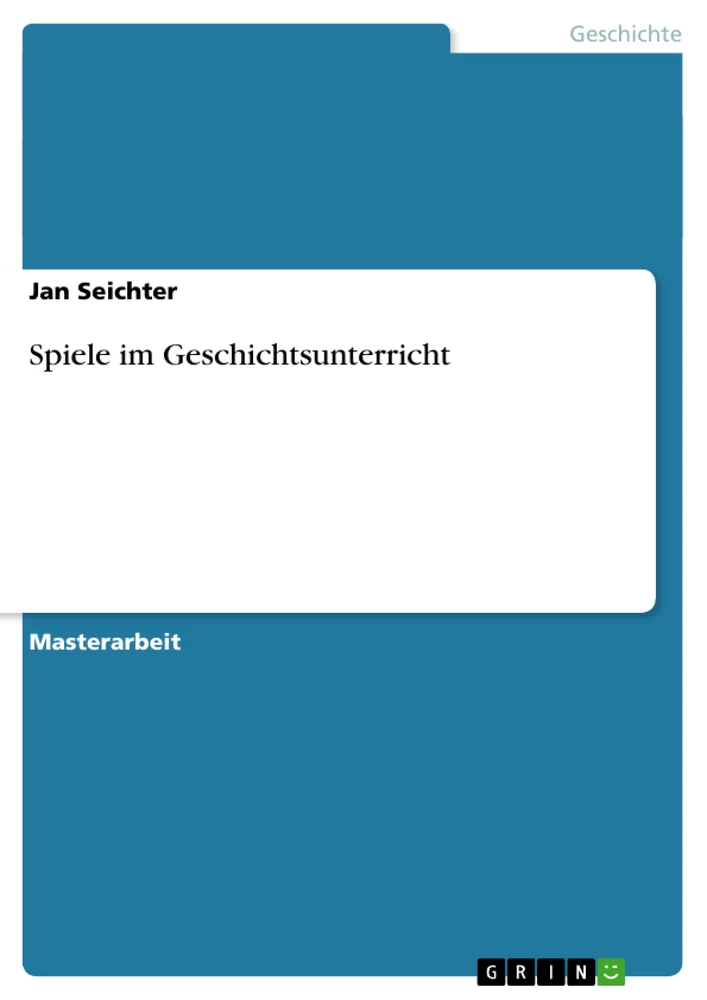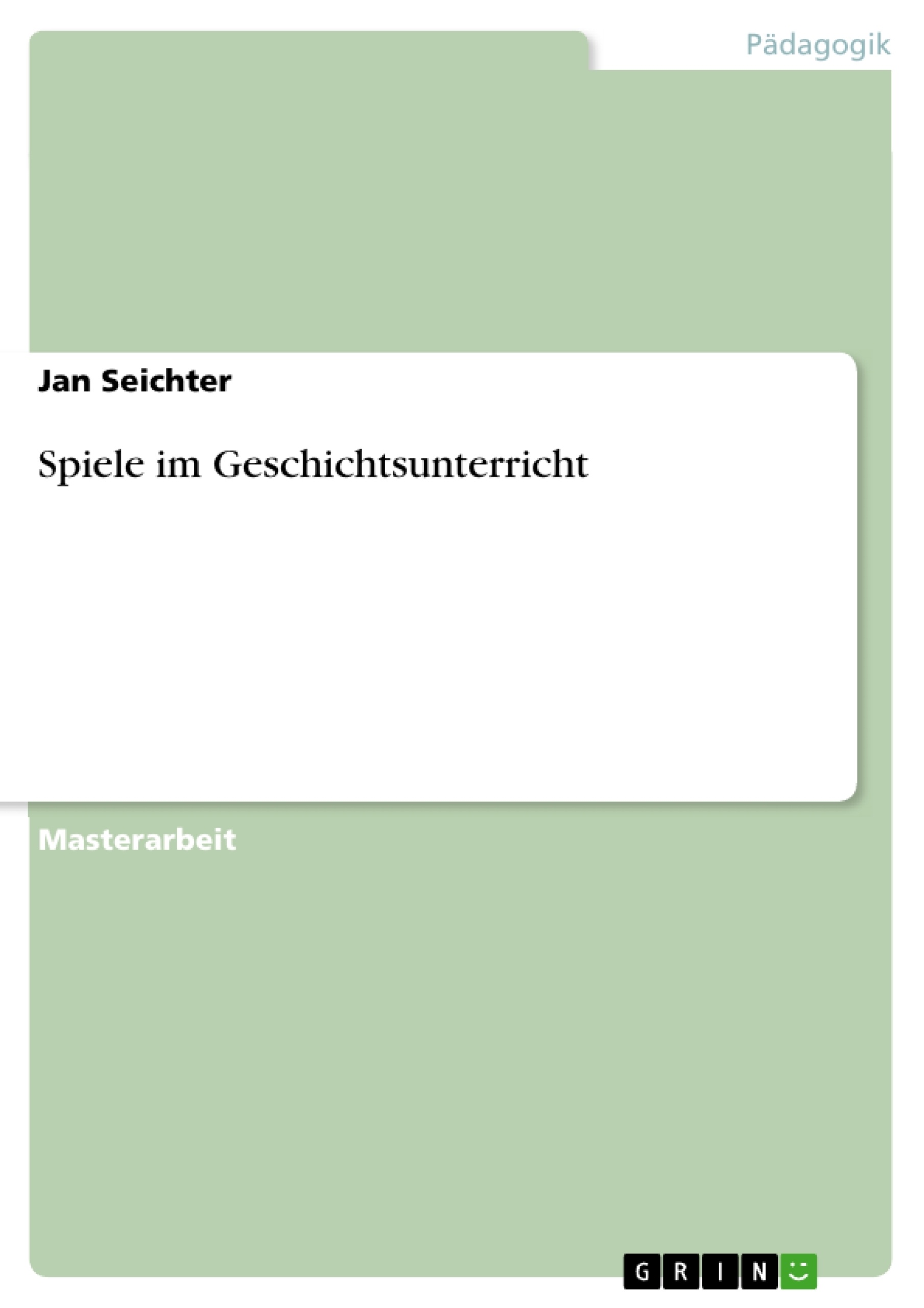Durch den Widerspruch zwischen der einerseits vorhandenen Skepsis gegenüber dem Spiel und dem andererseits immer wieder beschworenen Potential der Methode wurde diese Arbeit inspiriert. Da in der Literatur bereits sehr stark auf die Parallele zwischen dem Lernen eines Kindes durch spielerische Aktivitäten und dem Lernen in der Schule abgestellt wird, um den Einsatz des Spiels im Unterricht zu verteidigen, soll hier einen Schritt weitergegangen werden: Unter welchen Voraussetzungen sind Spiele eine Bereicherung für den Geschichtsunterricht?
Dazu wird zunächst der Stand der Forschung sowie bestehende Kontroversen des Themen-gebiets betrachtet. Die darauf folgende Betrachtung wird schließlich in drei Schwerpunktbe-reiche unterteilen.
Der Erste setzt sich damit auseinander, was überhaupt unter einem Spiel zu verstehen ist. Diese Betrachtung ist von Bedeutung, da dieser Begriff in der Literatur keineswegs einheitlich verwendet wird. Versuche ein System zu entwickeln, um Spielgattungen entsprechend zu kategorisieren, haben sehr unterschiedliche und meist auch sehr komplexe Ergebnisse zu Tage gefördert. Vor allem der Unterschied zwischen Spielen und dem Feld der spielerischen Lernformen wird dabei oft soweit verwischt, dass eine klare Abgrenzung kaum noch möglich ist. Um ein notwendiges Verständnis des Begriffs zu generieren, sollen die von Bernhardt dargelegten Wesensmomente im Zentrum stehen und um geschichtsdidaktische Spezifika ergänzt werden.
Im zweiten großen Komplex der Arbeit wird eine kognitionspsychologische Perspektive ein-genommen, um die Funktionsweise des Gedächtnisses und vor allem der Übermittlung von Informationen in das Langzeitgedächtnis zu betrachten. Damit soll die Frage geklärt werden, wie Spiele konstruiert sein müssen, um den Schülern die relevanten Informationen so zu präsentieren, dass sie möglichst leicht und nachhaltig im Gedächtnis abgespeichert werden, bzw. zu klären, ob Spiele überhaupt in der Lage sind, diese psychologischen Bedingungen des Lernens zu erfüllen und an sie angepasst werden können.
Der dritte Bereich steht unter der Fragestellung, welche Ziele sich mit einem Spiel im Geschichtsunterricht erreichen lassen. Dafür werden anhand eines auf Sauer und Schneider aufbauenden Kompetenzmodells für den Geschichtsunterricht Analysen vorgenommen, die darüber Auskunft geben, welche Kompetenz durch welche Spielform erlernt werden kann, was im Anhang in übersichtlichen Tabellen auf einen Blick nachgeschlagen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Stand der Forschung
- 3. Der Begriff „Spielen“
- 3.1. Definitionsversuche
- 3.2. Wesensmomente des Spiels
- 3.2.1. Das Moment der Freiheit
- 3.2.2. Das Moment der inneren Unendlichkeit
- 3.2.3. Das Moment der Scheinhaftigkeit
- 3.2.4. Das Moment der Ambivalenz
- 3.2.5. Das Moment der Geschlossenheit
- 3.2.6. Das Moment der Gegenwärtigkeit
- 3.3. Zwischenfazit
- 4. Spiele aus kognitionspsychologischer Sicht
- 4.1. Faktoren des Lernens und ihre Auswirkungen auf Spiele
- 4.1.1. Wahrnehmung und Aufmerksamkeit
- 4.1.2. Arbeitsgedächtnis
- 4.1.3. Langzeitgedächtnis
- 4.2. Alterseinflüsse auf das Lernen durch Spiele
- 4.3. Spiele als psychologisch wertvolles Lernen
- 5. Spiele aus geschichtsdidaktischer Sicht
- 5.1. Maßstab für eine Bereicherung des Unterrichts
- 5.2. Unterschiedliche Spielarten als unterschiedliche Bereicherung
- 5.2.1. Lernspiel
- 5.2.2. Rollenspiel
- 5.2.3. Imitationsspiele (Szenisches Spiel)
- 5.2.4. Planspiele
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Voraussetzungen, unter denen Spiele den Geschichtsunterricht bereichern können. Sie geht der Frage nach, wie Spiele gestaltet sein müssen, um einen hohen Lerneffekt zu erzielen und für welche Lernziele ihr Einsatz besonders geeignet ist. Der Fokus liegt auf der Entwicklung praxisorientierter Hilfestellungen für Lehrkräfte zur Konstruktion und Anwendung von Spielen im Unterricht.
- Definition des Spielbegriffs und seiner Bedeutung im Kontext des Geschichtsunterrichts
- Kognitionspsychologische Analyse von Lernprozessen im Zusammenhang mit Spielen
- Geschichtsdidaktische Bewertungskriterien für den Spieleinsatz im Unterricht
- Entwicklung eines Katalogs von Gestaltungselementen für effektive Lernspiele im Geschichtsunterricht
- Praxisorientierter Ansatz mit konkreten Beispielen für die Anwendung im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Kontrast zwischen positiven Spielerfahrungen und oft negativen Schulerfahrungen dar und führt die Forschungsfrage ein: Unter welchen Voraussetzungen bereichern Spiele den Geschichtsunterricht? Die Arbeit setzt den Spieleinsatz im Unterricht voraus und fokussiert auf geschichtsdidaktische Aspekte der Spielgestaltung für Schüler der 5. bis 12. Klasse. Sie zielt darauf ab, Lehrkräften Hilfestellung bei der Konstruktion und Anwendung von Spielen zu geben, eine Lücke in der bestehenden Literatur zu schließen.
2. Stand der Forschung: Dieses Kapitel wird den aktuellen Forschungsstand und bestehende Kontroversen zum Thema Spiele im Unterricht beleuchten. Es wird die vorhandene Literatur analysieren und die Diskussionen um die Integration von Spielen in den Unterricht zusammenfassen, um den Kontext der vorliegenden Arbeit zu etablieren.
3. Der Begriff „Spielen“: Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Spielen" und den unterschiedlichen Verwendung in der Literatur. Es wird verschiedene Definitionsversuche analysieren und die von Bernhardt dargestellten Wesensmomente des Spiels im Detail untersuchen, diese mit geschichtsdidaktischen Spezifika ergänzen und somit zu einem fundierten Verständnis des Begriffs gelangen.
4. Spiele aus kognitionspsychologischer Sicht: Dieses Kapitel untersucht den Lernprozess aus kognitionspsychologischer Perspektive und analysiert die Funktionsweise des Gedächtnisses, insbesondere die Übertragung von Informationen ins Langzeitgedächtnis. Es wird untersucht, wie Spiele gestaltet sein müssen, um einen optimalen Lernerfolg zu erzielen. Hierbei werden die einzelnen Gedächtniskomponenten und der Einfluss des Alters auf das Lernen durch Spiele beleuchtet, wobei auf bereits bestehende Literatur zur Altersentwicklung verwiesen wird. Die Kapitel argumentiert für die Bedeutung von Spielen als psychologisch wertvolles Lernmittel und stützt diese Argumentation durch empirische Studien.
5. Spiele aus geschichtsdidaktischer Sicht: Dieses Kapitel fokussiert auf geschichtsdidaktische Aspekte des Spieleinsatzes. Es wird ein Maßstab zur Bewertung von Spielen im Geschichtsunterricht entwickelt, basierend auf Kompetenzmodellen von Sauer und dem Forschungsprojekt „FUER Geschichtsunterricht“. Anschließend werden unterschiedliche Spielarten (Lernspiele, Rollenspiele, Imitationsspiele, Planspiele) im Hinblick auf ihre jeweilige Bereicherung des Unterrichts analysiert.
Schlüsselwörter
Spiele, Geschichtsunterricht, Lernen, Kognitionspsychologie, Geschichtsdidaktik, Lernspiele, Rollenspiele, Kompetenzorientierung, Schüleraktivität, Unterrichtsgestaltung, Lernmethoden.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Spiele im Geschichtsunterricht
Was ist der Gegenstand dieser Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Voraussetzungen, unter denen Spiele den Geschichtsunterricht bereichern können. Sie befasst sich mit der Gestaltung von Spielen für einen hohen Lerneffekt und der Eignung für verschiedene Lernziele. Der Fokus liegt auf praxisorientierten Hilfestellungen für Lehrkräfte zur Konstruktion und Anwendung von Spielen im Unterricht.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition des Spielbegriffs und seiner Bedeutung im Geschichtsunterricht; kognitionspsychologische Analyse von Lernprozessen im Zusammenhang mit Spielen; geschichtsdidaktische Bewertungskriterien für den Spieleinsatz im Unterricht; Entwicklung eines Katalogs von Gestaltungselementen für effektive Lernspiele im Geschichtsunterricht; praxisorientierter Ansatz mit konkreten Beispielen für die Anwendung im Unterricht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Stand der Forschung, Der Begriff „Spielen“, Spiele aus kognitionspsychologischer Sicht, Spiele aus geschichtsdidaktischer Sicht und Fazit. Jedes Kapitel bearbeitet einen spezifischen Aspekt der Forschungsfrage und baut aufeinander auf.
Was wird im Kapitel "Der Begriff 'Spielen'" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert verschiedene Definitionsversuche des Begriffs "Spielen" und untersucht detailliert die von Bernhardt dargestellten Wesensmomente des Spiels. Es ergänzt diese mit geschichtsdidaktischen Spezifika, um ein fundiertes Verständnis des Begriffs zu ermöglichen.
Welche kognitionspsychologischen Aspekte werden betrachtet?
Das Kapitel "Spiele aus kognitionspsychologischer Sicht" untersucht den Lernprozess aus kognitionspsychologischer Perspektive. Es analysiert die Funktionsweise des Gedächtnisses (Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Langzeitgedächtnis) und den Einfluss des Alters auf das Lernen durch Spiele. Es argumentiert für die Bedeutung von Spielen als psychologisch wertvolles Lernmittel, gestützt durch empirische Studien.
Wie werden Spiele aus geschichtsdidaktischer Sicht bewertet?
Das Kapitel "Spiele aus geschichtsdidaktischer Sicht" entwickelt einen Maßstab zur Bewertung von Spielen im Geschichtsunterricht, basierend auf Kompetenzmodellen. Es analysiert verschiedene Spielarten (Lernspiele, Rollenspiele, Imitationsspiele, Planspiele) hinsichtlich ihrer Bereicherung des Unterrichts.
Welche Zielgruppe wird mit der Arbeit angesprochen?
Die Arbeit richtet sich primär an Lehrkräfte des Geschichtsunterrichts der Klassen 5 bis 12. Sie soll ihnen Hilfestellung bei der Konstruktion und Anwendung von Spielen im Unterricht bieten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Spiele, Geschichtsunterricht, Lernen, Kognitionspsychologie, Geschichtsdidaktik, Lernspiele, Rollenspiele, Kompetenzorientierung, Schüleraktivität, Unterrichtsgestaltung, Lernmethoden.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Unter welchen Voraussetzungen bereichern Spiele den Geschichtsunterricht?
Welche Lücke in der bestehenden Literatur schließt die Arbeit?
Die Arbeit schließt die Lücke, indem sie praxisorientierte Hilfestellungen für Lehrkräfte zur Konstruktion und Anwendung von Spielen im Geschichtsunterricht bietet, ein Aspekt, der in der bestehenden Literatur oft unzureichend behandelt wird.
- Citar trabajo
- Jan Seichter (Autor), 2013, Spiele im Geschichtsunterricht, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/267804